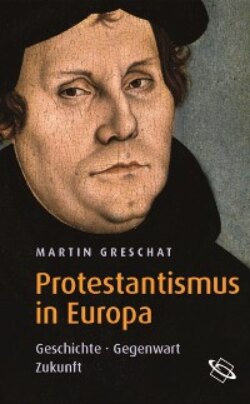Читать книгу Protestantismus in Europa - Martin Greschat - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[Menü]
1. Voraussetzungen
Der Protestantismus beginnt nicht 1517 mit Luthers Thesenanschlag in Wittenberg gegen den Ablass; auch nicht 1522 mit dem demonstrativen Bruch der Fastengebote durch das Wurstessen Zwinglis und einiger Gefährten in Zürich. Den Anfang der evangelischen Kirche in Europa bildet nicht das Augsburger Bekenntnis (1530), auch nicht das Zweite Helvetische (1566), nicht der Heidelberger Katechismus (1563) oder ein anderer Lehrtext. Diese Konkretionen des Protestantismus und der evangelischen Kirche – die Begriffe bezeichnen den weitgespannten und den engeren Kreis des Phänomens – werden erst voll verständlich, wenn wir sie im Zusammenhang mit der Gesamterscheinung des Christentums betrachten. Um es in einem Bild auszudrücken: Hier handelt es sich um Äste am weitverzweigten Baum der Christenheit. Den Stamm bildet der bei aller Vielfältigkeit doch gemeinsame Glaube an Gottes heilsames Handeln in Jesus Christus. Und dieses wiederum lässt sich nur erfassen, wenn man es im Kontext, mehr noch: in der Verwurzelung der Offenbarung desselben Gottes an Israel begreift – wovon die Bibel in beiden Testamenten zeugt.
Nur in diesem Rahmen also ist es sinnvoll, von Europa und dem Protestantismus zu reden. Aber eben auch notwendig. Denn das Christentum gibt es lediglich in verschiedenen, genauer gesagt: in kulturellen Konkretionen.1 Von zentraler Bedeutung ist deshalb die Übersetzung, sowohl im schlicht grammatisch-sprachlichen als auch im sehr viel grundsätzlicheren Sinn der Übertragung einer Mitteilung und erst recht einer Heilszusage aus einem Denk- und Lebensbereich in einen anderen. Ein solches Über-Setzen impliziert stets auch eine Interpretation, d. h. die Auslegung des in diesem Kontext Gemeinten in den anderen sprachlichen und kulturellen Kontext hinein.
Dieser Sachverhalt ist nicht nur Theologen, sondern allen aufmerksamen Lesern des Neuen Testamentes vertraut. Jesus sprach aramäisch. Aber abgesehen von einigen Wendungen in dieser Sprache sind seine Botschaft wie auch der Bericht von seinem Leben, Sterben und Auferstehen griechisch überliefert. Das war – der heutigen Rolle des Englischen vergleichbar – die Sprache, in der sich die Menschen der verschiedenen Völker und Kulturen, die im Römischen Reich rings um das Mittelmeer lebten, miteinander verständigten. Es war auch die Sprache des hellenistischen Judentums, als dessen Teil sich die frühe Christenheit zunächst verstand. Seit sich jedoch eine Gruppe von Christen als vom Judentum losgelöst begriff – das war erstmals in der syrischen Großstadt Antiochia der Fall (Apg. 11,26) –, verblasste mehr und mehr auch das Verständnis der jüdischen Terminologie. Vom „Messias“ zu reden, machte fortan wenig Sinn. Dementsprechend wurde aus dem griechischen Äquivalent „Christos“ der Eigenname des Jesus von Nazareth – und folgerichtig auch seiner Anhänger. Die endzeitlich gefüllte aramäische Bezeichnung „Menschensohn“ brachte nun vor allem die geheimnisvolle Fremdheit dieses Gottgesandten zum Ausdruck. Gleichzeitig wurden neue, der heidnischen religiösen Umwelt entstammende Hoheitstitel auf Jesus übertragen, um seine überlegene Heilsbedeutung und überwältigende erlösende Macht zum Ausdruck zu bringen, z.B. „Kyrios“, Herr; „Soter“, Retter; Sohn Gottes. Mit der Gleichsetzung des Christus mit dem hellenistisch-stoischen „Logos“ gewann die frühe christliche Theologie dann ein besonders fruchtbares Interpretationsmodell: Der Begriff umfasst sowohl die Besonderheit des göttlichen Schöpfungswortes im Alten Testament als auch das in der griechischen Philosophie gegründete Phänomen einer die Welt tragenden und durchdringenden rationalen Mächtigkeit.
Diese wenigen Hinweise sollen genügen. Sie dürften hinlänglich deutlich gemacht haben, dass es auch und gerade bei der Übersetzung der christlichen Botschaft von einer Sprache in die andere nicht einfach um den Austausch von Worten und Wendungen ging, sondern um einen ebenso umfassenden wie komplizierten Prozess der Übertragung von einer Kultur in die andere. Gleichzeitig lässt die Beobachtung dieses Vorgangs jedoch auch erkennen, dass die frühe Christenheit hierin offenbar keinen Notbehelf sah, sondern ein wesentliches Kennzeichen der eigenen Botschaft. Zur Konstituierung der Kirche durch die Ausgießung des Hl. Geistes am Pfingsttag gehörte, dass jeder der Versammelten die Heilsbotschaft, also das Evangelium von Jesus Christus, in seiner Muttersprache vernahm. Wie im Judentum zielte diese Verkündigung auf den Einzelnen. Aber anders als im Judentum blieb die christliche Botschaft nicht eingebunden in die nationalen Grenzen des Volkes Israel, sondern ging prinzipiell darüber hinaus. Diese winzige Gruppe der Christenheit begriff sich also als transnationale, mehr noch: als die universale Religion. Und so, wie vor Gott alle Menschen gleich waren, hatten hier auch sämtliche Völker und Kulturen denselben Rang.
Dass damit die Vorrangstellung des Judentums gegenüber den Heiden an einem zentralen Punkt nicht mehr galt, hat niemand in der frühen Christenheit so klar und kompromisslos dargelegt wie Paulus. Dabei ging es ihm vor allem um die Hervorhebung des Faktums, dass Gott Neues geschaffen hat durch die Auferweckung Jesu von den Toten. Und dass dadurch eine Zukunft eröffnet wurde, die fortan lebensbestimmend sein müsste und könnte. Aufgrund dieser Realität gewann der christliche Glaube nun in den Städten rund um das Mittelmeer Gestalt – und zwar in sehr vielfältiger Weise, wie wir aus den Briefen des Paulus und insgesamt aus der Geschichte der frühen Christenheit wissen. Anders ausgedrückt: Es gab nicht das eindeutige, fest umrissene Modell, nach dem man sich überall gerichtet hätte. Ein solches wurde nach intensiven Diskussionen zwischen Paulus und den Vertretern der Urgemeinde in Jerusalem von der jungen Christenheit ausdrücklich abgelehnt. Zu den zentralen Voraussetzungen der Jerusalemer Gemeinde gehörte bekanntlich die Überzeugung, dass einer Jude sein müsse, bevor er Christ werden könnte. Dieses Modell wurde nicht verworfen. Aber es wurde insofern relativiert, als jetzt daneben gleichberechtigt die Möglichkeit stand, direkt vom Heidentum in die christliche Gemeinde überzutreten (Apg.15). Wenn Paulus dann in diesen Gemeinden für eine Kollekte für die Jerusalemer warb, ließ er bei aller Hochschätzung für sie doch keinen Zweifel an der absoluten Gleichberechtigung seiner heidenchristlichen Gemeinden aufkommen.
Dieser Vorgang hat wiederum prinzipielle Bedeutung. Denn er legitimiert den theologischen, kirchlichen und eben auch kulturellen Pluralismus, der uns im Christentum von Anfang an entgegentritt. Dieses Phänomen ist jedem Leser des Neuen Testaments vertraut: Die Botschaft von der Erlösung und dem Heil in Jesus Christus, die Gott den Menschen mitteilen lässt, kann sicherlich nur eine sein. Und doch begegnet sie in Gestalt von vier Büchern, den vier Evangelien. Sie verdanken ihre Abfassung auch jenem Unterschied von Juden- und Heidenchristen, aber keineswegs ausschließlich. Unverkennbar spiegelt sich in jenen Texten das Bemühen, das eine Evangelium von Jesus Christus in unterschiedliche kulturelle Räume hinein zu übersetzen.
Im Prozess der Herausbildung des neutestamentlichen Kanons, d.h. der Festlegung, welche Schriften als Orientierung und Norm für den Lebensvollzug wie auch die lehrmäßigen Aussagen der Gemeinden zu gelten hätten, wurden dann die vier Evangelien akzeptiert. Dieses Faktum belegt einmal mehr die prinzipielle Offenheit des Christentums für eine erstaunliche Vielfalt von Möglichkeiten der Übersetzung. Derselbe Vorgang der Kanonbildung belegt freilich auch, dass dieser Pluralismus nicht mit inhaltlicher Beliebigkeit verwechselt werden darf.
Dass es sich dabei nicht um eine theoretische, sondern eine sehr reale, praktische Gefahr handelt, liegt nach dem Gesagten auf der Hand. Denn wenn es zur Eigenart des Christentums gehört, das Evangelium in die verschiedenen Sprachen und Kulturen so zu übertragen, dass es hierin Wurzeln schlägt, kann aus einer solchen Anpassung an die jeweilige Umwelt leicht die Überwucherung und schließlich die Überwältigung des Evangeliums durch diese oder jene Kultur folgen – wie es etwa Adolf Harnack (1851–1930) wirkmächtig mit seiner These von der Hellenisierung des Christentums behauptet hat. Die Geschichte des Christentums bietet dafür in der Tat Beispiele in Hülle und Fülle. Sie zeigt aber auch, dass die Dämme, die das frühe Christentum dagegen baute, sich dauerhaft als hilfreich erwiesen haben, nämlich die Ausgestaltung einer die Gemeinden mehr oder weniger verbindenden gesamtkirchlichen Lehre über die Heilsbedeutung Jesu Christi, die Fixierung eines Kanons neutestamentlicher Schriften sowie das Festhalten am Alten Testament. Dieser auf Vereinheitlichung zielende Prozess hebt freilich die vorangegangene und fortgesetzte Übertragung der christlichen Botschaft in andere Sprachen und Kulturen keineswegs auf. Doch unverkennbar existiert daneben diese gegenläufige Bewegung. Die daraus erwachsenden Spannungen, Widersprüche und Gegensätzlichkeiten ließen sich im Verlauf der Jahre und Jahrhunderte zwar abbremsen und entschärfen. Beseitigen ließen sie sich jedoch nie, auch nicht in der Epoche der kirchlichen Vorherrschaft im Mittelalter. Diese Dynamik bestimmte – und bestimmt – vielmehr die Realität des Christentums im Verlauf seiner gesamten Geschichte.
Um voll zu erfassen, was das bedeutet, hilft ein Blick auf den Islam. Auch dieser breitete sich schnell über sein Ursprungsgebiet hinaus aus. Aber dabei wurde die religiöse Botschaft Mohammeds gerade nicht in andere Sprachen und Kulturen übersetzt, sondern in ihrer ursprünglichen arabischen Gestalt belassen. Der Koran galt und gilt als prinzipiell unübersetzbar. Die geoffenbarte Wahrheit hat einen zeitlos festen Ort. Sie will dementsprechend rituell nachvollzogen werden, z.B. in täglichen Gebeten. Unverkennbar begegnet auch im Christentum immer wieder ein solches, zwar an der Ausbreitung, aber nicht an der Übersetzung orientiertes Verständnis der Offenbarung, keineswegs nur im Mittelalter. Aber daneben existierte hier stets auch die andere Auffassung. So dominierend das Lateinische in der Kirche des Westens dann wurde: Die Predigten in der Volkssprache verschwanden nicht. Und in dem Maß, in dem die Alphabetisierung in Europa zunahm, wuchs auch die Zahl der frommen Lieder und erbaulichen Texte in den jeweiligen Muttersprachen sowie der Übersetzungen zumindest von Teilen der Bibel.
Der Stellenwert der Entwicklung Europas im Kontext der Geschichte des Christentums ist mit dem Gesagten umrissen. Hier fand eine Übersetzung des Evangeliums in diese anderen sprachlichen und kulturellen Kontexte statt – was die kirchlichen und gesellschaftlichen Strukturen dieses Kontinents, mithin die dort lebenden Menschen, dann in einer sehr spezifischen Weise prägte.