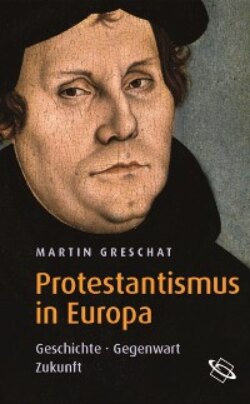Читать книгу Protestantismus in Europa - Martin Greschat - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Grundgegebenheiten Europas
ОглавлениеGebräuchlich war die Rede von Europa zunächst nicht. Man sprach stattdessen von der „Christenheit“ und meinte mit diesem Begriff sehr selbstverständlich die eigene, westliche, lateinisch sprechende Kirche im Unterschied zur östlichen, wo das Griechische dominierte.2 Auch in der christlichen Gemeinde in Rom wurde zunächst griechisch gesprochen – ein Hinweis neben anderen darauf, dass die neue Religion aus dem Osten kam. Griechischsprachig war z.B. noch im 2. Jahrhundert die Gemeinde in Lyon in Gallien. Doch hier sind auch keltische Predigten bezeugt. Aus der römischen Kolonistenstadt Karthago in Nordafrika wissen wir, dass es dort neben den selbstverständlich vorherrschenden lateinischen Predigten punische gab. Von Konstantinopel aus brachte Wulfila gotischen Stämmen, die während der Völkerwanderung nach Westen drängten, die christliche Botschaft in ihrer Muttersprache. Dieses fortgesetzte Bemühen, das Evangelium in die verschiedenen Volkssprachen zu übersetzen, bildet also eine andauernde Grundgegebenheit des Christentums in Europa.
Dominant war freilich das Lateinische. Es war die Sprache der Herrschenden, der politischen Verwaltung und des Rechtswesens, der Bildung sowie insgesamt der Kultur. Die Kirche übernahm diese Strukturen mitsamt vielen Inhalten. Sie integrierte ebenso Schritt um Schritt die unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung Westeuropas: die indigene Bevölkerung, die römischen Kolonisten und Bürger sowie dann insbesondere die germanischen Volksstämme. Und dieser Prozess war nun also identisch mit der Integration in die lateinische Sprache und Kultur im weitesten Sinn. Dieser Vorgang lässt sich mit der Ausbreitung des Englischen in unserer Zeit im Verbund mit der Durchsetzung der modernen Elektronik vergleichen. Der Begriff der Christianitas, der lateinischen Christenheit, bezeichnete dann exakt, worin von der Spätantike bis zum ausgehenden Mittelalter die Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Völkerschaften, Sprachen und Kulturen Westeuropas bestand.
Den sichtbaren Inbegriff dieser Christenheit bildete das Papsttum. Seinen Aufstieg begünstigten viele Faktoren, darunter vor allem das Fehlen einer politischen Zentralgewalt im Westen des Römischen Reiches. Diese Realität förderte die Herausbildung des Feudalismus mitsamt den darin liegenden rechtlichen und mentalen Implikationen. Davon wird noch zu reden sein. Alles das ermöglichte es dem Bischof von Rom, zunächst zur dominierenden religiösen Figur und dann zur herrschenden kirchlichen und politischen Gestalt in diesem geographischen Raum aufzusteigen. In welchem Ausmaß der Papst diese Christenheit zusammenfassen und zu mobilisieren vermochte, belegt der Aufruf Urbans II. im Jahr 1096 zum ersten Kreuzzug. Damit habe er, schreibt ein Historiker unserer Tage, einen „Nerv“ getroffen und folgerichtig bei vielen Menschen in allen Schichten und Regionen des Kontinents echte „Begeisterung“ ausgelöst.3 Selbstverständlich darf man deshalb nicht die politischen, ökonomischen und sozialen Faktoren außer Acht lassen, die bei diesem Kreuzzug eine gewichtige Rolle spielten. Aber das Bewusstsein der Einheit Europas verdichtete sich in der religiös begründeten und emotional erlebten Bereitschaft zum Kreuzzug für die Rückgewinnung Jerusalems und der anderen heiligen Stätten in Palästina. Charakteristisch für diesen inneren und äußeren Zusammenschluss Europas ist also auch, dass dazu die Militanz nach außen gehörte, in diesem Fall also die kriegerische Wendung gegen den Islam.
Fragt man, was darüber hinaus die inhaltliche Besonderheit Westeuropas ausmacht, sieht man sich mit zwei Büchern eines und desselben Autors konfrontiert, nämlich dem „Gottesstaat“ (De civitate Dei) und den „Bekenntnissen“ (Confessiones) Augustins. Es ist erstaunlich und faszinierend zugleich zu beobachten, in welchem Ausmaß dieser eine Theologe und Bischof jahrhundertelang das Denken und Handeln, die Frömmigkeit, Bildung und Kultur und nicht zuletzt die Politik der Kirche im Abendland beeinflusst hat. Das gesamte Mittelalter habe, heißt es, Augustin „entfaltet“. Das mag eine freundliche Übertreibung sein. Aber unbestreitbar ist, dass insbesondere jene beiden genannten Werke in einem für unser Verständnis unvorstellbaren Ausmaß im Verlauf des Mittelalters und durchaus auch noch darüber hinaus vervielfältigt, studiert und kommentiert worden sind. Das geschah nicht selten in recht eigenwilliger Manier, also keineswegs einfach im Gefolge der von Augustin vertretenen Intention. Seine Werke waren jedoch Autoritäten, die zunächst einmal die Richtung wiesen. Sie wurden dabei auch zu Gesprächspartnern insofern, als sie anleiteten, die eigene Wirklichkeit im Licht der Aussagen dieser Texte zu sehen und zu deuten. So boten die Schriften Augustins jahrhundertelang Christen Orientierung, setzten zugleich immer wieder neu Zeichen und Ziele. Und dabei war es keineswegs zufällig, dass sich dieses besondere geistige und religiöse Interesse auf Schriften, Bücher also richtete. Die europäische Christenheit bildete jahrhundertelang eine Buchkultur.
Was bedeutete diese Fixierung auf Augustin inhaltlich? Der „Gottesstaat“ handelt von zwei Herrschaftsverbänden, die grundsätzlich voneinander getrennt sind, denn der eine untersteht Gott und der andere dem Teufel. Aber dieser Gegensatz wird erst beim Jüngsten Gericht offenbar. Bis dahin sind die beiden Herrschaftsverbände sowohl in der Kirche also auch in der Welt unentwirrbar miteinander vermischt. Entscheidend ist nun, welchem Lager der einzelne Mensch angehört. „Wir haben“, schrieb Augustin, „das Menschengeschlecht in zwei Klassen eingeteilt. Zur einen gehören die, welche in der Orientierung auf den Menschen hin leben; die andere dagegen umfasst diejenigen, die in der Ausrichtung auf Gott leben. Im übertragenen Sinn nennen wir die beiden Klassen auch zwei Herrschaftsverbände, d. h. zwei Gemeinschaften von Menschen, von denen die eine vorherbestimmt ist, mit Gott in Ewigkeit zu herrschen, die andere aber in Gemeinschaft mit dem Teufel ewige Pein zu erdulden. […] Die gesamte Weltzeit nämlich, in der die Geschlechter kommen und gehen, fällt zusammen mit dem Fortgang jener beiden Herrschaftsverbände, von denen wir reden.“ (De civ. Dei, 15, 1)
Augustin entwirft hier eine Geschichtstheologie, die sich als ungemein fruchtbar erweisen sollte. Beim Betrachten der Spuren des Ineinanders und Gegeneinanders, welche durch das Ringen der beiden Herrschaftsverbände miteinander seit Beginn der Schöpfung in der Geschichte zu erkennen sind, werden gleichzeitig auch das Wesen und die Eigenart des Christentums veranschaulicht. Es existiert keineswegs losgelöst von der Welt, ist ganz und gar nicht weltflüchtig. Der einzelne Christ und die Gemeinde wirken mit an der Schaffung materieller und sozialer Güter, insbesondere des Friedens. Sie freuen sich daran und trauern über deren Verlust. Aber sie lassen es dabei nicht bewenden. Sie beruhigen sich nicht beim Erwerb und der Nutzung dieser Güter, sondern sehnen sich nach Anderem, Höherem. Wie der Christ, die Gemeinde, die Kirche voll und ganz in dieser Welt leben und dennoch Fremde, Ausländer und Ausgesetzte in ihr bleiben: Das ist eines der großen Themen in Augustins „Gottesstaat“.
Zur Entfaltung dieser Wirklichkeit gehört gleichzeitig die „Säkularisierung“ und „Entmythologisierung“ der antiken Welt und ihrer Werte. Schon in früheren Werken hatte Augustin den Glanz und die Einzigartigkeit der römischen Kultur nachdrücklich relativiert und entschieden bestritten, dass es sich dabei um unüberbietbare Werte und Normen handelte. Die gleiche Einstellung wiederholt er hier in schneidender Form, wenn er das römische Kaiserreich nicht nur als eine menschliche Institution neben anderen bezeichnete, sondern es darüber hinaus mit einer Gruppe erfolgreicher Verbrecher verglich: „Was sind denn Reiche, wenn es ihnen an Gerechtigkeit fehlt, anderes als große Räuberbanden?“ (De civ. Dei, 4, 5f.)
Die lateinische Christenheit des Mittelalters hat sich mit diesem Werk Augustins unentwegt auseinander gesetzt und es dabei selbstverständlich in die eigene Wirklichkeit hinein übersetzt. Karl der Große (742–814) z.B. hat sich den „Gottesstaat“ vorlesen lassen. Im Laufe der Zeit wurden dann nicht selten die beiden Herrschaftsbereiche auf die geistliche und die weltliche Gewalt aufgeteilt. Aber darin erschöpften sich die Wirkungen dieses Werkes keineswegs. Von der besonderen Stellung, die das Papsttum im Westen gewann, war bereits die Rede. Selbstverständlich benutzten die Bischöfe von Rom Augustins „Gottesstaat“, um ihre geistliche und politische Position zu stärken. Gleichzeitig ist daran zu erinnern, dass das westliche Christentum bis zum hohen Mittelalter im wesentlichen in der klösterlichen Form existierte. Als kennzeichnend für dieses europäische Mönchtum kann die Formel „ora et labora“ gelten, die spätere Zusammenfassung der Regel Benedikts von Nursia.4 Kennzeichnend für das abendländische Mönchtum ist also die andauernde Spannung zwischen Weltzugewandheit und Weltabkehr, zwischen Weltverantwortung und Weltflucht. Im ständigen Oszillieren zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Geschichte des abendländischen Mönchtums. Papst Gregor der Große, der sich in besonderem Maß als Schüler Augustins begriff, hat dieses Phänomen seinen Mönchen einmal folgendermaßen dargelegt: „Mit seinem Kommen hat unser Erlöser zweierlei ausgeteilt und beides in sich verbunden. Denn ebenso wie er in der Stadt Wunder tat, verbrachte er die Nacht in unaufhörlichem Gebet auf dem Berg. So gab er seinen Gläubigen ein Beispiel, dass sie weder durch eifrige Kontemplation die Fürsorge für den Nächsten vernachlässigen sollten noch umgekehrt aufgrund allzu großer Verpflichtungen für die Sorge um den Nächsten den Eifer für die Kontemplation zurückstellen. Darum geht es vielmehr, beides zu unterscheiden und gleichzeitig miteinander zu verbinden: so, dass die Liebe zu Gott nicht die Liebe zum Nächsten behindert, aber auch nicht die Liebe zum Nächsten die darüber hinausweisende Liebe zu Gott beiseite rückt.“ (Moralia in Job, XXVIII, 13, 33)
Dieser Gedanke lässt sich nach den verschiedensten Seiten ausziehen, z. B. im Blick auf die Familie, jene soziale Basis der vorindustriellen Gesellschaft schlechthin. Dauerhaft blieb in dieser klösterlichen Form des westlichen Christentums die Sehnsucht, aus den Einbindungen in die Familie, die Sippe zu fliehen – wie es etwa die iroschottischen Mönche taten, wenn sie in unbekannte Gegenden auf dem Kontinent zogen. Aber als ebenso dauerhaft erwies sich der Wille, aus dem Kloster heraus Familie und Sippe mitzugestalten – wie es z.B. für viele deutsche Mönche in der ottonischen Zeit eine Selbstverständlichkeit war: „Adel, Kirche und Königsdienst bildeten die Lebensbereiche dieser Geistlichen. In ihnen gingen sie voll und ganz auf. So, dass es scheinen möchte, als seien diese Lebensbereiche nur ein einziger gewesen.“5
Das ist der Hintergrund, auf dem die religiösen und kirchlichen Reformen des 11. und 12. Jahrhunderts, diese epochalen Umwälzungen in der lateinischen Christenheit, Anschaulichkeit und Profil gewinnen. Hieraus erwuchs der Investiturstreit, also die erbitterte Auseinandersetzung über die Grenzen der weltlichen Gewalt gegenüber der Kirche und insofern dann auch in der Gesellschaft.6 Die Einzelheiten dieses Kampfes, der rund ein halbes Jahrhundert andauerte, bis er 1122 mit dem Kompromiss des Wormser Konkordats offiziell beigelegt wurde, müssen uns hier nicht beschäftigen. Für unseren Zusammenhang ist die Feststellung wichtig, dass es Papst Gregor VII. und der Kurie bei diesem Ringen um die „libertas ecclesiae“ ging, also um die Freiheit und Eigenständigkeit einer gereinigten und geeinten Kirche gegenüber der weltlichen Macht, angefangen beim Kaiser und den Königen bis hinunter zum niederen Adel. Innerkirchlich lässt sich diese Umwälzung als der Versuch begreifen, das Leben nach den Mönchsgelübden auch auf den Weltklerus zu übertragen: Die Bischöfe schuldeten dem Papst nun unbedingten Gehorsam. Ihre Armut würde darin bestehen, dass sie, ebenso wie die Äbte und Prälaten, ihre Ämter weder kaufen noch verkaufen durften. Allein der Papst besaß fortan das Recht, sie ihnen zu verleihen. Alles andere war die Todsünde der Simonie. Und bei der geforderten Keuschheit ging es um die Durchsetzung des Zölibats im gesamten Klerus.
Noch gravierender waren die politischen Konsequenzen dieser gregorianischen Reform. Denn wenn allein dem Papst das Recht zukam, Anordnungen und Entscheidungen in der Kirche zu treffen, wenn „Freiheit der Kirche“ hieß, dass keine weltliche Person oder Institution in ihr zu bestimmen hatte, sondern lediglich Geistliche über Geistliches urteilen durften: Dann konnten fortan Bischöfe, Äbte, auch Priester keine Lehen mehr von Königen, Fürsten oder einfachen Grundherren erhalten – was, keineswegs nur im Deutschen Reich, das Sozialgefüge jener Zeit zutiefst erschüttern musste. Doch die gregorianische Reform zielte auf noch Grundsätzlicheres. Weil die Kirche das ewige Heil vermittelte, die weltliche dagegen nur irdisches Wohlergehen, stand prinzipiell der einfachste Kleriker über dem höchsten weltlichen Würdenträger. So schrieb Gregor VII. 1081 an Bischof Hermann von Metz: „Außerdem erbittet jeder christliche König am Ende, wenn er dem Gefängnis der Hölle entgehen, aus der Finsternis ins Licht gelangen und vor Gottes Gericht ohne die Fessel der Sünde erscheinen will, mit Jammern und Flehen den Beistand des Priesters. Welcher Priester oder auch nur Laie dagegen hätte je in der äußersten Not für das Heil seiner Seele um die Hilfe eines irdischen Königs gebeten?“7 Schärfer ließ sich die Desakralisierung des Königtums nicht formulieren. Die weltliche Gewalt besaß und behielt durchaus ihren Rang und ihre Würde. Doch diese waren nun klar eingegrenzt auf den diesseitigen, irdischen Bereich und besaßen prinzipiell keinerlei religiöse oder sakrale Weihe mehr.
Mit dieser Unterscheidung zwischen dem geistlichen und dem weltlichen Bereich war für die Vorkämpfer der gregorianischen Reform die politische Überordnung des Ersteren über den Zweiten gegeben, also des Priestertums der Kirche (sacerdotium) über die Herrschergewalt des Reiches (imperium). „Der Papst kann Kaiser absetzen“, hieß es im Dictatus papae aus dem Jahr 1075.8 Diese Rangfolge wurde von den Vertretern der weltlichen Gewalt in aller Regel weder grundsätzlich noch faktisch akzeptiert. Daraus ergab sich in den folgenden Jahrhunderten innerhalb der westlichen Christenheit ein andauerndes Ringen zwischen den beiden Gewalten um die Oberhoheit. Das bedeutet aber: In Westeuropa konnte sich zu keiner Zeit die Herrschaftsform der Theokratie durchsetzen; aber ebenso wenig diejenige des Cäsaropapismus, wo also die weltliche Gewalt auch die Herrschaft über den geistlichen Bereich ausübt. Sicherlich ließ sich vieles, was die ehrgeizigen Vertreter der geistlichen Reformen im 11. und 12. Jahrhundert erstrebten, nicht verwirklichen. Immer wieder mochte es im Verlauf der Geschichte auch so aussehen, als hätten jene erbitterten Kämpfe keine Auswirkungen gehabt. Doch sobald man einige Schritte zurücktritt und die Vorgänge in einem größeren, Europa übergreifenden Zusammenhang betrachtet, erkennt man, dass die hier gewonnene Unterscheidung zwischen dem geistlichen und weltlichen Bereich, modern formuliert: zwischen Kirche und Staat, nie wieder völlig in Vergessenheit geraten ist. Sie blieb ein Strukturelement und zugleich eine Triebfeder der abendländischen Geschichte. Der Unterschied zur Entwicklung in der östlichen Christenheit, aber auch zu derjenigen in anderen Kontinenten und Kulturkreisen, liegt auf der Hand. Die in der lateinischen Christenheit prinzipiell angelegte und dann entfaltete Freisetzung der Weltlichkeit, die grundsätzliche Ermöglichung einer eigenständigen Behandlung und Gestaltung der Diesseitigkeit – die von der Dimension des Religiösen keineswegs abgetrennt ist, aber von ihr eben auch nicht dominiert wird – stellt somit eine ganz wesentlich durch das Christentum initiierte und gestaltete Grundgegebenheit Westeuropas dar.
Die zweite, mindestens ebenso sehr durch Augustin beeinflusste Besonderheit der geistigen, sozialen und politischen Entwicklung dieses Teils des Kontinents betrifft das Verständnis der Person, des Individuums. In den „Confessiones“ geht es um die Gnade Gottes, die Augustins Leben umfing und trug und die er nicht nur im Gesamtverlauf seiner Biographie, sondern bis in zahlreiche Einzelheiten hinein dankbar aufwies.9 Das Buch fasziniert, weil es das Wagnis der Selbstfindung durch die Analyse der Motive des Handelns dokumentiert. Fortschritt bedeutet nun die zunehmende Selbsterkenntnis auf dem Weg der Selbstprüfung. Das war ebenso modern wie die dabei vorausgesetzte Einsicht, dass jeder Mensch in seiner Vergangenheit verankert ist. Von dieser Erfahrung her war es dann nur noch ein kleiner Schritt bis zu der Überzeugung, dass wachsende Selbstbestimmung und völlige Abhängigkeit vom Grund alles Seins, also von Gott, untrennbar zusammengehörten. Den freien Willen gibt es nicht. Das ist eine Chimäre, betont Augustin gegenüber Pelagius. Aber es gibt den an und in Gott gebundenen befreiten Willen, den der Bischof von Hippo Regius nicht genug preisen konnte. Das Wissen um die Prädestination gibt dem Leben und Kämpfen Augustins die letzte, absolute Gewissheit. Denn darin und nicht im menschlichen Streben oder Handeln gründete allein, was wahrhaft sicher und fest bleibt.
Bei dieser Konzentration auf die Persönlichkeit des Menschen und die Problematik seines Willens handelte es sich um eine wesentliche Veränderung der klassischen philosophischen Tradition. Mit dieser „Entdeckung des Selbst“ ereignete sich insofern „ein denkwürdiger Schritt in der Geschichte des menschlichen Denkens, ein Schritt, der ganz entscheidend war für die Geburt der Idee des Individuums in der abendländischen Kultur“.10
Sicherlich kann man bis ins hohe Mittelalter hinein höchstens von Ansätzen der Herausbildung des Verständnisses der individuellen Persönlichkeit reden und gewiss nicht vom modernen Individualismus. Mindestens ebenso vielfältig wie die Entwicklung war, die zur gregorianischen Reform mit ihren grundstürzenden Folgen führte, begegnen auch hier sehr unterschiedliche Voraussetzungen und gestaltende Kräfte – wobei erneut die sozialen und politischen Faktoren neben den allgemein geistigen und spezifisch religiös-theologischen in Rechnung zu stellen sind.
Zu den Vorbedingungen der westeuropäischen Entwicklung gehört wahrscheinlich auch eine besondere Struktur der Familie. Zumindest in Teilen Westeuropas existierte im Unterschied zur sonst weit verbreiteten Großfamilie die Kernfamilie, wo also zumindest einige Kinder bald einen neuen Hausstand bildeten.11 Gefördert wurde dadurch, was ich als eigen-rationale Vorgehensweise bezeichnen möchte. Ähnliches lässt sich beim westeuropäischen Feudalismus beobachten.12 Zwischen dem Grundherrn und seinen Lehnleuten bestand ein Netz gegenseitiger Verpflichtungen mitsamt daraus erwachsenden Rechten. Wieder wird man darin nicht mehr sehen wollen als Voraussetzungen für einen Handlungsspielraum im sozialen und wirtschaftlichen Bereich. Aber doch auch nicht weniger.
Seit dem 11. Jahrhundert wuchs in Westeuropa das Drängen breiterer Schichten der Bevölkerung nach Freiheit – was im mittelalterlichen Kontext bedeutete: nach mehr Freiheiten im Sinn von Privilegien.13 Der Aufstieg Einzelner mit ihren Familien aus der Bauernschaft bis in den Adel lässt sich exakt belegen. Freiheiten wurden den Grundherren – wozu selbstverständlich auch die Vertreter der Kirche gehörten – abgetrotzt. So erklärte z. B. der Abt von Ferrières-en-Gâtinais 1185, er befreie „für immer und von jeder Dienstbarkeit alle Leibeigenen, Männer wie Frauen, die jetzt in der Pfarrei St. Eligius und in der Bannmeile von Ferrières leben. […] Sie haben Freiheit, überall hinzugehen, wohin und wann es ihnen gefällt, und über ihren Besitz zu verfügen wie Freie.“14 Freiheit gewann der Bauer, wenn er in Rodungs-und Kolonisationsgebieten siedelte. Die Freiheit des Bürgers gehörte zu den Wesensmerkmalen der aufstrebenden Städte. Und an den aufblühenden Universitäten begegnen wir dem „freien“ Studenten, der also nicht mehr dem Klerikerstand angehören musste. Das alles war, wie gesagt, kein Individualismus im modernen Sinn. Doch es handelte sich dabei um Elemente, welche die Entwicklung in jene Richtung vorantrieben. Eine wesentliche Rolle spielte bei alledem nicht zuletzt der Schöpfungsgedanke und insbesondere die Vorstellung von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen.
Aus dem Beharren auf der Gleichheit aller Menschen vor Gott resultierte freilich keineswegs auch die Gleichheit im irdischen Leben. Doch das Wissen um die Gleichwertigkeit jedes Einzelnen vor Gott verhinderte die Verabsolutierung der stabilen gesellschaftlichen Ordnung in oben und unten, arm und reich, machte sie vielmehr durchsichtig, transparent für die andere, die letztlich gültige Wirklichkeit. Einen Abglanz davon bot die Kirche, genauer gesagt: das Kloster. Denn hier blieben die sozialen Schranken nicht nur prinzipiell durchlässig. Zugespitzt lässt sich ein lang andauernder und komplizierter Prozess so zusammenfassen: Allen Einschränkungen zum Trotz gab es die rechtliche Sicherung des individuellen Eigentums. Und ebenso existierte, ungeachtet erheblicher Begrenzungen, die Möglichkeit der persönlichen Beziehung des Einzelnen zu Gott.
Ein solches Verständnis der Persönlichkeit, wie es sich hier in Westeuropa entwickelte, war singulär. Es gibt dazu keine Analogie in anderen Kulturen.15 Hier, im Westen, wurde diese Exklusivität zudem seit dem Übergang vom hohen zum späten Mittelalter intensiv vorangetrieben. Erinnert sei nur daran, dass im späten 13. Jahrhundert Johannes Duns Scotus (1265/66–1308) und vollends Wilhelm von Ockham (ca.1288–ca. 1349) mit allem Nachdruck unterstrichen, dass „alles, was ist, von seinem Ursprung her individuell und nach Dasein und Sosein kontingent ist“.16 Im Nominalismus der Spätscholastik kommt mithin besonders pointiert zum Ausdruck, was das gesamte Denken dieser philosophischen Theologie bewegte: Gott hat den Menschen geschaffen, damit er sich als Geschöpf in Freiheit auf sein Ziel, nämlich das ewige Leben, hin verwirklicht. Ein solcher Ausgangspunkt umschloss freilich, dass es vielerlei menschliche Voraussetzungen und Daseinsweisen gab, um zu diesem Ziel zu gelangen. Und das wiederum bedeutete: „Das Individuum ist die eigentlich primäre Wirklichkeit, das Allgemeine ist sekundär, Begriff und Abstraktion.“17
Niemals, und schon gar nicht im Mittelalter, existierten Theologie und Philosophie losgelöst von Leben der übrigen Gesellschaft. Was sie grundsätzlich reflektierten, spiegelt mithin die Erfahrungen breiter, sensibler Kreise der europäischen Oberschicht. Diesen Zusammenhang belegt in eindrücklicher Weise ein Zeitgenosse jener scholastischen Theologen, nämlich der Florentiner Maler Giotto di Bondone (ca. 1267–1337). Mit ihm beginnt unbestritten eine neue Epoche der abendländischen Malerei. Will man die Bedeutung der durch ihn herbeigeführten Wende ermessen, ist es hilfreich, sich daran zu erinnern, dass es bei der bis dahin dominierenden byzantinischen malerischen Konzeption um eine Art religiöser Bilderschrift ging. Auch um wiedererkannt und insofern verstanden zu werden, mussten die Inhalte dieser Bilder möglichst unverändert bleiben. Die Gestaltung des Raums war demgegenüber von untergeordneter Bedeutung, weshalb Personen und Vorgänge nach dem Maß ihrer Bedeutung additiv nebeneinander gestellt wurden. Die Bedeutung des Abgebildeten sollten sich die Betrachter nachdenkend und meditierend aneignen. Giottos Leistung bestand nun darin, dass er die in jener Bilderschrift bezeichneten Personen und Vorgänge aus der biblischen und kirchlichen Tradition in die eigene Gegenwart und Umwelt hineinversetzte. „Statt die Mittel der Bilderschrift zu verwenden, wurde nun die Illusion geschaffen, die heilige Geschichte spiele sich direkt vor unseren Augen ab.“18 Dadurch wurden in der Tat die Konzeption und Zielsetzung der Malerei grundlegend verändert. Für unseren Zusammenhang ist nun die Feststellung wichtig, dass Giotto sich bei dieser Vorgehensweise im Einklang mit den Predigten und Erbauungstexten der Bettelorden befand. Diese drängten nämlich darauf, dass sich der Einzelne so in die heiligen Geschichten hineinempfinden sollte, als wären sie heute in seiner Stadt und seiner unmittelbaren Umgebung geschehen.19 Von dieser Konzentration auf das Individuum bis zur Entdeckung der Zentralperspektive, wo nun tatsächlich die Welt in der Fluchtlinie des individuellen Betrachters gesehen wird, war es dann nur noch ein kleiner Schritt. Dieser wurde bekanntlich ebenfalls in Florenz getan.20
Eine solche Konzeption von Malerei und Kunst war, ebenso wie das darin zum Ausdruck kommende Verständnis des Menschen als einer individuellen Persönlichkeit, in der gesamten damaligen Welt einzigartig und beispiellos. Selbstverständlich hat nicht allein das Christentum diese auffällige Eigenart Westeuropas bewirkt. Aber sie entwickelte sich eben auch nicht ohne dieses. Und ebenso wenig ist es Zufall, dass zwei für Augustin zentrale Themen, nämlich seine Gnadenlehre und sein Kirchenbegriff, es sind, bei denen er „sich wohl am stärksten der Zukunft zugewandt hat: zur Kirche des Mittelalters, zur Krise von Gnade und Freiheit in der Reformation und zu den laizistischen Nachspielen dieser Krise in der neueren Zeit“.21
Nicht zuletzt aus dem christlichen Denken sind also der vom Sakralen unterschiedene Raum der Diesseitigkeit wie auch die herausgehobene Bedeutung der Person als zwei hervorstechende Charakteristika Westeuropas erwachsen. Daneben ist ein drittes gewichtiges Element zu nennen, das nicht zufällig ebenfalls bei Augustin begegnet. Gemeint ist das Wollen, die Glaubensaussagen denkend zu erfassen. Anders ausgedrückt: Es geht um das Bemühen, Positionen und Realitäten, die der christlichen Wahrheit zu widersprechen scheinen, nicht einfach auszugrenzen, sondern sie nach Möglichkeit denkend zu integrieren. Insofern gehört zu diesem Christentum von Anfang an die Apologetik, verstanden als das Streben, nicht nur den Außenstehenden, sondern gerade auch den denkenden Christen die Sinnhaftigkeit und überlegene Vernünftigkeit der göttlichen Offenbarung darzulegen. Von Augustin wissen wir, dass er in seinen Predigten auf die Fragen seiner Umwelt einzugehen pflegte. Auch hier und keineswegs nur in den großen Hauptwerken – also den „Bekenntnissen“, dem „Gottesstaat“ oder in dem an tiefgründigen Spekulationen reichen Buch „Über die Trinität“ – stellte Augustin sich der intellektuellen Neugier seiner Zeitgenossen. Das war freilich nur möglich, weil er selbst im Bewusstsein der elementaren Zusammengehörigkeit von Glauben und Wissen lebte, sich immer wieder faszinieren ließ von neuen, weiterführenden geistigen Einsichten und Erkenntnissen. Glaube und Vernunft stellten keinen Gegensatz dar, sondern der Glaube förderte und forderte das Verstehen. „Denn ich bin nun einmal ein Mensch“, schrieb Augustin kurz nach seiner Bekehrung, „der in seinem Verlangen ungeduldig ist, das Wahre nicht nur zu glauben, sondern zum Verstehen zu gelangen.“ (Contra Academicos, III, 20, 43)
Es ist wahr, diese fortgesetzte Suche nach der Wahrheit besaß für Augustin ihren Anker in der Kirche, genauer: in der Offenbarung Gottes, die ihr anvertraut war. Dabei handelte es sich jedoch keineswegs nur um einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit, gerade nicht um irgendeine Reduktion, sondern um die umfassende Fülle alles Seins, das nie völlig zu erfassende Ganze. Wenn Augustin also eine falsche Neugier tadelte, ging es ihm keineswegs um die Diskreditierung des theoretischen Wissensdranges, sondern um die Zurückweisung einer Einstellung, die anstelle von Erkenntnis auf Zerstreuung zielte.
Auch diese augustinische Verbindung des Glaubens mit der Vernunft hat in den folgenden Jahrhunderten in einem enormen Ausmaß weitergewirkt. Dabei verlagerte sich allerdings das Gewicht zunehmend auf die Bedeutsamkeit der Vernunft. Dass diese fähig sei, sowohl den Glaubensakt als auch insbesondere die Glaubensinhalte zu erhellen (fides quaerens intellecum), setzte sich seit dem Wirken Anselms von Canterbury (1033–1109) zunehmend durch. „Nachlässigkeit scheint es mir zu sein, wenn wir, nachdem wir im Glauben gefestigt sind, uns nicht zu verstehen bemühen, was wir glauben“, schrieb er in „Warum Gott Mensch geworden“. (Cur deus homo, I, 1) Sein etwas älterer Zeitgenosse Berengar von Tours formulierte, ebenfalls mit dem ausdrücklichen Hinweis auf Augustin: „Es ist das Zeichen eines großen Herzens, bei allen Dingen auf die Dialektik zurückzugreifen; denn auf sie zurückzugreifen heißt, auf die Vernunft zurückzugreifen; wer daher, obwohl doch gemäß der Vernunft zum Ebenbild Gottes geschaffen, nicht auf sie zurückgreift, der missachtet seine Würde und vermag nicht, sich von Tag zu Tag zum Ebenbild Gottes zu erneuern.“22
Die Aussagen belegen, wie selbstverständlich der emotionale Aspekt zu diesem Verständnis des Rationalen hinzugehörte. Nichtsdestoweniger überwog dann die intellektuelle Zielsetzung. Bei der Dialektik handelte es sich um die Methode, mittels der Logik scheinbare Widersprüche innerhalb der Tradition aufzuheben. Angesichts der Autorität der vorgegebenen Texte konnten keine wirklichen Gegensätze existieren. Deshalb ging es darum, den intendierten Sachverhalt aus den verschiedenen Aussagen abstrahierend zu erheben und von da aus die Differenzen als unterschiedliche Aspekte dieses Einen zu entfalten. Peter Abälards (1079–1142) „Ja und Nein“ (Sic et Non) bildete für diese Vorgehensweise die umstrittene, bewunderte, aber letztlich doch allgemein akzeptierte Anleitung. Die Logik schuf also Ordnung durch Abstraktion und Systematisierung. Sie war der Prüfstein der Wahrheit, entband jedoch auch neue theoretische Problemstellungen und forderte schließlich die Formulierung eigener Lösungen. Das geschah dann im Lehrvortrag, der als wesentliches Element zu dieser Dialektik gehörte.
Mit diesen knappen Anmerkungen ist das Wesen der Scholastik umrissen. Der Begriff bezeichnet zunächst den schulischen Umgang mit Texten, sodann die unterschiedlichen Schultraditionen, schließlich den formal-methodischen Zugriff im skizzierten Sinn überhaupt. Scholastik bedeutet daher Wissenschaftlichkeit, gerade im Blick auf die Theologie. Die Theologie partizipierte nicht nur am allgemeinen Wissenschaftsverständnis, sondern sie trug es. Mit Hilfe der Logik reduzierte der Mensch die Komplexität und schuf insofern Ordnung in einer chaotischen Welt. Und gleichzeitig wurde dabei die höhere Ordnung hinter sämtlichen Phänomenen erkennbar.
Die Entwicklung dieser wissenschaftlichen Konzeption war ebenso ein spezifisch westlicher Vorgang wie die Herausbildung des Ortes, an dem sie gepflegt und entfaltet wurde, nämlich die Universität. Sie entwickelte sich aus den Kloster- und Kathedralschulen und erlebte im 13. Jahrhundert einen steilen Aufstieg. Hier konzentrierte sich das wissenschaftliche Lernen, Lehren und Forschen. Studierende und Dozierende zusammen bildeten diese Universitas. Dabei handelte es sich um eine regelrechte Zunft, mit speziellen Privilegien und Verpflichtungen, Ordnungen ebenso wie Graden. Vor allem jedoch bildete die Universität die Stätte eines prinzipiell unabhängigen Erkenntnisstrebens. Das geschah in vier Fakultäten. Während die untere, die artistische, die wissenschaftlichen Grundlagen vermittelte, widmeten sich die drei oberen – in dieser aufsteigenden Rangfolge – den Spezialgebieten der Medizin, Jurisprudenz und Theologie. Die medizinische Fakultät der Universität Salerno galt europaweit als führend, dasselbe Ansehen genoss Bologna bei den Juristen und vollends Paris bei den Theologen. Zu den zahlreichen Würdigungen dieser theologischen Fakultät gehörte ihre Charakterisierung als „der Backofen, wo das geistige Brot der lateinischen Welt gebacken wird“.23 Ein hochqualifizierter Lehrkörper sowie eine internationale Studentenschaft förderten den Wissensdrang ebenso wie den schöpferischen Einfallsreichtum. Selbstverständlich studierte lediglich eine schmale Elite an diesen Universitäten, erst recht in den oberen Fakultäten. Aber diese Menschen bildeten die in der gesamten lateinischen Christenheit grundsätzlich einheitlich geprägte Intelligenz.
Für unseren Zusammenhang ist die Feststellung wichtig, dass es sich bei dieser scholastischen Wissenschaft eben nicht um etwas Statisches handelte, sondern um einen dynamischen Prozess. Die geforderte geistige Leistung der Determination, des theoretischen Zugriffs mit samt dem eigenen Urteilen eröffnete permanent neue Zusammenhänge. So konnte Johannes von Salisbury (ca. 1120–1180) um die Mitte des 12. Jahrhunderts schreiben: „Alle Methode ist Anreiz zum Finden. Die Wissenschaft gelangt nicht zur Frucht bei dem, der keinen Geschmack am Forschen hat.“ Und Gilbert von Tournai sekundierte ihm rund hundert Jahre später: „Niemals werden wir die Wahrheit finden, wenn wir uns mit dem zufrieden geben, was bereits gefunden ist. Die vor uns schrieben, sind für uns nicht Herren, sondern Führer.“24
Zum weiteren Fragen und Forschen gehörte nicht zuletzt das andauernde Mühen, Widersprechendes, Widerständiges und Fremdes in das eigene wissenschaftliche Denken zu integrieren. Das klassische Beispiel dafür bildete die intellektuelle Einbindung des „nackten“ Aristoteles durch die Theologen des hohen Mittelalters. Die Konfrontation mit dieser ursprünglichen, nicht christlich übermalten heidnischen Philosophie, die rein diesseitig war, von keiner Schöpfung und keinem Gottesbezug des Menschen wusste, bewirkte zunächst einmal einen mächtigen Schock. Auch an schroffen kirchlichen und religiöstheologischen Verwerfungen fehlte es nicht. Doch der Wille zur logischen Durchdringung und die Fähigkeit zur intellektuellen Integration setzten sich durch.
Es geht jetzt nicht um eine Entfaltung jenes enormen und gleichzeitig umfassenden Wissensdurstes, der für diese Scholastik insgesamt charakteristisch ist. Hier sei nur daran erinnert, dass in derselben Zeit, in der z. B. Alexander von Hales (gest. 1245), Albertus Magnus (ca. 1193–1280) oder Thomas von Aquin (1225–1274) ihre großen theologischen Summen schrieben, auch die gewaltigen gotischen Kathedralen von Chartres, Reims, Amiens oder Straßburg errichtet wurden. Sicherlich traten dann an die Stelle der brillanten Synthesen kritische Zergliederungen, überwogen Skepsis, Eklektizismus und schließlich pure Willkür – jene Phänomene also, die man heute in der Regel mit der Scholastik zu verbinden pflegt. Doch selbst da sind Forschergeist und Wissensdrang oder zumindest intellektuelle Neugier unverkennbar.
Was das bedeutet, kann ein Blick auf die Gegebenheiten in der östlichen Christenheit verdeutlichen. Hier galt die kirchliche Lehrentwicklung mit dem 7. ökumenischen Konzil im Jahre 787 als prinzipiell abgeschlossen. Die Aufgabe der Theologie bestand nun darin, dieses Erbe zu reflektieren und zu interpretieren. Im Abendland dagegen folgte die kirchliche Leitung insofern der Theologie, als sie aufgrund gewandelter Voraussetzungen sowie neuer Herausforderungen und Erkenntnisse auch neue, weiterführende Lehrentscheidungen fällte. Das bekannteste Beispiel dafür ist das 4. Laterankonzil (1215), das u.a. die Transsubstantiationslehre zum Dogma erhob, also die Auffassung, dass in der Messe die Materie von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelt werden.
Einen weiteren, nur scheinbar abseitigen Beleg für die Zuwendung europäischer Menschen zu Anderem, das außerhalb des Bekannten und vertrauten Kulturkreises liegt, bildet das Faktum, dass sie, insbesondere seit dem späten Mittelalter, in den Osten reisten.25 Das Umgekehrte fand eigentlich nicht statt. Angehörige des Ostreiches reisten nicht. Denn Byzanz „verstand sich als kulturelle Mitte, die Besucher anzog, aber schon lange nicht mehr die Notwendigkeit empfand, von sich aus Kontakt zu den umwohnenden Völkern zu suchen“. Dasselbe gilt für den Islam. Sich in andere Kulturräume zu begeben, „widersprach jeder kulturellen Vernunft“. Nur sehr wenige Ausnahmen von dieser Regel sind bezeugt. Und noch grundsätzlicher ruhte China in sich, genügte sich selbst als Zentrum, eben als das „Reich der Mitte“.