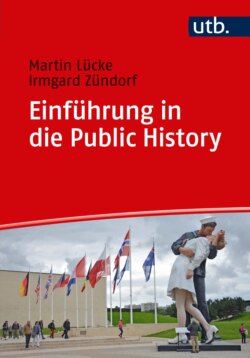Читать книгу Einführung in die Public History - Martin Lücke - Страница 7
Оглавление1.Was ist Public History? Geschichte und Konzeptionen
In diesem Kapitel wird Public History als Idee und Disziplin vorgestellt. Dazu wird zunächst ihre historische Entwicklung nachgezeichnet, bevor einige mit ihr verbundene Konzepte der Geschichtsschreibung erläutert werden. In einem ersten Schritt soll der historische Werdegang der Public History als Bewegung und Institution, aus den USA kommend und inzwischen auch in Australien und in Europa weit verbreitet, nachgezeichnet werden. Danach werden verschiedene Definitionen von Public History vorgestellt, um anschließend eine eigene Begriffsbestimmung vorzuschlagen. Dabei soll deutlich werden, dass Public History große Schnittmengen mit der Geschichts- bzw. Erinnerungskultur hat. Diese Begriffe sowie weitere in diesem Buch immer wieder auftretende wie Geschichtspraxis und Geschichtsbewusstsein werden Kapitel 1.3 erläutert. Zum Schluss dieses Kapitels wird der Standort der Public History zwischen Wissenschaft und Publikumsansprüchen erörtert.
1.1Geschichte und Institutionalisierung der Public History
Public History hat es schon lange gegeben, bevor der Begriff geprägt wurde. Die Bezeichnung stammt aus den USA, wo sich Public History zunächst als Bewegung außerhalb der Universitäten entwickelte. Aufbauend auf den Ansätzen und Zielen der New Social History der 1960er Jahre sollte eine Geschichte „von unten“ betrieben werden. Dies bedeutete einen Perspektivwechsel weg von der bis dahin betriebenen Politik- und Ereignisgeschichte hin zu einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Auch das Interesse an Kultur- und Alltagsgeschichte und einer damit verbundenen Regionalgeschichte wuchs. Mit dieser Entwicklung wurden sowohl die Themen als auch die Quellen und Methoden der historischen Forschung ausgeweitet. Zu den neuen Quellen zählten sowohl sogenannte Ego-Dokumente, wie private Briefe und Tagebücher, als auch mündliche Zeitzeug*innenaussagen. Letztere wurden mit der in den 1980er Jahren neu entwickelten Methode der Oral History (Kapitel 3.4) erhoben und analysiert.
Seit den 1970er Jahren stieg das öffentliche Interesse an Geschichtsdarstellungen. Immer mehr Menschen besuchten historische Ausstellungen, schauten Geschichtsfilme (Spielfilme aber auch Dokumentationen), lasen entsprechende Bücher (sowohl wissenschaftliche Abhandlungen als auch populärwissenschaftliche Darstellungen und Historienromane) oder kauften Geschichtsmagazine. Die steigende Nachfrage wiederum hatte zur Folge, dass immer mehr Angebote geschaffen wurden. Diese Entwicklung wird auch als „Geschichtsboom“ bezeichnet, der bis heute anhält.
Zudem erfolgte in den 1970er Jahren in den USA der Ausbau des Hochschulsystems. Dadurch stieg die Zahl der Absolvent*innen historischer Studiengänge, die im universitären oder schulischen Bereich keine Anstellung fanden. Auf andere Berufsfelder waren die Studienprogramme jedoch bis dahin nicht ausgerichtet.
Die Public History-Bewegung kritisierte die universitäre Geschichtswissenschaft, nicht auf das wachsende öffentliche Interesse an Geschichte einzugehen. Sie warf der Fachwissenschaft vor, den Kontakt zur Öffentlichkeit verloren zu haben, nicht mehr für diese zu forschen und zu schreiben, sondern nur noch für die eigenen Kreise zu publizieren. Dagegen wurde gefordert, dass die etablierten Historiker*innen sich mit ihren Fähigkeiten an der Entwicklung populärer Geschichtsdarstellungen beteiligen. Zudem sollte die universitäre Lehre an die veränderten Arbeitsbedingungen der Historiker*innen angepasst werden.
In der Folge wurden Ende der 1970er Jahre schließlich neue Studiengänge entwickelt, die auf diese Defizite reagierten und die Studierenden auf Tätigkeitsfelder im Bereich der Geschichtsvermittlung außerhalb von Schule und Universität vorbereiten sollten.
1.1.1Public History in den USA und international
Der erste Public History-Studiengang startete 1976 an der University of California, Santa Barbara unter der Leitung des dortigen Geschichtsprofessors Robert Kelly.1 Weitere Studiengänge, die sich verstärkt mit Vermittlungsfragen von Geschichte in der Öffentlichkeit auseinandersetzten und ganz konkret auf bestimmte Berufe vorbereiteten, folgten. Die Hochzeit dieser Public History-Studiengänge waren die 1980er Jahre, aber auch heute gibt es laut Angabe des Public History Resource Centers in den USA noch an 135 Universitäten entsprechende Angebote.2
Die Public History-Studiengänge in den USA bieten sowohl klassische geschichtswissenschaftliche Seminare an als auch solche, die sich mit Fragen der Entwicklung, Theorie und Methode der Medien- und Kulturwissenschaften auseinandersetzen. Darüber hinaus gibt es Wahlbereiche zu verschiedenen Praxisfeldern der Public History, die erste Einblicke in die konkrete berufliche Tätigkeit ermöglichen. Diese sind wiederum im Praktikum und auch in der eigenen Abschlussarbeit zu vertiefen. Die Studierenden sollen durch konkrete Beispiele und Gruppenarbeit auf die unterschiedlichen Formen der Präsentation von Geschichte in den verschiedenen Medien vorbereitet werden.
Einen Überblick über Definitionen, Studien- und Jobangebote in den USA sowie verschiedene Rezensionen und Rezensionsportale bietet das Public History Resource Center. Es definiert sich selbst als Forum, das die Arbeit von Public Historians unterstützt, fördert und verbreitet. Die dortigen Informationen beziehen sich überwiegend auf die USA, gehen aber teilweise darüber hinaus und schließen den gesamten angelsächsischen Sprachraum mit ein. Leider wird die Website in manchen Sparten seit Längerem nicht mehr überarbeitet.
Neben den Studiengängen zeichnete sich vor allem mit dem 1980 in Pittsburgh als Interessenvertretung gegründeten National Council on Public History (NCPH)3 eine Institutionalisierung der Public History ab. Ziel war es, die verschiedenen Akteur*innen auf dem Feld zu vernetzen und Public History als Disziplin zu professionalisieren, um ihr Ansehen zu fördern. Dafür wurden und werden Konferenzen durchgeführt, Texte über theoretische Grundlagen sowie Praxisfelder publiziert und Hinweise für die universitäre Lehre erstellt. Das NCPH betont einerseits die Eigenständigkeit der Public History und andererseits die Nähe zur Geschichtswissenschaft, deren Methoden nach wie vor als unverzichtbar gelten.
Seit 1978 erscheint vierteljährlich die Zeitschrift The Public Historian4. Sie ist inzwischen das wissenschaftliche Organ des NCPH und dient auch über die USA hinaus als wichtiges Publikationsorgan für die Public History. Zudem veröffentlicht der NCPH seit 1986 vierteljährlich den Newsletter Public History News. Der NCPH betreut ebenfalls die Mailingliste H-Public, die 1994 eingerichtet wurde, sowie seit 2012 den Blog Public History Commons. Dort werden aktuelle Informationen und Diskussionen zum Thema publiziert sowie die Beiträge aus der H-Public-Liste, dem NCPH-Newsletter und Online-Artikel aus The Public Historian zweitveröffentlicht. Im zeitgleich eingerichteten weiteren Blog des NCPH History@work werden vor allem Fragen und Probleme der Praxis behandelt.
Außerhalb der USA entwickelte sich vor allem in Australien seit Ende der 1990er Jahre eine institutionell verankerte Public History. 1998 wurde an der University of Technology Sidney The Australian Centre for Public History5 als Interessenvertretung gegründet. Derzeit gibt es fünf australische Universitäten mit Public History-Studienangeboten. Seit 1992 veröffentlicht die Australian Professional Historians’ Association die wissenschaftliche Zeitschrift Public History Review (PHR)6, die seit 2006 auch online zur Verfügung steht und neben The Public Historian zu den wichtigsten internationalen Publikationsorganen der Public History zählt. Sie behandelt Fragen der Geschichtsvermittlung und deren Rezeption. Die Zeitschrift versteht sich als Forum für alle Historiker*innen.
Auch in Europa war seit den 1980er Jahren ein ansteigendes öffentliches Interesse an Geschichte zu verzeichnen. Zu einer breiten Public History-Bewegung kam es jedoch nicht. In Großbritannien entwickelte sich zunächst die „History Workshop“-Bewegung um Raphael Samuel am Ruskin College in Oxford, die sich mit Fragen der Geschichte in der Öffentlichkeit auseinandersetzte. 1996 entstand der erste Public History-Studiengang in Oxford, und inzwischen gibt es an insgesamt fünf britischen Universitäten entsprechende Angebote. Weitere Public History-Studienangebote lassen sich seit 2008 in den Niederlanden an der Universität von Amsterdam, in Belgien an der Universität von Gent und in Polen seit 2014 an der Universität Wrocłav finden. Im Wintersemester 2015/16 starteten zudem in Frankreich der erste entsprechende Studiengang an der Université de Paris Est und in Italien an der Universität Modena und Reggio Emilia. In der Schweiz startet im Wintersemester 2017/18 der Masterstudiengang „Geschichtsdidaktik und öffentliche Geschichtsvermittlung“ der PH Luzern und der Universität Freiburg, der in Zusammenarbeit mit den Universitäten Luzern und Basel sowie der PH St. Gallen durchgeführt wird.
Eine erste internationale Public History-Konferenz fand 2005 in Oxford unter dem Titel „People and their Pasts“7 statt. Hier referierten vor allem Vertreter aus den USA, Australien und Großbritannien. Eine für alle Beteiligten konsensfähige Definition der Public History wurde hier ebenso wenig gefunden wie die Entscheidung, ob Public Historians in erster Linie studierte Historiker*innen sein sollten oder auch Laienhistoriker*innen sein können. Ziel der Tagung war vielmehr, möglichst vielfältige Sichtweisen zuzulassen und damit neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit zu gewinnen.
2010 wurde schließlich die International Federation for Public History (IFPH)8 gegründet. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, im Bereich der Lehre und in der Forschung internationale Kontakte zu vermitteln und den transnationalen Austausch zu unterstützen. Zu diesem Zweck wird jährlich eine große internationale Tagung durchgeführt. Die erste fand 2014 in Amsterdam statt, die zweite 2015 in Jinan, die dritte 2016 in Bogotá und die vierte 2017 in Ravenna. Innerhalb des IFPH wurde eine Untergruppe für den wissenschaftlichen Nachwuchs gebildet. Sie nennt sich Student and New Professional Committee9 und soll Public History-Studierende und Absolvent*innen miteinander in Kontakt bringen.
1.1.2Public History in Deutschland
Auch in Deutschland stieg seit den 1970er Jahren die Zahl der Absolvent*innen historischer Studiengänge, und spätestens in den 1980er Jahren wurde der Geschichtsboom deutlich spürbar. Immer mehr Historiker*innen wechselten nach dem Studium in Arbeitsfelder außerhalb der Universitäten oder der Schule, waren jedoch, wie in den USA, kaum auf diese Tätigkeiten vorbereitet. Vielmehr ließ sich sogar eine gewisse Ratlosigkeit in den Universitäten beobachten, wie mit dem sogenannten Geschichtsboom umgegangen werden sollte. Auch wenn die Fachdidaktik die Fachhistoriker*innen zu stärkerer Präsenz in der Öffentlichkeit aufrief, blieb unklar, wie diese aussehen sollte.
Außerhalb der Universitäten nahmen die in den 1980er Jahren gegründeten Geschichtswerkstätten unter dem Motto „Grabe, wo Du stehst“10 die Regional- und Alltagsgeschichte in den Blick und verfassten entsprechende Publikationen. Sie kritisierten die universitäre Geschichtswissenschaft für ihre Fokussierung auf die Politik- und Ideengeschichte, auch die zwischenzeitig erfolgte Aufwertung der Struktur- und Sozialgeschichte reichte ihnen nicht aus. Die Geschichtswerkstätten forderten eine demokratische Aneignung der Geschichte durch die Betroffenen selbst. Einerseits sollten die wissenschaftlich ausgebildeten Historiker*innen mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten und andererseits sollte das alltägliche Leben in den verschiedenen politischen Systemen und damit die „Geschichte von unten“ in den Mittelpunkt des Interesses gerückt werden.11
Abseits der Geschichtswerkstätten und Universitäten ließ sich zudem in den 1990er Jahren in Folge des Geschichtsbooms eine „Institutionalisierung der öffentlichen Geschichtsdarstellung“ beobachten.12 So konnten sich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeitgeschichtliche Redaktionen mit festen Sendeplätzen etablieren, Verlage publizierten verstärkt populärwissenschaftliche Buchreihen und populäre Geschichtszeitschriften wurden entwickelt. Gedenkstätten erhielten eine stärkere institutionelle öffentliche Förderung, Stiftungen zur Aufarbeitung der deutschen Diktaturvergangenheit entstanden und in den Bundes- und Länderverwaltungen wurden Referate eingerichtet, die sich konkret mit der Förderung von öffentlichkeitswirksamen Geschichtsprojekten auseinandersetzen sollten. Damit erweiterte sich das potentielle Arbeitsfeld von Absolvent*innen der Geschichtswissenschaften. Es dauerte jedoch noch einige Zeit, bis auch die Studiengänge diese veränderte Situation widerspiegelten.
Einen Vorreiter im Bereich der Geschichtsstudiengänge mit Praxisbezug stellt der 1985 an der Universität in Gießen eingerichtete Magisterstudiengang Fachjournalistik Geschichte dar, der als das erste deutsche Pendant zu den amerikanischen Public History-Curricula gesehen werden kann. Allerdings ist er ganz auf die journalistische Vermittlung von Geschichte in Film-, Funk- und Druckerzeugnissen bezogen. Weitere Studienangebote dieser Art ließen lange auf sich warten.
Mit der Einführung des Bachelor- und Mastersystems seit 2000 wurden in den Bachelorstudiengängen im Fach Geschichte Praktika verpflichtend eingeführt und facheigene Übungen oder Seminare mit Praxisrelevanz angeboten. Diese Angebote waren aber zunächst kaum konkret in den Lehrplänen verankert, sondern beruhten auf dem Engagement einzelner Dozierender. Ein Beispiel für ein innovatives Public History-Seminar ist das inzwischen über die Grenzen der Universität Bremen bekannte Theaterprojekt „Aus den Akten auf die Bühne“. Darüber hinaus gibt es an verschiedenen Universitäten Public History-Arbeitsbereiche, die Beratungsleistungen und/oder einzelne Praxis-Seminare anbieten. Dazu zählt der 2013/2014 an der Universität Hamburg eingerichtete Arbeitsbereich Public History, der Seminarangebote unterschiedlichster Art rund um Fragen der (Re-)Präsentation von Geschichte im Bachelorstudiengang Geschichte organisiert. Ähnliche Bereiche gibt es beispielsweise an der Universität Münster mit der „Schnittstelle Geschichte und Beruf“ und an der Universität Bielefeld mit dem „Arbeitsbereich Geschichte als Beruf“, die sowohl berufsvorbereitende Informationen vermitteln als auch eigene Praxisseminare durchführen. Eigenständige Public History-Studiengänge werden hier allerdings nicht angeboten. Auch der an der Universität Zürich angesiedelte Weiterbildungsmaster Applied History stellt keinen Studiengang im Sinne der Public History dar. Er bietet vielmehr in erster Linie klassische geschichtswissenschaftliche Seminare für Nicht-Historiker*innen an.
Erst seit 2008 gibt es mit dem konsekutiven Masterstudiengang „Public History“ an der Freien Universität (FU) Berlin ein Angebot, das sich explizit der Public History in all ihren Formen widmet und eine Alternative zu sonstigen Geschichtsmaster-Programmen bietet. Der Studiengang wird gemeinsam von der Universität bzw. dem Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der FU sowie dem Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) angeboten. Aufgrund dieser Kombination ist er inhaltlich stark auf das 20. Jahrhundert ausgerichtet. Die Grundidee des Studienganges liegt in der Vermittlung von theoretisch und methodisch fundierter Geschichtswissenschaft einerseits sowie Praxisfragen der öffentlich wirksamen Geschichtsvermittlung andererseits. Daher werden sowohl klassische historische Seminare angeboten als auch Module rund um Fragen der (Re-)Präsentation, der Geschichtsdidaktik, der Mediengeschichte und des Kulturmanagements. Neben geschichtswissenschaftlichen Methoden werden den Studierenden die Grundlagen des Historischen Lernens, der Oral History, der Material Culture und der Visual History sowie Sound History vermittelt. Auf dieser Basis sollen sie in die Lage versetzt werden, sowohl eigene Geschichtsprodukte zu konzipieren als auch vorhandene Angebote zu analysieren. Die Einsichten in die Praxisarbeit sollen zum einen durch Hausarbeiten in Form von Praxisprojekten gewährleistet werden, zum anderen über die Einbindung von Dozierenden und Gästen aus der außeruniversitären Praxis sowie durch die verpflichtende Teilnahme an Praktika.
Inzwischen gibt es in Deutschland weitere Public History-Studienangebote. So wurde 2012 an der Universität Heidelberg die Professur für Angewandte Geschichtswissenschaft und Public History eingerichtet. 2015 startete an der Universität Köln der zweite Public History-Studiengang. Weitere Programme sind zum Beispiel an der Ruhr-Universität Bochum in Planung. Darüber hinaus gibt es aber auch Studiengänge ähnlichen Inhaltes, jedoch gänzlich anderen Namens wie die Masterstudiengänge „Fachdidaktische Vermittlungswissenschaften – mediating culture“ an der Universität Augsburg, „Kulturvermittlung“ an der Universität Hildesheim, „Kunst- und Kulturvermittlung“ an der Universität Bremen oder „Empirische Kulturwissenschaft“ mit der Profillinie „Museum & Sammlungen“ an der Universität Tübingen. Die Angebote sind denen der genannten Public History-Studiengänge relativ ähnlich, auch wenn das Feld ‚Geschichte‘ hier jeweils auf ‚Kultur‘ erweitert wird. Hinzu kommt ab 2017 der weiterbildende Studiengang „Politisch-Historische Studien“ an der Universität Bonn, der berufsbegleitend absolviert werden soll und sich an Interessenten wendet, die im Bereich der Vermittlung von Politik und/oder Zeitgeschichte tätig sind.
Auch wenn die Programme sich unterscheiden, ist doch allen gemein, dass sie sich mit Geschichtspräsentationen im öffentlichen Raum auseinandersetzen. Zudem sind Projektseminare und Praktika integrale Bestandteile der jeweiligen Studienangebote. Die Verknüpfung mit der beruflichen Praxis steht im Mittelpunkt der Studiengänge. Darüber hinaus sind sowohl Fachwissenschaftler*innen als auch Fachdidaktiker*innen in die Lehre eingebunden, sodass sowohl Grundwissen vertieft als auch Vermittlungsfragen behandelt werden.
Trotz dieser durchaus bemerkenswerten Entwicklung kann im deutschsprachigen Raum nicht von einer Public History-Bewegung gesprochen werden und auch noch nicht von einer eigenständigen Disziplin im universitären Bereich. Die Angebote variieren von einzelnen Seminaren und Übungen über Weiterbildungsstudiengänge bis hin zum Masterstudiengang. Noch fehlt es auch an entsprechenden Graduiertenschulen, auch wenn die Anzahl der Promotionen über Themen der Erinnerungskultur deutlich zunimmt.
Public History wird aber nicht nur an den Universitäten gelehrt, sondern auch und vor allem außerhalb dieser Einrichtungen umgesetzt. Gerade die Historiker*innen, die nicht in die institutionellen akademischen Bereiche eingebunden sind, haben in der Vergangenheit auf die Gründung einer eigenen Interessenvertretung gedrängt. 2012 wurde schließlich auf dem Historikertag in Mainz die Arbeitsgruppe Angewandte Geschichte/Public History13 innerhalb des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands gegründet. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der innerhalb und außerhalb der etablierten Geschichtswissenschaft tätigen Historiker*innen zu verstärken. Daher sieht sich die AG vor allem als Kommunikationsplattform. Dafür werden regelmäßig Workshops zu Themen der Public History durchgeführt, zu denen alle Mitglieder, aber auch weitere Interessierte eingeladen sind. Seit März 2015 gibt es mit den Studierenden und Young Professionals (SYP)14 innerhalb der AG eine Gruppe, die sich aus Studierenden und Absolvent*innen der unterschiedlichen Studiengänge in Deutschland zusammensetzt. Die AG verfügt über kein eigenes Publikationsorgan. Seit 2013 gibt es jedoch das wissenschaftlich ausgerichtete Blog-Journal Public History Weekly15, das wöchentlich kürzere Beiträge zu Themen der Public History mit einem Fokus auf Fragen der Geschichtsdidaktik publiziert, die jeweils mit Kommentaren versehen werden können.
Public History ist somit auch in Deutschland inzwischen auf dem Weg zur Fachdisziplin. Als solche setzt sie sich nicht nur mit populären Darstellungen geschichtswissenschaftlicher Erkenntnisse auseinander, sondern liefert mit ihren Präsentationen auch Impulse für die Forschung. Sie trägt somit nicht nur zur Rekonstruktion von Geschichte bei, sondern wird Teil der Geschichtskultur. Einen mittlerweile selbst längst historischen Impuls dieser Art lieferte der Fernsehmehrteiler „Holocaust“, der 1979 in Deutschland ausgestrahlt wurde und zu einem „Paradigmenwechsel in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und den NS-Verbrechen“16 führte. Ein weiteres Beispiel stellt die erste Ausstellung über „Verbrechen der Wehrmacht“ dar, die Ende der 1990er Jahre präsentiert wurde und einen neuen Umgang der Geschichtswissenschaft mit Bildern und hier vor allem mit Fotografien einleitete. Der Blick in die Entwicklung populärer Geschichtspräsentationen bietet somit sowohl Einblicke in Tätigkeitsfelder für Absolvent*innen historischer Studiengänge als auch in Forschungsfelder für die Geschichtswissenschaft und besonders für die Public History.
Literatur
Ashton, Paul/Kean, Hilda (Hg.): People and their Pasts. Public History Today, Basingstoke 2009.
Horn, Sabine/Sauer, Michael (Hg.): Geschichte und Öffentlichkeit. Orte – Medien – Institutionen, Göttingen 2009.
Kean, Hilda/Martin, Paul/Morgan, Sally J.: Seeing History. Public History in Britain Now, London 2000.
Korte, Barbara/Paletschek, Sylvia: History goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres, Bielefeld 2009.
Meringolo, Denise D.: Museums, Monuments, and National Parks. Toward a New Genealogy of Public History, Amherst 2012.
Rauthe, Simone: Public History in den USA und der Bundesrepublik Deutschland, Essen 2001.
1.2Programmatische und begriffliche Annäherung an Public History
Der Begriff „Public History“ entstand in den USA, ist aber auch dort nicht eindeutig definiert. Geprägt wurde er von dem bereits erwähnten Robert Kelly, Professor an der University of California in Santa Barbara. Seine in den 1970er Jahren formulierte Definition lautet:
„Public History refers to the employment of historians and the historical method outside the academia: in government, private corporations, the media, historical societies and museums, even in private practice.“17
Damit verweist Kelly darauf, dass Public History außerhalb der Universitäten stattfindet, und zwar in Politik und Wirtschaft, in Medien, Museen und Geschichtsvereinen sowie im „privaten Bereich“ und dort insbesondere in der Ahnenforschung. Trotz dieser Aufzählung von Arbeitsfeldern bleibt die Definition unpräzise, was die Inhalte und Methoden der Public History angeht. So bezog sich Kellys Begriff Public History nicht auf die Geschichtsvermittlung in der Öffentlichkeit, sondern allein auf die Beschäftigung von Historiker*innen mit ihren ganz spezifischen Fähigkeiten in den Bereichen Recherche, Analyse und Interpretation außerhalb der Universitäten.18
Gegner dieser Definition sahen darin eine simple, verkürzende Aufspaltung der Historikerzunft nach ihrer Beschäftigung an oder außerhalb der Universitäten. Sie forderten stattdessen eine Einbindung der Fachhistoriker*innen und weiterer Akteur*innen sowie gleichzeitig eine Ausweitung der Definition auf die Ziele und Inhalte der Public History. Diese sei somit, wie der Historiker Charles Cole in den 1990er Jahren formulierte,
„history for the public, about the public, and by the public“19.
Damit wurde die Öffentlichkeit nicht nur zur Zielgruppe, sondern auch zum Thema und zur Produzentin von Geschichtsschreibung erklärt. Dies implizierte, dass die entsprechenden Aktivitäten aller irgendwie an Geschichte interessierten Menschen zur Public History gezählt werden konnten. Diese Ausweitung auf jede Form der Laien-Geschichtsschreibung fand wiederum nicht überall Zuspruch.
Die amerikanische Vereinigung der Public Historians (National Council on Public History, NCPH) definierte 2007 Public History wie folgt:
„Public history is a movement, methodology, and approach that promotes the collaborative study and practice of history; its practitioners embrace a mission to make their special insights accessible and useful to the public.“20
Aber auch diese Definition stieß auf Kritik, da Public History zu diesem Zeitpunkt keine Bewegung, sondern bereits in den Institutionen angekommen sei und trotzdem keine eigenständige Methode entwickelt habe. Übereinstimmung herrschte inzwischen jedoch darüber, dass unter Public History mehr verstanden wurde als nur die Arbeit von Historikern außerhalb der Universitäten. Die überarbeitete Definition des NCPH lautet daher:
„public history describes the many and diverse ways in which history is put to work in the world. In this sense, it is history that is applied to real-world issues. In fact, applied history was a term used synonymously and interchangeably with public history for a number of years. Although public history has gained ascendance in recent years as the preferred nomenclature especially in the academic world, applied history probably remains the more intuitive and self-defining term.“21
Auch diese Definition bleibt eher vage und der Hinweis auf die begriffliche Ähnlichkeit zur Angewandten Geschichte (Applied History) erscheint nicht unbedingt hilfreich. Hier findet sich allerdings eine Ähnlichkeit zur deutschen Diskussion, in der ebenfalls kaum zwischen Angewandter Geschichte und Public History unterschieden wird. Ein Unterscheidungsmerkmal könnte höchstens darin gesehen werden, dass die Angewandte Geschichte22 dezidiert alle Geschichtsinteressierten einbinden will und Public History eher auf universitär ausgebildete Historiker*innen zurückgreift.23 So betont Thomas Cauvin, Vorstandsmitglied der internationalen Vereinigung der Public History, dass Public Historians keine Historiker*innen zweiter Klasse seien, sondern ihre Vorgehensweise wie bei allen Historiker*innen auf geschichtswissenschaftlichen Standards beruhe.24
In einer Zwischenbilanz kann festgehalten werden, dass es zwar viele Merkmale gibt, die Public History ausmachen, aber eine konkrete, von allen Public Historians anerkannte Definition nicht existiert. Der frühere Präsident des NCPH erklärt daher auch, Public History sei „easier to describe than define, and you know it when you see it“25. Auf diese vielleicht unvermeidliche begriffliche Unschärfe verweist auch die Formulierung eines Vertreters der australischen Public History-Gemeinschaft. Danach ist Public History
„an elastic, nuanced und contentious term. Its meaning has changed over time and across cultures in different local, regional, national and international contexts.“26
Ziel dieser verschiedenen Definitionsansätze scheint vor allem zu sein, möglichst viele Akteur*innen und viele Formen des Umganges mit Geschichte zu integrieren und daher möglichst offen zu bleiben. So erklärt ein Mitglied der International Federation for Public History (IFPH) nur, dass Public History sich auseinandersetzt mit der
„Gegenwärtigkeit der Vergangenheit – und mit dem Konstruktionscharakter von Geschichte – außerhalb akademischer Gegebenheiten“.27
Wer die Akteur*innen des Faches sind, bleibt dabei ebenso unscharf wie seine methodischen Grundlagen. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es keine eindeutigen Definitionen, sondern eher Umschreibungen. So wird Public History auch als Schirm begriffen, unter dem Konzepte wie Geschichts- oder Erinnerungskultur zusammengefasst werden können.28 Es finden sich jedoch auch konkretere Erklärungen. So verstehen Frank Bösch und Constantin Goschler Public History als
„zunächst jede Form von öffentlicher Geschichtsdarstellung, die außerhalb von wissenschaftlichen Institutionen, Versammlungen oder Publikationen aufgebracht wird“.29
Diese Erklärung verweist sehr schön auf die große Bandbreite der Public History, bezieht jedoch den wissenschaftlichen Blick auf öffentliche Geschichtsdarstellungen nicht mit ein. Die zweite Definition des Historikers Habbo Knoch versteht Public History dagegen dezidiert als
„Teildisziplin der Geschichtswissenschaft […], die öffentliche Repräsentationen von Vergangenheit außerhalb von Fachwissenschaft, Schule und Familie sowie die damit einhergehenden Deutungen zusammen mit ihren Akteuren, Medien, performativen Praktiken und materiellen Objekten daraufhin untersucht, was für wen, wie, mit welcher Bedeutung und zu welchem Zweck als ‚Geschichte‘ konstituiert und verhandelt wird“.30
Diese Perspektive wiederum betont die universitäre Public History. Beide Seiten verbindet folgende, hier verwendete Definition:
Public History wird sowohl als jede Form der öffentlichen Geschichtsdarstellung verstanden, die sich an eine breite, nicht geschichtswissenschaftliche Öffentlichkeit richtet, als auch als eine Teildisziplin der Geschichtswissenschaft, die sich der Erforschung von Geschichtspräsentationen widmet.31
Damit wird der Bezug zur Geschichtswissenschaft und zur Geschichtsdidaktik herausgestellt und die Erforschung aber auch die Entwicklung außeruniversitärer Präsentationen von Geschichte betont. Public History ist somit sowohl Forschungsdisziplin als auch Forschungsgegenstand. In diesem Punkt grenzen sich deutsche Studienangebote von den Public History-Studiengängen in den USA ab, da letztere vor allem eine praxisnahe Ausbildung vermitteln, um die künftigen Absolvent*innen auf den Arbeitsmarkt außerhalb der Universitäten vorzubereiten. Public History in unserem Verständnis setzt sich jedoch darüber hinaus mit öffentlichen (Re-)Präsentationen von Geschichte auseinander, analysiert diese und dekonstruiert darin zum Ausdruck kommende Geschichtsbilder, um den öffentlichen Gebrauch und Missbrauch der Historie zu untersuchen.
In diesem Sinne können auch konkrete Aufgaben der universitären Public History formuliert werden. Danach analysiert sie sowohl Geschichtsdarstellungen als auch entsprechende Diskurse und deren Wirkungen, um das Verständnis des Konstruktionscharakters von Geschichte zu erhöhen. Dabei sollten die medialen, ökonomischen und politischen Einflüsse auf die Darstellung der Vergangenheit herausgearbeitet werden. In diesem Zusammenhang ist zudem die Instrumentalisierung von Geschichte zu reflektieren. Auf diese Weise können die Funktionen der Geschichtsbilder in den jeweiligen Darstellungen entschlüsselt werden, was wiederum deren Wirkung relativieren kann.32 Public History leistet somit sowohl Beiträge zur Geschichtswissenschaft als auch zur Erinnerungs- bzw. Geschichtskultur (siehe Kapitel 1.3).
Die universitäre Public History ist in Deutschland institutionell bislang vor allem an zeithistorischen Professuren angesiedelt. In jüngster Zeit streben aber auch geschichtsdidaktische Lehrstühle ausdrücklich ihre Berücksichtigung an. Zudem wird ebenso die Nähe zu den Kulturwissenschaften betont.33 Letztendlich verbindet Public History geschichtswissenschaftliche, didaktische und kulturwissenschaftliche Methoden und Ansätze miteinander und geht daher in keinem der Fächer allein auf.
Die Fokussierung auf die Zeitgeschichte lässt sich wesentlich darauf zurückführen, dass es innerhalb der Geschichtswissenschaft, aber vor allem auch im gesellschaftlichen Interesse ein „zeitgeschichtliches Gravitationszentrum“34 zu geben scheint, das sich in den vielfältigen Darstellungen zum 20. Jahrhundert als „Zeitalter der Extreme“ (Eric Hobsbawm) ausdrückt. Das besondere Interesse an der Zeitgeschichte lässt sich weiterhin mit ihrem Konfliktpotential als „Streitgeschichte“35 erklären. Dies wiederum kann darauf zurückgeführt werden, dass wir es hier mit einer „Epoche der Mitlebenden“ (Hans Rothfels), die jeweils ihre Sicht auf ihre Geschichte einbringen, zu tun haben. Darüber hinaus ist die Zeitgeschichte für die Public History besonders interessant, weil sie hier in besonderem Maße Audio- und Video-Quellen einbinden kann, die gerade in der Vermittlung größere Aufmerksamkeit erzielen. Gleichzeitig sind diese medialen Geschichtsdarstellungen wiederum Quellen für die Analyse zeithistorischer Vermittlungsstrategien. Besondere Herausforderungen stellen dabei die relativ schnelllebigen Präsentationen im Internet dar, für deren Untersuchung bisher noch kaum Ansätze entwickelt wurden.
Geschichtspräsentationen, die von Public Historians erstellt werden, unterliegen besonderen Anforderungen. Sie sind Geschichte für die Öffentlichkeit und in der Öffentlichkeit. Als solche wiederum können sie auch als „popular history“36 verstanden werden. Damit wird darauf verwiesen, dass Public History Geschichte für ein Nicht-Fachpublikum in einer populären Art aufbereitet. Sie soll jedoch nicht nur unterhalten, sondern auch historische Prozesse veranschaulichen. Dafür benötigen Public Historians die Fähigkeit, den bereits vorhandenen geschichtswissenschaftlichen Erkenntnisstand aufzuarbeiten und gegebenenfalls auch selbst zu forschen, um in einem zweiten Schritt die Ergebnisse für ein nicht fachwissenschaftlich vorgebildetes Publikum verständlich und anschaulich in verschiedenen Medien aufzubereiten. Somit kann Public History originäre Beiträge zur Geschichtsschreibung und Geschichtskultur leisten.
Public Historians sollten daher fachwissenschaftlich mit Texten, Bildern, Filmen, Tondokumenten und Objekten als Quellen umgehen können. Sie sollten die Quellen aber auch professionell als Vermittlungselemente in Präsentationen wie einem Film, einer Radiosendung, einer Ausstellung, einem Buch oder einer Website einsetzen können. Dafür wiederum werden die geschichtswissenschaftlichen Methoden der Textanalyse, aber auch der Oral History, Visual History, Material Culture und auch der Sound History benötigt. In diesem Buch ist diesen Zugängen jeweils ein eigenes Unterkapitel gewidmet (siehe Kapitel 3). Darüber hinaus wird die Geschichtsdidaktik hier im konkreten Bezug zur Public History einbezogen (siehe Kapitel 2). Public History verknüpft somit verschiedenste Methoden, sowohl in der Forschung als auch in der Konzeption neuer Geschichtsdarstellungen.
Bei der Entwicklung entsprechender Darstellungen agieren Public Historians häufig als Dienstleister für öffentliche oder private Auftraggeber. Dabei müssen wissenschaftliche Ansprüche mit kommerziellen Anforderungen und inhaltlichen Vorgaben abgestimmt werden, was eine der größten Herausforderungen der Public History darstellt. Annäherungen an entsprechende Standards werden im Kapitel 6.4 vertiefend erläutert.
Diese Geschichtsdarstellungen, die für private oder öffentliche Auftraggeber entwickelt werden, sollen sich an die Öffentlichkeit richten. Diese versteht Jörg Requate als Raum, der sich durch Kommunikation konstituiert.37 Die kommunizierten Themen sind von allgemeinem Interesse, der Kommunikationsraum ist allgemein zugänglich und alle können sich aktiv oder passiv beteiligen. Die Akteur*innen lassen sich nach Arne Schirrmacher hinsichtlich ihres Vorwissens in verschiedene Gruppen unterteilen: (1) „breite Öffentlichkeit“, (2) „gelegentlich interessierte Öffentlichkeit“, die (3) „gebildete Öffentlichkeit“, die (4) „Fachöffentlichkeit“, die (5) „Fachkreise außerhalb des engeren Forschungsgebiets“ und schließlich die (6) „Fachwissenschaft“.38 Wie oben erläutert, zielen die Präsentationen der Public History vor allem auf ein außeruniversitäres Publikum und damit auf die Gruppen 1 bis 4. Die Präsentationen sind somit in der Regel an ein Publikum gerichtet, das über wenig oder gar kein Vorwissen über die dargestellte Geschichte verfügt. Da sich das Zielpublikum nicht professionell, also während der Arbeitszeit, mit Geschichtsdarstellungen auseinandersetzt, bleibt nur die Freizeit. Diese wiederum ist für viele Menschen sehr begrenzt und dient nicht nur der Aufnahme von Informationen, sondern primär der Entspannung und Unterhaltung. Der Wunsch nach Unterhaltung kann auch als „anthropologische Konstante“39 verstanden werden. Unterhaltung ist nach Werner Faulstich
„die anstrengungslose Nutzung geschichtlich unterschiedlich formativer Erlebnisangebote, um im je spezifischen kulturell-gesellschaftlichen Kontext disponible Zeit genüsslich auszufüllen“.40
Die zentralen Merkmale der Unterhaltung werden mit den Adjektiven „anstrengungslos“ und „genüsslich“ beschrieben. Kaspar Maase bezeichnet Unterhaltung auch als das Gegenteil von Monotonie und Mühe. „Aufmerksamkeit, Konzentration, auch intellektuelle Anstrengung“ seien als Komponenten von Unterhaltung zwar nicht ausgeschlossen, aber auch nicht unverzichtbar. Maase erachtet zusätzlich eine „Kennerschaft“ als unabdingbar, denn nur was verstanden wird, könne auch unterhalten.41 Unterhaltung und Information schließen sich somit nicht aus, sie treten vielmehr, wie im Fall von Geschichtspräsentationen, gemeinsam auf.
Deshalb werden Public History-Darstellungen häufig so konzipiert, dass die komplexen historischen Zusammenhänge sowohl verständlich als auch interessant bzw. unterhaltsam und anschaulich aufbereitet werden, sodass sie in relativ kurzer Zeit und ohne viel Vorwissen konsumiert werden können. Gleichzeitig hat Public History jedoch eine aufklärerische Aufgabe. Deshalb muss sie sich regelmäßig die Frage stellen, wie wissenschaftliche Forschungsergebnisse in andere Medien überführt, dafür gekürzt, verändert und mit zusätzlichen Materialien versehen werden können, ohne dabei unseriös zu werden. Wie kann ein sorgfältiger, kontrollierbarer, transparenter und unparteilicher Umgang mit den Quellen gewährleistet werden? Wie lässt sich sicherstellen, dass die Autorenschaft des jeweiligen Beitrages eindeutig ausgewiesen ist? Und wie kann eine Präsentation, in der all diese Anforderungen erfüllt sind, immer noch interessant und unterhaltend sein?
Die verschiedenen hier angedeuteten Ansätze zeigen, dass Public History sowohl als akademisches Forschungsfeld betrieben als auch ein Arbeitsfeld außerhalb der akademischen Institutionen darstellen und darüber hinaus selbst Forschungsgegenstand sein kann. Zu den Arbeitsbereichen zählen Politik, Unternehmen, Massenmedien (Radio, Film und Fernsehen, Internet, Zeitschriften), Denkmalswesen, Museen und Gedenkstätten, Verbände und Stiftungen, Politische Bildung, Archiv- und Dokumentationswesen, Familien- und Lokalgeschichte, die Tourismusbranche oder das Verlagswesen. Die Berufe selbst verändern sich stetig. Neben die klassischen Tätigkeiten des Ausstellungsmachens, der pädagogischen oder journalistischen Arbeit treten Rechercheaufgaben, App-Entwicklungen, Reisebegleitungen oder Veranstaltungsorganisationen. Public History kann auch in dieser Hinsicht innovativ sein. So bieten Public Historians historisch fundierte Videobustouren oder auch Geschichts-Geocaching an, arbeiten für Stiftungen oder Ministerien in der Öffentlichkeitsarbeit, schreiben Politiker*innenreden oder konzipieren Ausstellungen – für Museen ebenso wie für Unternehmen oder öffentliche Verwaltungen.
Public History als Fachdisziplin bietet eine „konstruktive Kommunikationsebene zwischen ‚praktischer‘ Produktion und ‚theoretischer‘ Kritik“42, die lange gefehlt hat. Vor allem im deutschsprachigen Raum wurde und wird die Grenze zwischen akademisch etablierten und außerhalb der wissenschaftlichen Institutionen tätigen Historiker*innen relativ strikt gezogen. Es bleibt zu hoffen, dass Public History als Vermittlerin dienen kann. Denn so, wie sie in diesem Buch verstanden wird, leistet sie durchaus einen eigenständigen Beitrag zur Entwicklung der Geschichtswissenschaft, in dem sie Themen setzt, Quellen neu entdeckt und innovative Zugänge findet.
Literatur
Bösch, Frank/Goschler, Constantin (Hg.): Public History. Öffentliche Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der Geschichtswissenschaft, Frankfurt/M. 2009.
Cauvin, Thomas: Public History. A Textbook of Practice, New York 2016.
Rauthe, Simone: Public History in den USA und der Bundesrepublik Deutschland, Essen 2001.
Sayer, Faye: Public History. A practical guide, London u. a. 2015.
Zündorf, Irmgard: Zeitgeschichte und Public History, Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 6.9.2016, URL: http://docupedia.de/zg/Zuendorf_public_history_v2_de_2016
Web-Links
Arbeitsgruppen und Verbände
International Federation for Public History (IFPH), URL: http://ifph.hypotheses.org
National Council on Public History (NCPH), URL: http://www.ncph.org
AG Angewandte Geschichte im Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, URL: http://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/ag-angewandte-geschichte.html
Studierende und Young Professionals der Public History, URL: http://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/ag-angewandte-geschichte/ueber-die-ag/studierende-und-young-professionals.html
Zeitschriften/Mailinglisten/Blogs
Mailingliste H-Public, URL: http://www.h-net.org/~public
The Public Historian, URL: http://tph.ucpress.edu
Public History News, URL: http://ncph.org/publications-resources/publications/publichistory-news
History@Work, URL: http://ncph.org/history-at-work
Public History Weekly, URL: http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de
Public History Review, URL: http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/phrj/index
1.3Geschichte in der Öffentlichkeit: Geschichts- und Erinnerungskultur als erkenntnisleitende Konzepte 43
Möchte man systematisch in den Blick nehmen, welche vielfältigen Funktionen Geschichte in der Öffentlichkeit einnimmt und wie man solche Funktionen kriteriengeleitet beschreiben und analysieren kann, so liegen für ein solches Vorhaben zwei Konzepte auf dem Tisch, die nicht selten synonym verwendet werden, aber auch manchmal als Konkurrenzkonzepte in Erscheinung treten: Erinnerungskultur und Geschichtskultur. Beide Konzepte ordnen den Umgang mit Geschichte in der Öffentlichkeit jeweils unterschiedlichen Akteur*innen und Akteuren von Geschichte zu, zum Beispiel dem Individuum, das durch eine Beschäftigung mit Geschichte eine eigene historische Identität ausbildet, oder der akademischen Geschichtswissenschaft, die Standards vorgibt, die für den Umgang mit Geschichte auch in der Öffentlichkeit Geltung beanspruchen.
Vielleicht liegt die Konkurrenzsituation beider Konzepte weniger an einer grundlegenden Unterschiedlichkeit (die sich tatsächlich nur, aber immerhin, am Unterschied von Geschichte und Erinnerung festmacht), sondern auch daran, wer die Protagonist*innen im akademischen Diskurs sind, die sich die jeweiligen Konzepte auf ihre Fahnen heften: Während „Erinnerungskultur“ als Analyseinstrument fast schon inflationär vor allem von den akademischen Geschichts- und Kulturwissenschaften verwendet wird, hat sich der Terminus „Geschichtskultur“ in der Geschichtsdidaktik zu einem Leitkonzept entwickelt, mit dem der öffentliche Ort von Geschichtsbewusstsein in einer Gesellschaft beschrieben wird.
Den Zusammenhang von „Geschichte“ und „Erinnerung“ präzisiert der Geschichtstheoretiker Jörn Rüsen, indem er betont, dass Erinnerung (und auch Gedächtnis) alltagssprachlich auf Erfahrungen gerichtet sind, die Individuen in ihrem eigenen Leben machen, während Geschichtsbewusstsein überwiegend eine Vergangenheit thematisiert, die jenseits der Grenzen der eigenen Lebensspanne angesiedelt ist. Erinnern kann freilich auch historisch sein, jedoch nur, wenn die Erinnerung „in zeitlicher Perspektive grundsätzlich die Grenzen der Lebenszeit der sich erinnernden Subjekte überschreitet, das heißt tiefer in die Vergangenheit zurückgeht und von ihr her weiterreichende Zukunftsperspektiven entwerfen läßt.“44 Weiter führt er aus:
„Beides jedoch, die persönliche Erinnerung, über die sich Individualität und soziale Zugehörigkeit des Einzelnen mental aufbauen, wie auch der Ausgriff über die Grenzen der eigenen Lebenszeit zurück in die Vergangenheit, sind zwei Seiten ein und derselben Sache: Menschen tendieren dazu, ihre eigene Identität in zeitlich übergreifende geistige Gebilde hinein ‚aufzuheben‘ (z. B. eine Nation oder eine Kultur), um in ihrem Selbstwertgefühl und in der zeitlichen Orientierung ihrer eigenen Lebenspraxis die Grenzen der eigenen Lebensspanne zu überschreiten.“45
Die Idee, dass Erinnern über die eigene Lebensspanne hinausgehen kann, hat Christoph Cornelißen bei seiner Definition von Erinnerungskultur aufgegriffen; er präzisiert:
„Obwohl der Begriff ‚Erinnerungskultur‘ erst seit den 1990er-Jahren Einzug in die Wissenschaftssprache gefunden hat, ist er inzwischen ein Leitbegriff der modernen Kulturgeschichtsforschung. Während er in einem engen Begriffsverständnis als lockerer Sammelbegriff ‚für die Gesamtheit des nicht spezifisch wissenschaftlichen Gebrauchs der Geschichte in der Öffentlichkeit – mit den verschiedensten Mitteln und für die verschiedensten Zwecke‘ definiert wird, erscheint es aufgrund der Forschungsentwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte insgesamt sinnvoller, ‚Erinnerungskultur‘ als einen formalen Oberbegriff für alle denkbaren Formen der bewussten Erinnerung an historische Ereignisse, Persönlichkeiten und Prozesse zu verstehen, seien sie ästhetischer, politischer oder kognitiver Natur.
Der Begriff umschließt mithin neben Formen des ahistorischen oder sogar antihistorischen kollektiven Gedächtnisses alle anderen Repräsentationsmodi von Geschichte, darunter den geschichtswissenschaftlichen Diskurs sowie die nur ‚privaten‘ Erinnerungen, jedenfalls soweit sie in der Öffentlichkeit Spuren hinterlassen haben. Als Träger dieser Kultur treten Individuen, soziale Gruppen oder sogar Nationen in Erscheinung, teilweise in Übereinstimmung miteinander, teilweise aber auch in einem konfliktreichen Gegeneinander.“46
Kultur entsteht, wenn Menschen gemeinsam den Versuch unternehmen, Sinn zu bilden, und indem sie Wirklichkeiten mit Bedeutung versehen. Nach Cornelißen sind die Träger*innen dieses Aushandlungsprozesses „Individuen, soziale Gruppen oder sogar Nationen […] teilweise in Übereinstimmung miteinander, teilweise aber auch in einem konfliktreichen Gegeneinander“.47
Es darf also durchaus konfliktreich zugehen, wenn Einzelne oder Kollektive sich erinnern und vergangene Wirklichkeiten in unserer Gegenwart mit Sinn versehen. Hier können also – das ist im Konzept der Erinnerungskultur immer mitgedacht – conflicting memories genauso entstehen wie divided memories oder shared memories.
Der gesellschaftlichen und institutionellen Vielschichtigkeit von Erinnern ist sich das Konzept der Erinnerungskultur also durchaus bewusst und richtet das Augenmerk insbesondere auf die Träger*innen eines solchen Erinnerns. Aus den Reihen der Geschichtsdidaktik ist „Erinnerungskultur“ als Konzept aber durchaus auch zum Gegenstand von grundlegender Kritik geworden. So betont zum Beispiel Wolfgang Hasberg, dass bei Erinnerungskultur die Gefahr einer individualistischen Engführung des Erinnerungsdiskurses bestünde und dass auch die Zukunftsorientierung bei Erinnerungskultur zu kurz komme.48
Dem setzt die Geschichtsdidaktik das Konzept der Geschichtskultur entgegen – und geht dabei von der Prämisse aus, dass ein kollektives Geschichtsbewusstsein – jene Geschichtskultur eben – nicht nur in der Aufsummierung der jeweils individuellen historischen ‚Bewusstseine‘ bestehe.49
Geschichtsbewusstsein ist die Leitkategorie der Geschichtsdidaktik und wird verstanden als
„die ständige Gegenwärtigkeit des Wissens, daß der Mensch und alle von ihm geschaffenen Einrichtungen und Formen seines Zusammenlebens in der Zeit existieren, also eine Herkunft und eine Zukunft haben, daß sie nichts darstellen, was stabil, unveränderlich und ohne Voraussetzungen ist.“50
Auf diese Begriffsbildung von Geschichtsbewusstsein beziehen sich dementsprechend auch Definitionen von Geschichtskultur. Jörn Rüsen z. B. führt aus:
„Geschichtskultur läßt sich (…) definieren als praktisch wirksame Artikulation von Geschichtsbewußtsein im Leben einer Gesellschaft.“51
Sie „bezeichnet“, so Rüsen an anderer Stelle, „den Gesamtbereich der Aktivitäten des Geschichtsbewußtseins“ und lässt sich „als ein eigener Bereich der Kultur mit einer spezifischen Weise des Erfahrens und Deutens der Welt […] beschreiben und analysieren“ und markiert als geschichtsdidaktische Kategorie „den Sitz des Geschichtsbewußtseins im Leben.“52 Dieser Begriffsbildung schließt sich auch Hans-Jürgen Pandel im Prinzip an, wenn er erklärt:
„Geschichtskultur bezeichnet die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit Vergangenheit und Geschichte umgeht. In ihr wird das Geschichtsbewusstsein der in dieser Gesellschaft Lebenden praktisch und äußert sich in den verschiedensten kulturellen Manifestationen.“53
Auch Bernd Schönemann rekurriert auf einen Zusammenhang zwischen individuellem Geschichtsbewusstsein und kollektiver Geschichtskultur:
„Die Kategorien Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur lassen sich widerspruchsfrei unter dem ‚Dach‘ der Zentralkategorie ‚Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft‘ ansiedeln, wenn man akzeptiert, dass Gesellschaften ihre Vergangenheit auf zweierlei Weise (bimodal) konstruieren, nämlich individuell und kollektiv. Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur werden dann als zwei Seiten einer Medaille begreifbar: Auf der einen Seite Geschichtsbewusstsein als individuelles Konstrukt, das sich von außen nach innen, in Internalisierungs- und Sozialisierungsprozessen aufbaut; auf der anderen Seite Geschichtskultur als kollektives Konstrukt, das auf dem entgegengesetzten Weg der Externalisierung entsteht und objektive Gestalt annimmt.“54
Wolfgang Hasberg ergänzt in Anlehnung an Jörn Rüsen, dass es also offenbar „nur ein kleiner Schritt vom Geschichtsbewusstsein zur Geschichtskultur“ sei:
„Während das Erste die innere Seite des historischen Lernens bildet, stellt das Zweite die äußere Seite dar.“55
Egal, welcher Metaphorik man sich hier anschließen möchte (individuell/kollektiv, zwei Seiten einer Medaille, innere und äußere Seite): Bemerkenswert ist der Umstand, dass die Geschichtsdidaktik bisher keine Theorie vorrätig hält, mit der eben jene Internalisierungs- und Sozialisierungsprozesse oder eben jener Prozess einer Externalisierung vom Individuellen zum Kollektiven (oder von innen nach außen) regelhaft beschrieben werden können.56 Das Gleiche gilt freilich für das Konzept der Erinnerungskultur. Wie aus individueller Erinnerung schlussendlich eine kollektive oder gar eine überzeitlich-kulturelle Erinnerung werden kann, wird zwar mit Termini wie kollektives oder kulturelles Gedächtnis beschrieben, aber nicht regelhaft erklärt. Statt einer Theorie zur Geschichtskultur bietet die Geschichtsdidaktik jedoch eine umfassende Phänomenologie an, indem sie vor allem beschreibt, in welchen Dimensionen sich Geschichtskultur in unserer Gegenwartsgesellschaft äußert. So führt Jörn Rüsen aus:
„Im Blick auf moderne Lebensverhältnisse lassen sich verschiedene Bereiche und Dimensionen der Geschichtskultur unterscheiden, vor allem die ästhetische, die politische und die kognitive. Sie sind in ihrem inneren Zusammenhang anthropologisch fundiert, nämlich in den elementaren mentalen Operationen des Fühlens, Wollens und Denkens.“57
Mit der ästhetischen Dimension von Geschichtskultur ist dabei „gerade nicht das Historische im Ästhetischen, sondern das Ästhetische im Historischen“58 gemeint – eine Analyse des Ersten wäre vielleicht eine Aufgabe der Kunstgeschichte, während das Zweite beschreibt, auf welche Weise Geschichte durch ihre Ästhetisierung in der Gegenwart erfahrbar werden kann. Gerade dem Ästhetischen, das laut Rüsen in der mentalen Operation des Fühlens zum Ausdruck komme, gesteht er eine sehr umfassende Bedeutung bei der Wirkungsmächtigkeit von Geschichte in unserer Gegenwart zu. Hier lohnt sich ein ausführlicherer Blick in seine Ausführungen:
„Was macht historische Erinnerung eingängig, was verleiht ihr die Lebendigkeit, mit der sie die Abständigkeit und Unwirklichkeit der Vergangenheit in die überwältigende Wirklichkeit der Gegenwart hinein vermittelt? Diese Frage ist ohne einen Hinweis auf die ästhetische Qualität historischer Präsentationen der Vergangenheit nicht beantwortbar. Ohne den hier vorherrschenden Gesichtspunkt formaler Stimmigkeit – traditionell wird er ‚Schönheit‘ genannt – könnten historische Werke ihre orientierende Kraft auf der Ebene der sinnlichen Wahrnehmung nicht entfalten; die Gedankenblässe der Erkenntnis hätte kein Feuer der Einbildungskraft, mit der die historische Erinnerung als Gesichtspunkt handlungsleitender Zwecksetzungen wirksam wird. Das gleiche gilt für die Umsetzung historisch formulierter politischer Absichten. Auch sie müssen sich mit der Gestaltungs- und Wirkungskraft der sinnlichen Anschauung verschwistern, um ihre praktische Funktion erfüllen zu können.“59
Hier liegen nun sehr viele Begriffe gleichzeitig auf dem Tisch. Vielleicht erfolgt an dieser Stelle auch allzu schnell eine Verknüpfung der Dimension ‚Ästhetik‘ mit der ihr zugeschriebenen Fähigkeit einer „sinnlichen Wahrnehmung“, die dann wiederum in der elementaren mentalen Operation des Fühlens zum Ausdruck komme.60 Immerhin jedoch wird auch der Rolle von Emotionen in diesem Entwurf eine zentrale Rolle zugewiesen: Die sinnliche Wahrnehmung ist es, die historisches Erinnern durch ein „Feuer der Einbildungskraft“ überhaupt erst praktisch wirksam werden lässt. Oder schärfer formuliert: Ohne Emotionen müsste die politische und die kognitive Dimension von Geschichtskultur ins Leere laufen, würde blass und wirkungslos bleiben und Geschichte könnte ihrer Orientierungsfunktion erst gar nicht nachkommen.
Die drei geschichtskulturellen Dimensionen Ästhetik (Fühlen), Politik (Wollen) und Kognition (Wissen) sind sich, greift man die Redeweise des ‚Verschwisterns‘ von Rüsen auf, als Schwestern vorzustellen, bei „denen auf jeweils unterschiedliche Weise historischer Sinn gebildet und transportiert wird“, sie existieren „realiter niemals unabhängig voneinander“61. Wie vielleicht auch bei menschlichen Schwestern nicht unüblich,
„ist der Zusammenhang der verschiedenen Dimensionen […] dadurch charakterisiert, daß jeweils die eine Dimension die andere zu instrumentalisieren trachtet und damit zu Verengungen und Verwerfungen der Geschichtskultur führt“.62
Alle drei Schwestern gehen komplexe Beziehungen ein, wobei die Geschichtskultur erst dann ihre historische Orientierungsfunktion am besten erfüllen kann (wie vielleicht ebenso beim Zusammenwirken von Schwestern in einer Familie), wenn sie „ihre drei Dimensionen in relativer Autonomie belässt und zugleich wechselseitig kritisch aufeinander bezieht“.63 Die Dimensionen von Geschichtskultur sollen also – kommen wir auf den eingangs zitierten Hans-Jürgen Pandel zurück – im besten Falle gleichberechtigt sein.
Eine solche Strukturierung kann es immerhin leisten, „Geschichtskultur zunächst empirisch erschließbar werden“64 zu lassen und dabei der Bedeutung von Politik, Wissenschaft und Emotionen einen systematischen Ort beim Umgang mit Geschichte in der Öffentlichkeit zuzuweisen. Die Funktion einer solchen Phänomenologie hat also vor allem heuristischen Wert und kann dabei helfen, jeweils konkrete Ausprägungen von Geschichtskultur genauer zu beschreiben. Wolfgang Hasberg präzisiert dieses Strukturmodell in Form einer Tabelle:
Tab. 1: Die politische, kognitive und ästhetische Dimension von Geschichtskultur65
Literatur
Hasberg, Wolfgang: Erinnerungs- oder Geschichtskultur? Überlegungen zu zwei (un-)vereinbaren Konzeptionen zum Umgang mit Gedächtnis und Geschichte, in: Hartung, Olaf (Hg.): Museum und Geschichtskultur. Ästhetik – Politik – Wissenschaft, Bielefeld 2006, S. 32–59.
Lücke, Martin: Fühlen – Wollen – Wissen. Geschichtskulturen als emotionale Gemeinschaften, in: Brauer, Juliane/Lücke, Martin (Hg.): Emotionen, Geschichte und historisches Lernen. Geschichtsdidaktische und geschichtskulturelle Perspektiven, Göttingen 2013, S. 11–26.
Schönemann, Bernd: Geschichtsdidaktik, Geschichtskultur, Geschichtswissenschaft, in: Günther-Arndt, Hilke (Hg.): Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, Berlin 2003, S. 11–22.
______________
1Meringolo, Denise D.: Museums, Monuments, and National Parks. Toward a New Genealogy of Public History, Amherst 2012, S. xiv.
2Vgl. Website des Public History Resource Center, URL: http://www.publichistory.org/education/where_study.asp (Aufruf 13.11.2017).
3Vgl. Website des NCPH, URL: http://www.ncph.org (Aufruf 13.11.2017).
4Vgl. Website The Public Historian, URL: http://tph.ucpress.edu (Aufruf 13.11.2017).
5Vgl. Website des Australian Centre for Public History, URL: https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/australian-centre-public-history (Aufruf 13.11.2017).
6Vgl. Website der Public History Review, URL: http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/phrj (Aufruf 13.11.2017).
7Ashton, Paul/Kean, Hilda (Hg.): People and their Pasts. Public History Today, Basingstoke 2009.
8Vgl. Website der IFPH, ULR: https://ifph.hypotheses.org (Aufruf 13.11.2017).
9Vgl. Website des IFPH, URL: http://ifph.hypotheses.org/412 (Aufruf 13.11.2017).
10Lindqvist, Sven: Grabe, wo du stehst. Handbuch zur Erforschung der eigenen Geschichte [1978]. Aus dem Schwedischen übersetzt und herausgegeben von Manfred Dammeyer, Bonn 1989.
11Grotrian, Etta: Kontroversen um die Deutungshoheit. Museumsdebatte, Historikerstreit und „neue Geschichtsbewegung“ in der Bundesrepublik der 1980er Jahre, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, 61 (2009), S. 372–389, hier S. 379 ff.; Vgl. auch Grotrian, Etta: Geschichtswerkstätten und Alternative Geschichtspraxis in den Achtzigern, in: Hardtwig/Schug, History Sells, 2009, S. 243–253.
12Bösch, Frank/Goschler, Constantin: Der Nationalsozialismus und die deutsche Public History, in: Dies., Public History, 2009, S. 7–23, hier S. 21.
13Vgl. Website der AG, URL: http://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/ag-angewandtegeschichte.html (Aufruf 13.11.2017).
14Vgl. Website der SYP, URL: http://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/ag-angewandte-geschichte/ueber-die-ag/studierende-und-young-professionals.html (Aufruf 13.11.2017).
15Vgl. Public History Weekly, URL: http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/ (Aufruf 13.11.2017).
16Bösch/Goschler, Der Nationalsozialismus und die deutsche Public History, S. 20.
17Kelly, Robert: Public History: Its Origins, Nature, and Prospects, in: The Public Historian, 1 (1978), 1, S. 16–28, hier S. 16.
18Meringolo, Museums, Monuments, and National Parks, S. xvii.
19Cole, Charles C.: Public History: What Difference Has It Made?, in: The Public Historian, 16 (1994), 4, S. 9–35, hier S. 11.
20Definition des National Council on Public History, zit. nach: Corbett, Kathy/Miller, Dick: What’s in a Name?, H-Public Discussion Networks, May 2007, URL: http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-public&month=0705&week=e&msg=aVngv/iJbMn6XgpXbtnoiw&user=&pw= (Aufruf 13.11.2017).
21Website des NCPH, URL: http://ncph.org/what-is-public-history/about-the-field/ (Aufruf 13.11.2017).
22Tomann, Juliane u. a.: Diskussion Angewandte Geschichte: Ein neuer Ansatz?, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 15.2.2011, URL: http://docupedia.de/zg/Diskussion_Angewandte_Geschichte?oldid=106405 (Aufruf 13.11.2017).
23Vgl. Zündorf, Irmgard: Public History und Angewandte Geschichte – Konkurrenten oder Komplizen?, in: Nießer/Tomann, Angewandte Geschichte, 2014, S. 63–76.
24Cauvin, Thomas: Public History. A Textbook of Practice, New York 2016, S. 11.
25Weible, Robert: Defining Public History: Is it Possible? Is it Necessary?, in: Perspectives on History. The Newsmagazine of the American Historical Association, 46 (2008), 3, URL: https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/march-2008/defining-public-history-is-it-possible-is-it-necessary (Aufruf 13.11.2017).
26Ashton, Paul: Introduction: Going Public, in: Public History Review, 17 (2010), S. 1–15, hier S. 1 f.
27Noiret, Serge: Internationalisierung der Public History, in: Public History Weekly, 2 (2014), 34, URL: https://public-history-weekly.degruyter.com/2–2014–34/internationalizing-public-history/ (Aufruf 13.11.2017).
28Demantowsky, Marko: „Public History“ – Aufhebung einer deutschsprachigen Debatte?, in: Public History Weekly, 3 (2015) 2, URL: https://public-history-weekly.degruyter.com/3–2015–2/public-history-sublation-german-debate/ (Aufruf 13.11.2017).
29Bösch/Goschler, Der Nationalsozialismus und die deutsche Public History, S. 10.
30Knoch, Habbo: Wem gehört die Geschichte? Aufgaben der „Public History“ als wissenschaftlicher Disziplin, in: Hasberg/Thünemann, Geschichtsdidaktik in der Diskussion, 2016, S. 303–345, hier S. 304.
31Vgl. auch Zündorf, Irmgard: Zeitgeschichte und Public History, Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 6.9.2016, URL: http://docupedia.de/zg/Zuendorf_public_history_v2_de_2016 (Aufruf 13.11.2017).
32Knoch, Wem gehört die Geschichte?, S. 343 f.
33Samida, Stefanie: Public History als Historische Kulturwissenschaft: Ein Plädoyer, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 17.6.2014, URL: http://docupedia.de/zg/Public_History_als_Historische_Kulturwissenschaft?oldid=97436 (Aufruf 13.11.2017).
34Nolte, Paul: Öffentliche Geschichte. Die neue Nähe von Fachwissenschaft, Massenmedien und Publikum: Ursachen, Chancen und Grenzen, in: Barricelli/Hornig, Aufklärung, Bildung, „Histotainment“, 2008, S. 131–146, hier S. 136.
35Sabrow, Martin/Jessen, Ralph/Große Kracht, Klaus (Hg.): Zeitgeschichte als Streitgeschichte. Große Kontroversen seit 1945, München 2003.
36Jordanova, Ludmilla: History in Practice, London 2000, S. 141.
37Requate, Jörg: Öffentlichkeit und Medien als Gegenstände historischer Analyse, in: Geschichte und Gesellschaft, 25 (1999), S. 5–32, hier S. 9.
38Schirrmacher, Arne: Nach der Popularisierung. Zur Relation von Wissenschaft und Öffentlichkeit im 20. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft, 34 (2008), S. 73–95, hier S. 86.
39Faulstich, Werner: „Unterhaltung“ als Schlüsselkategorie von Kulturwissenschaft: Begriffe, Probleme, Stand der Forschung, Positionsbestimmung, in: Ders./Knop, Unterhaltungskultur, 2006, S. 7–20, hier S. 8.
40Faulstich, „Unterhaltung“, S. 14.
41Maase, Kaspar: Grenzenloses Vergnügen? Zum Unbehagen in der Unterhaltungskultur, in: Frizzoni/Tomkowiak, Unterhaltung, 2006, S. 49–67, hier S. 53.
42Demantowsky, „Public History“.
43In diesem Kapitel werden Ideen aufgegriffen, die in ähnlicher Form schon veröffentlicht wurden unter: Lücke, Martin: Fühlen – Wollen – Wissen. Geschichtskulturen als emotionale Gemeinschaften, in: Brauer/Lücke, Emotionen, Geschichte und historisches Lernen, 2013, S. 11–26.
44Rüsen, Jörn: Geschichtskultur, in: Bergmann u. a., Handbuch der Geschichtsdidaktik, 1997, S. 38–41, hier S. 38.
45Rüsen, Jörn: Geschichtsbewusstsein, in: Pethes/Ruchatz, Gedächtnis und Erinnerung, 2001, S. 223–226, hier S. 223 f.
46Cornelißen, Christoph: Erinnerungskulturen, Version 2.0: in: Docupedia-Zeitgeschichte, 22.10.2012, URL: https://docupedia.de/zg/Erinnerungskulturen_Version_2.0_Christoph_Cornelißen (Aufruf 13.11.2017)
47Ebd.
48Hasberg, Wolfgang: Erinnerungs- oder Geschichtskultur? Überlegungen zu zwei (un-)vereinbaren Konzeptionen zum Umgang mit Gedächtnis und Geschichte, in: Hartung, Museum und Geschichtskultur, 2006, S. 32–59, hier S. 55 f.
49Ebd., S. 56.
50Schieder, Theodor: Geschichtsinteresse und Geschichtsbewußtsein heute, in: Burckhardt, Geschichte zwischen Gestern und Morgen, 1974, S. 73–102, hier S. 78 f. Zitiert nach: Jeismann, Karl-Ernst: Geschichtsbewußtsein – Theorie, in: Bergmann u. a., Handbuch der Geschichtsdidaktik, 1997, S. 42–44, hier S. 42.
51Rüsen, Jörn: Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken, in: Füßmann/Grütter/Rüsen, Historische Faszination, 1994, S. 3–26, hier S. 5.
52Rüsen, Geschichtskultur, S. 38.
53Pandel, Hans-Jürgen: Geschichtskultur, in: Mayer, Wörterbuch Geschichtsdidaktik, 2009, S. 86–87, hier S. 86.
54Schönemann, Bernd: Geschichtsdidaktik, Geschichtskultur, Geschichtswissenschaft, in: Günther-Arndt, Geschichtsdidaktik, 2003, S. 11–22, hier S. 17.
55Hasberg, Erinnerungs- oder Geschichtskultur?, S. 50.
56Ob eine solche Theorie eine soziologische oder eine psychologische sein müsste, wäre an dieser Stelle ebenso zu klären. Vielleicht lassen sich Antworten in Jürgen Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns finden, indem man historisches Erzählen als Ausdruck von Geschichtsbewusstsein und zugleich als kommunikatives Handeln in heterogenen Geschichtskulturen begreift. Dieses Problem kann an dieser Stelle jedoch nicht weiter vertieft werden.
57Rüsen, Geschichtskultur, S. 39.
58Rüsen, Was ist Geschichtskultur?, S. 12.
59Ebd., S. 13.
60Wäre an dieser Stelle Platz für einen weiteren begrifflichen Schlenker, so könnten hier Ausführungen zur Theorie der Ästhetik und zum Zusammenhang von Emotion und ästhetischem Empfinden gewiss dazu beitragen, dem Zusammenhang dieser Begriffe noch genauer nachzugehen als es in dieser kurzen Skizze der Phänomenologie von Geschichtskultur möglich ist.
61Hasberg, Erinnerungs- oder Geschichtskultur?, S. 50.
62Rüsen, Geschichtskultur, S. 40.
63Ebd.
64Hasberg, Erinnerungs- oder Geschichtskultur?, S. 50.
65Ebd.