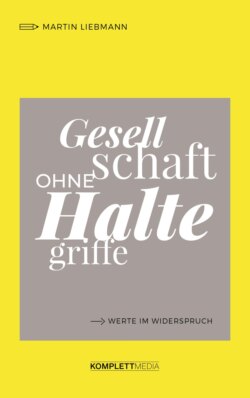Читать книгу Gesellschaft ohne Haltegriffe - Martin Liebmann - Страница 5
Auf Augenhöhe
ОглавлениеDie Küche einer Wohngemeinschaft ist das ideale Versuchslabor für Individualethik. Einkauf, Abwasch, Müll und Ordnung in der WG-Kommunikationszentrale stellen die Beziehungen zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern regelmäßig vor große Herausforderungen. Wer hat das Stück Butter zum Kochen verbraucht, so dass ich zum Frühstück die letzte Brotscheibe staubtrocken herunterwürgen muss? Warum sind alle Töpfe und Pfannen noch schmutzig, obwohl ich meinen Besuch mit einem selbst gekochten Abendessen verwöhnen wollte? Kommt der fiese Gestank aus den drei Mülltüten, die prallvoll neben dem Eimer liegen? Wo ist der Korkenzieher, der mich vom Inhalt der Flasche Sauvignon trennt, die ich mir so gern einverleiben möchte? Und überhaupt: Wo ist die Flasche? Selbst auf kleinstem Raum in überschaubarer Gruppengröße birgt jede noch so kleine Handlung eines einzelnen Mitglieds enormes Konfliktpotenzial. Nicht ohne Grund hängen in wohl fast jeder Wohngemeinschaft diverse Pläne, wer wann was zu verrichten hat, und Listen mit Regeln, was man tunlichst unterlassen soll, um einigermaßen friedlich so etwas wie ein normales Zusammenleben hinzubekommen. Theoretisch ist das ein einfach zu lösendes Problem. Alle müssten nur die Goldene Regel befolgen. Den letzten Butterrest nicht achtlos verbrauchen, damit fürs Frühstück für alle noch etwas da ist. Das Geschirr nach dem Essen abwaschen, damit es wieder einsatzbereit ist. Den Müll herunterbringen, wenn der Eimer voll ist. Den Korkenzieher wieder zurück an seinen Platz legen. Kurz: Alles so zu hinterlassen, wie man es selbst gern vorfinden will. Was du nicht willst, was man dir tu, das füg’ auch keinem anderen zu!
Die Goldene Regel findet man weitgehend sinngetreu in fast allen Kulturen. Im jüdischen Talmud klingt sie fast identisch wie in der christlichen Bibel, in den Hadithen des Propheten Mohammed ist sie anders formuliert, meint aber dasselbe, was auch Konfuzius ähnlich geäußert hatte und was im Mahabharata der Hindus überliefert ist. In weniger komplexen Beziehungsgeflechten, auf der Ebene zwischen Individuen, funktioniert dieser moralische Kompass zumindest als Orientierung recht gut, wenngleich seine Einhaltung teilweise nur auf die Mitglieder der eigenen Gruppe begrenzt wird. Und selbst da kann es trotz konsequenter Einhaltung fürchterlich knirschen. Es reicht, wenn zum Beispiel ein Mitglied der WG ein völlig anderes Hygiene- und Ordnungsbedürfnis hat als die anderen. Wenn ich nicht möchte, dass nach einem köstlichen Gelage die ausgelassene Stimmung durch so etwas Banales wie Abwaschen zerstört wird, dann tu ich es doch in guter Absicht, wenn ich alles schmutzig liegen lasse, oder? Und schließlich fordere ich auch niemanden dazu auf, vor mir aufzustehen und das Vorabendchaos als Erster zu entdecken. Eine Tasse für einen Kaffee findet sich am nächsten Morgen garantiert, und sollte sie nicht sauber sein, ist sie schnell ausgespült. Außerdem ist die Küche kein klinischer Reinraum, sondern wird erst durch mit allen Sinnen erfahrbare Spuren des Lebens gemütlich. Die Goldene Regel braucht ein gemeinsames Verständnis von gut und schlecht, von Leid und Freude. Sonst ist ihre Reichweite sehr begrenzt.
Eine weitere wichtige Voraussetzung für den Kürzest-Kodex ist, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Sobald jemand oder eine Gruppe sich zu Höherem berufen fühlt und über andere Menschen oder Menschengruppen stellt, bricht das moralische Gebäude schnell zusammen. Fundamentalistisch ausgelegte Religionen und nationalistisch tönende Akteure belegen das eindrucksvoll. Mit wenigen Streichen können sie mühsam aufgebaute Strukturen eines guten Miteinanders zerstören. Sie versuchen es auch regelmäßig, viel zu oft mit Erfolg. Übrigens auch in der einen oder anderen Wohngemeinschaft soll es Mitglieder geben, die sich zu Höherem berufen fühlen als zu den niederen Tätigkeiten, womit sie das Prinzip der Augenhöhe außer Kraft setzen und den Wohnfrieden gefährden.
Die Philosophie hat wegen solcher Probleme immer wieder versucht, universell funktionierende Rahmen zu finden, an denen wir uns orientieren können. Einer der bekanntesten ist der Kategorische Imperativ von Immanuel Kant, der den Mensch mit seiner Würde als Selbstzweck sieht und aus der in ihm wohnenden Vernunft eine allgemeingültige Regel entwickelt: »Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.« Das trägt schon deutlich weiter, denn mit dem Wegfall des Individuums als Maßstab und den Fokus auf die Allgemeinheit kann man sich nicht mehr ganz so leicht herausreden und jeden Egoismus mit ein paar argumentativen Winkelzügen als gut und richtig darstellen. Vor allem wenn man wie Kant den Menschen dazu befähigt sieht, sich seiner Vernunft zu bemächtigen, ist der Kategorische Imperativ eine recht gute Orientierungshilfe für das Zusammenleben. Aber auch Kants Modell hat seine Grenzen. Das Problem liegt darin, dass es sowohl individuell als auch kulturell sehr unterschiedliche Haltungen und sich widersprechende Ansichten geben kann, die Menschen ernsthaft und auch reflektiert zum allgemeinen Gesetz erheben wollen. Insbesondere, wenn es sich um Glaubenssätze handelt – und die Welt ist auch jenseits religiöser Fragen voll davon –, lassen sich Maximen als allgemeingültig und moralisch einwandfrei, ja geradezu als zwingend zu befolgen behaupten. Nicht selten kommt es dann sogar dazu, dass daraus Alleinstellungsansprüche formuliert werden. Das ist mit Sicherheit nicht das, was sich der große Aufklärer und Kämpfer für die Vernunft dabei gedacht hat, aber je komplexer unsere Welt geworden ist, desto deutlicher wurde, dass sein moralisches Orientierungskonstrukt weitergedacht werden muss. Einer, der das sehr gründlich getan hat, ist Jürgen Habermas. Er hat Folgendes vorgeschlagen: »Der kategorische Imperativ bedarf einer Umformulierung (…): Statt allen anderen eine Maxime von der ich will, dass sie allgemeines Gesetz sei, als gültig vorzuschreiben, muss ich meine Maxime zum Zweck der diskursiven Prüfung ihres Universalitätsanspruchs allen anderen vorlegen. Das Gewicht verschiebt sich von dem, was jeder (einzelne) ohne Widerspruch als allgemeines Gesetz wollen kann, auf das, was alle in Übereinstimmung als universale Norm anerkennen wollen.«1
Die Diskursethik von Habermas hat für mich etwas sehr Befreiendes, weil sie uns von vorgefertigter Moral löst. Sie gibt uns einen Rahmen für den Vermittlungsprozess. Das Inhaltliche müssen wir uns immer wieder neu erarbeiten. Das Schlamassel mit der Freiheit ist halt nur, dass sie mitunter recht mühsam ist. Jede ethisch bedeutsame Frage immer wieder auszudiskutieren, erfordert viel Zeit, gedankliche Schärfe, ein ordentliches Maß an Besonnenheit und auch viel Geduld – insbesondere weil unser Zusammenleben aus mehr besteht als ein paar individuellen Beziehungen zu anderen Menschen, die ich vielleicht noch einigermaßen gelingend mit der Goldenen Regel auf die Reihe bekomme. Es wäre sehr viel bequemer, sich an ein paar vorsortierten Werten und Moralprinzipien zu orientieren, als ständig wieder vor neue Herausforderungen der Bewertung gestellt zu werden.
Selbstverständlich stehen wir nicht im werteleeren Raum. Über den modernen, aufgeklärten Gesellschaften flattert die Trikolore von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, oder moderner: Solidarität. Diese Leuchtsterne haben seit der Zeit der Aufklärung wenig an Strahlkraft verloren. Aber angesichts des nun schon länger andauernden Siegeszugs der neoliberalistischen Doktrin, der zufolge alles der freie Markt regelt, ist aus der Freiheit der Aufklärer eine Freiheit zur Selbstausbeutung geworden; mehr noch macht uns die Ökonomie der Aufmerksamkeit2 immer häufiger selbst zum Produkt. Gleichheit erfahren wir vielleicht nur noch vor dem Gesetz, während sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet. Und wenn die ertragsstärksten wirtschaftlichen Unternehmen sich auch dadurch auszeichnen, dass sie zum Gemeinwohl keine Steuerbeiträge leisten, wie steht es dann um die Solidarität? Erleben wir die nur noch, wenn wir in Krisenzeiten wie der Coronapandemie gemeinsam für die Heldinnen des Alltags klatschen? Wir haben nationalstaatliche Verfassungen, bei den Deutschen ist es das großartige Grundgesetz. Sein erster Teil, der die Grundrechte beschreibt, ist so klar und kraftvoll formuliert, dass er sich für mich wie das verfassungsrechtliche Pendant zu Beethovens »Ode an die Freude« anhört. Doch wie lebendig ist dieser Text heute noch? Wir haben einen verlässlichen, rechtsstaatlichen Rahmen und dazu noch tausende Gesetze und Verordnungen, die unser Zusammenleben klar regeln. Warum entsteht trotz dieser Fülle an zivilisatorisch hart errungenen Normen bei so vielen Bürgerinnen und Bürgern ein so tiefes Gefühl der Orientierungslosigkeit?
Im Werteforum haben wir dafür eine Begründung gefunden: Die Gesellschaft ist aus ihrer Balance geraten. Freiheit ist zu einem individuellen Gut geworden. Aus dem Recht auf einen selbstbestimmten Lebensentwurf in einer vielfältigen Gemeinschaft ist die Realität eines atomisierten Nebeneinanders3 unterschiedlichster Egoismen entstanden. Alles unterliegt dem Gesetz der Effizienz und der Steigerungslogik. Die Poesie des Lebens kommt unter die Räder – und mit ihr weite Teile des Erlebens von Verbundenheit. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Digitalisierung und ihre Begleiterinnen künstliche Intelligenz und Biotechnologien entwickeln und vernetzen, bringt uns zwischen technophilen Erlösungsträumen und endzeitlichen Horrorvorstellungen noch mehr ins Taumeln. Wir befinden uns in einer Gesellschaft ohne Haltegriffe. Wen soll es wundern, wenn da nach moralischen Keulen, einfachen Leitwerten und starken Führungsfiguren gerufen wird? Wenn sich die hinter diesen Rufen stehenden Wünsche allerdings erfüllen sollten, reiten wir uns nur noch tiefer in den Sumpf, gefährden unsere zivilisatorischen Errungenschaften, ersticken die Hoffnung, doch noch Wege für die anstehenden großen Herausforderungen zu finden. Insofern lohnt sich ein Blick auf die Grundwerte der verschiedenen Lebenswelten. Wenn wir diese erkennen, uns bewusst machen können, welche Werteerfahrungen die Lebenswelten verlässlich ermöglichen sollten, welche Handlungen, welche Ausdrucksformen und Eigenzeitlichkeiten sie haben und worin sich all dies von Lebenswelt zu Lebenswelt unterscheidet, ja sogar widerspricht, dann führt uns das zu einer Wertevielfalt, die einer ausdifferenzierten Gesellschaft viel gerechter wird als jeder Versuch, über alles eine Leitkultur zu stülpen. Wenn wir die autonomen Lebenswelten quasi buchstabieren lernen, zeigen sich uns ein paar Haltegriffe, neue Perspektiven der Orientierung und Wege, ein gutes Gespräch über Werte zu führen.
Dieser Zugang ist gleichzeitig ein Ausweg aus der moralisierenden Individualethik. Jede und jeder bleibt zwar verantwortlich für die eigenen Entscheidungen und Handlungen, kann sich aber der gemeinsamen Werte und Institutionen der autonomen Lebenswelten bedienen. Der Vorschlag des Werteforums ist, den Blick auf die Ethik des Sozialen, des Gemeinsamen zu richten. Womit wir uns in dem Modell anfreunden müssen, sind die mannigfaltigen Widersprüche und Konflikte zwischen den Lebenswelten. Was wir Werte nennen, wird erst wertvoll oder entpuppt sich als wertlos, wenn wir es in Beziehung zu etwas setzen. Das bedeutet nicht weniger als ein Abschied von absoluten Werten und universellen Geltungen. Das Leben in einer komplexen Welt kann aber nicht einfach sein, so gern wir das auch hätten. Einfache Rezepte sind bei technischen Problemstellungen sehr charmant, verstellen bei Fragen des Zusammenlebens aber in der Regel den Blick darauf, dass es sich dabei um einen ständigen Prozess der Veränderung handelt und dass es eine ideale Balance der Widersprüche nie geben wird.
Einfache Rezepte mag ich eigentlich nur in der Kulinarik – vor allem die Italiener haben mich begeistert, mit wenigen, aber guten Zutaten die köstlichsten Gerichte zuzubereiten. Damit sind wir wieder in der Küche angelangt. Eine meiner Töchter lebte ein paar Jahre in einem besonderen Wohnprojekt. Mitten im Kiez der sächsischen Großstadt gab es auch dort Regeln, zum Beispiel, welche Grundsätze für den Einkauf gelten. Das Besondere war, dass alle Entscheidungen für die gemeinschaftlichen Bereiche im Konsens getroffen werden mussten. Wer weiß, wie schwierig es schon ist, Mehrheiten zu bilden, kann sich vorstellen, um wie viel aufwändiger es ist, die Lösung zu finden, hinter der dann alle stehen. Schon bevor meine Tochter in diese große Wohngemeinschaft einzog, gab es den Plan, eine neue Küche zu bauen. Als sie ein paar Jahre später auszog, waren gerade einmal die ersten Materialien besorgt worden. Ob die WG-Küche inzwischen fertig ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Dass alle, die an dem Küchendiskurs beteiligt waren und sind, mir wahrscheinlich sehr viel über Werte und Diskursethik beibringen könnten, dessen bin ich mir sicher.
1 Jürgen Habermas: Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1983
2 Siehe auch: Georg Franck: Ökonomie der Aufmerksamkeit, Hanser, München/Wien, 1998.
3 Lesenswert dazu: Herbert Pietschmann: Die Atomisierung der Gesellschaft, European University Press, Wien, 2009.