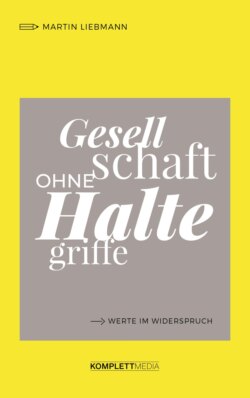Читать книгу Gesellschaft ohne Haltegriffe - Martin Liebmann - Страница 6
Privatleben – Vertrauen
ОглавлениеEine der beklopptesten Ideen, die ich je im Leben hatte, war, meine erste Firma in dem Haus unterzubringen, in dem ich mit meiner Familie wohnte. Heute kann ich es zugeben: Es war in Wirklichkeit keine Idee, sondern eine sich aus Ermangelung finanzieller Mittel ergebende Alternativlosigkeit. Ich habe mir den Arbeitsplatz im Privathaus trotzdem als eine bewusste Entscheidung vorgegaukelt. Wie pfiffig von mir, zwischen Bett und Büro nur ein paar Schritte gehen zu müssen, weder Zeit noch andere Ressourcen für den Weg zur Arbeit zu vergeuden und für ein Nickerchen auf dem Sofa nur einmal umkippen zu müssen. Und außerdem konnte ich immer in der Nähe meiner Kinder sein. Ich war begeistert von so vielen Vorteilen. Zudem erschien mir ein richtiges Büro damals als spießig. Homeoffice war ein noch weitgehend unbekanntes Wort, das trotzdem oder deswegen einen gewissen Glanz des Innovativen ausstrahlte, mit dem ich mich gern schmückte. Frohen Mutes und äußerst blauäugig habe ich mich auf den Holzweg gemacht und viele Jahre lang Dinge vermischt, die man nicht vermischen sollte. Hätte ich doch den von den vier Müttern und 61 Vätern des Grundgesetzes formulierten Artikel 13 ernster genommen! »Die Wohnung ist unverletztlich«, heißt es gleich zu Beginn des darin beschriebenen Grundrechts, gegen das ich jahrelang verstoßen hatte, denn ohne jegliche Gefahr in Verzug habe ich dort jemanden eindringen lassen, der unsere familiäre Privatsphäre ständig bedrohte: den Geist des Geschäftlichen. Zum Leidwesen vor allem meiner Kinder bemerkte ich kaum, dass dieser Geist mit dem, wofür unsere Familie da war, nicht einmal im Ansatz kompatibel ist. Wie sollen Kinder, die ihren Vater sehen, hören und sogar berühren können, es verstehen, dass er gerade nicht für sie da ist, weil ein wichtiger Kunde am Telefon ist, ein dringend zu erstellendes Konzept seine volle Aufmerksamkeit beansprucht oder er Rechnungen schreibt, die zur Begleichung der Miete und zum Auffüllen des Kühlschranks zwar notwendig, aber für den Nachwuchs nicht ansatzweise nachvollziehbar sind? Die Kinder machen vielmehr die Erfahrung, dass sie sich in der Wohnung nicht darauf verlassen können, die volle Aufmerksamkeit zu erhalten. Das mag zwar aus der Sicht von Vertretern eines strengen Erziehungsstils für das spätere Leben lehrreich sein, ist meiner Erfahrung nach für die Errichtung eines Wertefundaments in Bezug auf Vertrauen allerdings sehr kontraproduktiv. Natürlich können die Kleinen zu Hause nicht ununterbrochen die erste Geige spielen, selbst wenn die Liebe der Eltern zu ihren Kindern im Grunde genau das vermitteln will. Die Grenzen der unbedingten elterlichen Fürsorge sollten aber innerhalb der Familie gesteckt und ausgehandelt werden, indem etwa die Bedürfnisse der Geschwister oder auch der Eltern selbst die Anlässe und Gründe dafür liefern. Es ist für die Kinder schon schwierig genug nachzuvollziehen, wenn Mutter, Vater oder gar beide wegen ihrer Arbeit nicht körperlich greifbar sind. Trotz physischer Anwesenheit der Eltern abgewiesen zu werden, ist noch eine Nummer stärker und heißt: Es gibt hier etwas, das anscheinend wichtiger ist. »Sei ruhig, Mama muss arbeiten!« Ein Kind kann sich an so einen Satz zwar sehr schnell gewöhnen, die damit einhergehende Erfahrung hinterlässt allerdings Spuren in der Wahrnehmung von den Werten in der Lebenswelt Privatsphäre. So euphorisch das Homeoffice als moderne Arbeitsform gefeiert wird, so sehr trägt es zu einer für unsere Wertesysteme kritischen Vermischung bei.
Auch im Umgang mit der Zeit hat die Privatsphäre eine Logik, die der ökonomischen Taktung komplett entgegengesetzt ist. Gefühle, die typische Ausdrucksform der Privatsphäre, widersetzen sich jedweder Planung. Sie sind zeitlich unmittelbar. Wer traurig ist, einen Schmerz empfindet, dem hilft es nicht, per Termin später getröstet zu werden. »Ich muss jetzt noch drei Stunden diese verdammte Liste fertig machen, dann nehme ich dich in den Arm.« Das kann ebenso wenig funktionieren wie eine aufgeschobene Freude. Auch die will sofort mitgeteilt und geteilt werden. Sie, liebe Leserin oder lieber Leser, finden das übertrieben? Dann machen Sie doch einfach mal den Umkehrtest und stellen Sie sich vor, im Geschäftlichen den unmittelbaren Gefühlsteilungen den Vorrang zu geben. »Entschuldigung, ich kann gerade nicht kassieren, weil ich einen so traurigen Gedanken habe.« Abwegig, oder? »Das Meeting müssen wir verschieben, weil ich mich gerade so freue.« Auch unpassend, nicht wahr? Es ist schon eine gute Einrichtung, dass ich bei der Arbeit nicht ständig fühlen und zu Hause nicht ständig funktionieren muss.
Unsere Privatsphäre, sei sie als Familie, als Partnerschaft oder eine wie auch immer selbst gewählte Lebensgemeinschaft gestaltet, genießt einen triftig begründeten Schutz. Sie ist das Habitat eines für unser Leben so wichtigen, ja elementaren Wertes: Vertrauen. Die Lebenswelt der Privatsphäre hat sich förmlich um diesen Wert herum entwickelt. Vertrauen ist gleichermaßen ihre Quelle und ihr Ziel. Nur in der Privatsphäre können wir substanzielle Erfahrungen von Hingabe und Geborgenheit machen, nirgends sonst werden uns Herkunft und Zugehörigkeit so gehaltvoll gewahr. Die Ästhetik der Privatsphäre unterscheidet sich deutlich von der Beschaffenheit anderer Lebenswelten, in ihr lieben wir, in ihr sorgen wir füreinander. Sie ist der Hort, in dem wir unsere Gefühle ausdrücken. Selbstverständlich nehmen wir all dies auch mit in die anderen Lebenswelten, die wir als einzigartiges, ganzes Individuum betreten und wieder verlassen. Das Lebensweltenmodell will uns nicht zu multiplen Persönlichkeiten machen. Es geht vielmehr darum, bestimmte Werte verlässlich verorten zu können. Das gibt uns komplexen Wesen in einer komplexen Welt Orientierung. Die Privatsphäre mit ihren Institutionen der Familie und der Intimität ist der Ort, an dem der Wert Vertrauen kultiviert wird – und verlässlich erlebbar sein sollte. Auch wenn uns das süffisanterweise auf den Dollarscheinen gedruckte Motto der Vereinigten Staaten von Amerika, »In God We Trust«, etwas anderes weismachen will, sind es weder himmlische Wesen noch irdisches Geld, die uns Vertrauen geben, weil wir uns seit der Aufklärung für Hingabe und Geborgenheit eine andere Institution aufgebaut haben.
Ihre Stärken machen die Privatsphäre gleichzeitig attraktiv für Übergriffe aus anderen Lebenswelten, allen voran aus der Wirtschaft. Kaum ein Werbeblock im Fernsehen ist frei von weichgezeichneten Familienbildern, als könnten wir zusammen mit den angepriesenen Produkten Erfahrungen familiärer Werte käuflich erwerben und damit unsere Gefühle in einen harmonischen Wohlklang bringen. Es müssten bloß die richtigen Süßigkeiten, Cerealien, Nudeln und Fertiggerichte in unserem Einkaufswagen landen, schon wäre unsere private Welt komplett in Ordnung. Mehr noch gaukeln uns die Bilder quasi einen Idealzustand vor, an dem wir unser Leben zu orientieren haben. Die Familie als widerspruchsfreie Zone, weit weg von dem, was Intimität ausmacht. Die Lebenswelt des Privaten zeichnet sich aber gerade durch die Dinge aus, die sich nicht kaufen lassen. Das wirklich Private entzieht sich dem Konsum. Seine Rituale entspringen einer bedingungslosen, hingebungsvollen Liebe, die sich in mannigfaltigen Facetten äußern – und wie wir alle wissen nie durchgängig harmonisch, wie die heile Welt der Werbung uns weismachen will. Das Private braucht keine Vergleiche mit anderen, um seine Werte erfahrbar zu machen. Es ist ein Raum frei von Kalkül.
Das Private birgt auch interessante Geheimnisse – etwa unsere Vorlieben, Schwächen, Stärken, Stimmungen und geheimen Wünsche. Auf diese Geheimnisse sind einige Unternehmen besonders scharf. Und während es dem Staat mit seiner Exekutive verboten ist, in unsere vier Wände einzudringen, öffnen wir den mächtigsten Datenkraken die Türen ins Allerheiligste. Sie wissen, was wir im Netz suchen, und sind mit ihren Algorithmen bereits in der Lage, aus diesen Informationen auf intimste Sachverhalte zu schließen, wissen gar schon vor dem ersten Schwangerschaftstest, dass im Bauch ein Embryo heranreift. Sie hören mit und merken sich genau, was wir in die smarten Lautsprecher hineinrufen, welche Musik wir hören, welche Filme wir sehen wollen und was uns sonst noch so alles interessiert. Sie schleichen sich so nah an uns heran, dass sie sogar Einlass in unsere Schlafzimmer bekommen und uns mit ihren Sensoren scheinbar so hilfreiche Informationen zur Verfügung stellen, wie gut wir geschlafen haben. Ob sie eines Tages sogar unsere Träume aufzeichnen und verwerten werden? Die Entäußerung des Privaten in die Hände kommerzieller Datenverwerter ist ein weitgehend durch selbstverschuldete Nachlässigkeit und eigenes Desinteresse zugelassener Eingriff in unsere Selbstbestimmung – und damit auch ein direkter Angriff auf unsere freiheitliche Demokratie. In den schützenswerten Raum, den wir bewusst nur mit denen teilen, denen wir bedingungslos vertrauen, lassen wir anonyme Organisationen eintreten, von denen wir wissen sollten, dass sie uns weder lieben noch sich um uns sorgen, sondern uns in Form unserer Daten selbst zum Produkt machen. Wenn alles, wie so gern gefordert wird, transparent wird, ist der Weg nicht mehr weit, bis die Maschinen uns vorrechnen, was die richtigen Entscheidungen für uns sind, womöglich sogar, wem wir vertrauen können. Die technischen Möglichkeiten dafür sind inzwischen wahrscheinlich ausgereift genug und entwickeln sich in atemberaubendem Tempo weiter.
Das Private wurde und wird mit der immer weiteren Zunahme der digitalen Publikationsmöglichkeiten immer häufiger öffentlich; ein Ende ist nicht abzusehen. Inzwischen reicht ein Smartphone aus, um der ganzen Welt Einblicke in unser intimes Leben zu gewähren. Was früher Klatschreporter und Paparazzi meist gegen den Willen der von ihnen in den Fokus genommenen Royals und Stars in bunten Heftchen zutage förderten, was später in vorgeblich Anteil nehmenden Dokusoaps und menschenverachtenden Realityshows über die Fernsehschirme flimmerte, wird heute von vielen Menschen freiwillig selbst offenbart. Mit zunehmendem Maß, in dem das Private, das geschützt werden sollte, sich exhibitionistisch im digitalen Netz inszeniert, wird es banaler. Statt auf eine bedingungslose Liebe vertrauen zu können, muss man um eine öffentliche Zuneigung kämpfen. Was diese Ökonomie der Aufmerksamkeit mit unserem Selbstwertgefühl anrichtet, ist verheerend. Abhängig von oberflächlichen Kontakten rücken Erfahrungen von Liebe und Vertrauen ins Unerreichbare, weil sie eben nur in intimen Beziehungen gemacht werden können.
Der Grundwert der Lebenswelt Privatsphäre hat in anderen Bereichen Hochkonjunktur. Das Buhlen um unser Vertrauen ist gewaltig. Ganz unverfroren behaupten zum Beispiel einige Geldinstitute, die an anderer Stelle in erster Linie den Renditeerwartungen ihrer Aktionäre verpflichtet sind und zu diesem Zweck so gut wie alles verkaufen, wenn es denn Profit bringt, dass etwa Vertrauen der Anfang von allem sei. Wirft man einen Blick auf die Entstehungsgeschichte der Banken, liegt darin sogar ein wahrer Kern. Je zuverlässiger sich die Kaufleute sein konnten, dass das Zahlungsversprechen der Banken auch eingehalten wird, desto sicherer konnten sie ihre Handelsbeziehungen aufbauen. Das Geschäftsmodell hat sich allerdings deutlich über die Bürgschaft bezüglich der Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit ausgeweitet. Das Geld ist selbst zur Ware, die Finanzmärkte in weiten Teilen ein großes Casino geworden. In diesem Zusammenhang noch von Vertrauen als höchstem Wert zu sprechen, führt schnell zu einer Inflation des Begriffs Vertrauen. Je höher der Wert angepriesen wird, desto tiefer sitzt die Enttäuschung, wenn das Versprechen nicht eingelöst wird. Das gilt auch für die Marken, die in unserer unübersichtlichen Welt konsumierbare Zugehörigkeit anbieten. Wie auf einem großen Basar können wir uns entscheiden, welche Logos und dahinterstehende Versprechen und Haltungen wir uns anheften. Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens lautet der Titel des nach wie vor gültigen Grundlagenwerks der Markenführung. Doch während sein Verfasser Hans Domizlaff noch erklärte, wie es gelingt, Vertrauen in die Qualität einer Schokoladenmarke zu erwecken, werden Marken heute in ausgetüftelte Konstrukte von Werten, Haltungen und ganzen Bedeutungswelten verflochten, um unser Vertrauen zu gewinnen. Das ist an sich nicht verkehrt, nur werden es Unternehmen nie schaffen, ein fundamentales Vertrauen aufzubauen, allein schon, weil sie ihre Bindekraft immer wieder neu herstellen und beweisen müssen. Während Eltern ihre Kinder und umgekehrt Kinder ihre Eltern – von einigen Ausnahmen abgesehen – auf ganz natürliche Weise lieben, sind Unternehmen auf ihre Kunden lediglich wirtschaftlich angewiesen. Liebe, Hingabe und Fürsorge bleiben für Beziehungen, die auf einem kalkulierten Handel begründet sind, immer zweckgebundene Konstruktionen, sind niemals unbedingte Gefühle. Da können uns Fastfoodketten noch so oft einreden, dass wir ihre Bulettenbrötchen liebten, Fernsehsender uns ohne Unterlass weismachen, dass sie es liebten, uns zu unterhalten, und Hersteller von angeblich kleinen Automobilen uns noch so oft fragen, ob es wohl Liebe sei, die wir für ihre Blechkisten fühlen – sie werden es doch nicht schaffen, unser Intimstes zu berühren. Stattdessen entwerten sie durch die ständige Wiederholung ihrer Anmaßungen ganz schamlos die für ein erfülltes Leben so wichtigen Empfindungen zu bloßen Kaufreizen.
Auf unser Wertesystem und unsere Orientierung wirken die Übergriffe des Ökonomischen in die Welt des Privaten und die Entgrenzung des Digitalen wie ein schleichendes Gift. Je mehr die Privatsphäre zum ökonomischen Handelsplatz missbraucht und durch digitale Datensammlungen und freiwillige Entblößung transparent gemacht wird, desto weniger verlässlich können wir die ihr zugewiesene Grundwerterfahrung von Vertrauen machen. Dieser Effekt hat fatale Folgen, sowohl für uns als Individuen als auch für unsere Gesellschaft. Stück für Stück demontiert er die Grundlage unserer Selbstbestimmung und macht unsere gesamte Gesellschaft anfällig für antidemokratische Entwicklungen, die unser zivilisatorisches Projekt in seiner Weiterentwicklung gefährden.
Hoffentlich kein Dauerzustand wird das während des Coronavirus-Shutdowns praktizierte Homeschooling werden, das notgedrungen die Institution Schule in die privaten vier Wände verlegt hat. Die Institution Schule – ich komme im entsprechenden Kapitel darauf zurück – ist eine wertvolle Errungenschaft unserer modernen Gesellschaft. In ihr geht es um etwas vollständig anderes als im Privatleben. Sie richtet sich nach außen, auf die Begegnung mit der Welt. Persönlich empfinde ich es ja schon als Zumutung, Kindern Aufgaben mit nach Hause zu geben. Zu meinen Schulzeiten habe ich mich zwar ohne philosophischen Hintergrund, aber doch sehr erfolgreich gegen diese Unart gewehrt, indem ich die Hausaufgaben intuitiv zu Bus- oder Pausenaufgaben umgedeutet oder einfach gar nicht gemacht habe. Eine Verlängerung des Klassenzimmers in mein Allerheiligstes erschien mir schon damals suspekt. Später, als Vater einiger Kinder, wurde daraus eine abgrundtiefe Ablehnung. Die leidigen Diskussionen, dass sie gemacht werden müssen, zogen sich oft ergebnislos bis in die Nacht. Die Hausaufgaben wurden zu ungebetenen Eindringlingen in das Familienleben und nahmen Platz in Anspruch, den wir gut, sehr gut für anderes gebraucht hätten. Hätte ich jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, schulpflichtige Kinder, für die ich wegen der langen Schulschließungen in der eigenen Wohnung zum Lehrer werden müsste, würde ich wahrscheinlich durchdrehen. Ich würde unter diesen Umständen sogar an einem meiner Lebensmottos zweifeln, dem fröhlichen Scheitern. Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass das schulische Lernen einen eigenen Ort hat, der eben nicht der heimische Küchentisch ist. Selbstverständlich kommen dort auch Fragen zur Welt zur Sprache. Das ist sehr inspirierend und belebt den familiären Zusammenhalt. Aber der Lehrplan sollte draußen und das Unterrichten den Profis vorbehalten bleiben.
Die beschriebenen Erosionen der Lebenswelt Privatsphäre werfen die Frage auf, wie sich deren Institutionen schützen und weiterentwickeln lassen. Unsere Lebensentwürfe sind nicht mehr so eindimensional wie noch vor Jahrhunderten oder selbst Jahrzehnten. Die »normale« Familie ist nur noch für einen Teil der Menschen Lebensrealität. Kinder wachsen in Patchworkfamilien oder nur bei einem Elternteil auf, der Anteil an Singlehaushalten steigt beständig, vor allem in den Großstädten, und angesichts des für viele unbezahlbar gewordenen städtischen Wohnraums ist die Wohngemeinschaft eine beliebte Lebensform. Vereinzelt gibt es auch Wohnprojekte, in denen zum Teil sogar generationenübergreifend versucht wird, neue Formen des Privatlebens auszuprobieren. Manche wahren dabei die Intimsphäre strikt, andere setzen auf mehr Nähe mit ihren Wahlverwandten. Ich erachte solche Versuche als besonders wertvoll für unsere Gesellschaft, nicht zuletzt weil sie uns neue Erfahrungsräume jenseits nationaler Zugehörigkeiten oder Herkünfte und einer biederen Geborgenheit öffnen. Vielleicht fragen wir auch einfach häufiger unsere Kinder, anstatt sie mit Spielzeug und digitaler Ablenkung zu überschütten. Beim Lübecker Werteforum hatten wir eine schöne Projektidee. In der Petrikirche wollten wir 30 Kinder zehn ideale Kinderzimmer gestalten lassen. Diese zehn in Boxen installierten Wunschräume sollten – durch Schauspielerinnen und Schauspieler belebt – eine eindrückliche Gesamtausstellung ergeben, in der die Besucherinnen und Besucher sich der Lebenswelt des Privaten sinnlich annähern können. Ich bin mir sicher, dass wir viel gelernt hätten, was in dieser Lebenswelt wirklich wichtig ist.
Rezepte anzufertigen und Ratschläge zu geben, wie ein gutes Privatleben aussehen könnte, liegt mir fern. Die nachstehende Tabelle der Lebenswelt zu reflektieren, könnte aber vielleicht eine hilfreiche Orientierung sein. Diese autonome Lebenswelt gegen Angriffe von außen zu verteidigen und gegenüber Überfrachtungen mit Werten aus anderen Lebenswelten zu schützen, erscheint mir als ein guter Ansatz. Und wenn Sie wieder einmal ein Gespräch über den Wert Vertrauen führen, erinnern Sie sich vielleicht daran, wo er verortet sein könnte, wo er konstitutiv ist und wo er eine untergeordnete Bedeutung hat.
Ich schreibe dieses Kapitel übrigens wieder im Homeoffice. Seit vollen zwei Monaten habe ich wegen der Ausgangsbeschränkungen die Lebenswelt »Privatsphäre« nur für ein paar kleine Fahrradtouren verlassen. Ich habe keine spirituelle Stätte betreten, habe keinen Fuß in die Universität gesetzt, weder eine Ausstellung besucht noch ein Konzert gehört, weiß schon gar nicht mehr, wie mein Büro aussieht, war in keinem Laden, habe mein politisches Engagement temporär gezügelt und nicht einmal Freunde besucht. So schön es ist, das Vertrauen, die Liebe und die Geborgenheit zu Hause zu spüren, so sehr wird mir bewusst, dass das nicht alles ist, was mein Leben ausmacht, was uns erfüllt. Allein die Sache mit dem Nichteinkaufen könnte ich noch Monate weiter durchziehen, solange meine Liebste uns etwas zu essen besorgt. Ansonsten wird es Zeit, die anderen Lebenswelten wieder zu betreten. Alles nur zu Hause zu machen, wäre wahrlich bekloppt.