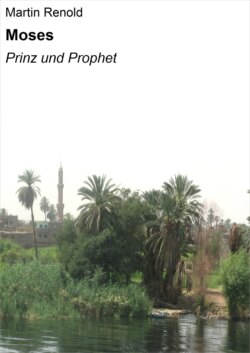Читать книгу Moses - Martin Renold - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Geburt des Moses
ОглавлениеHaremhab war tot. Er war der Letzte der 19. Dynastie gewesen. Nicht Blutbande hatte ihn mit dieser verbunden. Der ehrgeizige Feldherr unter Eje, seinem Vorgänger und Schwiegervater, hatte sich nach dessen Tod mit Hilfe des Militärs der Krone bemächtigt. Er war mit Mutnjedemet, der Tochter Ejes, verheiratet, hatte aber keine Nachkommen. Deshalb wurde Ramses, Haremhabs militärischer Stellvertreter, zum Pharao erwählt. Und im ganzen Land verkündeten Herolde, dass er als Nachfolger des verstorbenen Haremhab zum König über beide Reiche – Ober- und Unterägypten – gekrönt werden solle.
Ramses war mit Satre verheiratet. Er hatte einen Sohn, Seti, der mit der jungen Tuja, der Tochter eines Streitwagenoffiziers, verheiratet war, und eine jüngere Tochter, die den lieblichen Namen Henut-taui trug.
Die Nachricht von Ramses’ Krönung gelangte auch in die Provinz Gosen, wo Amram und Jochebed wohnten.
Amram war ein Nachkomme jenes Levi, der vor Generationen mit seinen Brüdern aus Hebron nach Ägypten gekommen war, um im Auftrag ihres alten Vaters Jakob bei den Ägyptern Korn zu kaufen, weil in ihrer Heimat eine lang andauernde Hungersnot herrschte.
Aus der Heiligen Schrift ist bekannt, dass sich Jakob und seine Söhne in Ägypten ansiedelten, wo sie und ihre Nachkommen sich während vierhundert Jahren vermehrten. Sie selbst nannten sich Volk Israel, weil Gott selbst dem Isaak, Jakobs Vater, den neuen Namen Israel gegeben hatte. Von den Ägyptern aber wurden sie Hebräer genannt, weil sie aus Hebron stammten.
Die Gegend von Gosen war ein fruchtbares Weideland. Früher waren die Hebräer Hirten gewesen. Auf den Weiden hüteten sie ihre Schafe und Ziegen. Doch das Volk vermehrte sich so sehr, dass der begrenzte Boden, auf dem immer zahlreichere Wohnstätten entstanden, bald nicht mehr genug für den Lebensunterhalt hergab. Die späteren Könige fürchteten, die Hebräer könnten als Volk am nordöstlichen Einfallstor zu Ägypten zur Gefahr werden. Deshalb begannen sie, die Männer in die Steinbrüche und Ziegeleien zu holen, wo sie zu harter Arbeit gezwungen wurden.
Amram und Jochebed wohnten in einer ärmlichen Lehmhütte am Rand einer Siedlung. Es war die letzte Hütte gegen ein ausgedehntes Weideland, das sich im Westen bis zum Palast des Pharaos hin erstreckte. In den Morgenstunden, wenn die Hitze der Sonne noch nicht die Luft zum Flimmern brachte, konnte man in der Ferne die Bäume im Park des Königs sehen, der seinen Palast umschloss.
Nun muss man wissen, dass die Könige Ägyptens zu gewissen Zeiten in Memphis in Unterägypten regierten, zu anderen Zeiten aber in Theben in Oberägypten. Damals hatten diese Städte noch andere, ägyptische Namen. Erst die Griechen, die tausend Jahre später unter Alexander dem Großen nach Ägypten kamen, gaben den Orten und den Pharaonen neue, griechische Namen.
Amenhotep – oder Amenophis, wie später die Griechen ihn nannten –, der Vater des Echnaton, hatte seinerzeit die Hauptstadt von Memphis nach Theben verlegt. Doch Echnaton hatte eine eigene Hauptstadt erbaut, die in der Mitte zwischen den beiden alten Hauptstädten lag. Die Nachfolger Echnatons, Tutenchamun und Eje, regierten das Land wieder von Theben aus. Haremhab jedoch, schon unter Echnaton Oberbefehlshaber des Heeres, hatte sich, unter dem Vorwand, die Truppen müssten im Delta die Grenze verteidigen, geweigert, nach Achet-Aton zu ziehen.
Als er Pharao geworden war, hatte er sich außerhalb von Memphis einen Palast gebaut, der ihm als Residenz diente, wenn er auf seinen alljährlichen Reisen nach Unterägypten in Memphis weilte. Der alte Königspalast aus der Zeit von Amenhotep III. war unwohnlich geworden und diente ihm anfänglich nur noch für offizielle Empfänge. Erst in späteren Jahren ließ er die Residenz in Memphis niederreißen und neu erbauen.
Jetzt, nach dem Tod von Haremhab, war sein Heerführer Ramses zum neuen Pharao erkoren worden. Auch Ramses hatte die meiste Zeit als Truppenführer im Nildelta verbracht, wo die größere Gefahr von feindlichen Angriffen bestand als im Süden, von Nubien her. Deshalb wollte er die Hauptstadt wieder endgültig von Theben nach Memphis verlegen. Doch auch er wollte den Königspalast in der Stadt nur für die Regierungsgeschäfte und Empfänge benutzen. Seine Familie sollte Haremhabs Palast am Rande von Gosen bewohnen.
Zwischen den armseligen Lehmhütten der Siedlung, wo Amram und Jochebed wohnten, war wenig Platz. Doch rund um die Häuser wuchs Gras auf dem angeschwemmten Land des Nils, wo einige Schafe und Ziegen weideten. Auch Jochebed hatte ein Schaf wie viele andere Frauen, deren Männer in den Steinbrüchen oder Ziegeleien arbeiteten. Das gab etwas Milch für die Kinder und Wolle. Und zu den Festtagen gab es im Dorf immer ein paar Lämmchen, die bei dem gemeinsamen Opfer dem Herrn dargebracht werden konnten.
Wie viele seiner Glaubensbrüder arbeitete auch Amram in einem Steinbruch auf der östlichen Seite des Nils, da, wo die Ebene des Deltas aufhört und sich die kahlen Felsen zu erheben beginnen. Auch sein Vater und sein Großvater hatten schon dort gearbeitet. Den Hebräern blieb nichts anderes übrig, als Steine für die Tempel und Paläste und die Standbilder der Gottheiten und Könige aus dem Fels zu schlagen und zu bearbeiten oder Lehmziegel herzustellen. Die eine Arbeit war so schlimm wie die andere. Kräftigere Männer wurden in den Steinbrüchen in den Bergen eingesetzt, die anderen mussten in der Nähe des großen Flusses aus Nilschlamm Ziegel formen, die je nach ihrer Bestimmung mit Stroh gemischt waren und getrocknet oder gebrannt wurden. Ob in den Bergen oder am Nil, sie alle wurden von Peitschen schwingenden Aufsehern zur Arbeit unter der glühenden Sonne angetrieben.
„Für uns wird das keine Wende zum Guten sein“, sagte Amram zu seiner Frau Jochebed, als sie von Ramses’ Wahl zum König erfuhren.
„Ich fürchte, du hast Recht“, antwortete Jochebed ihrem Mann. In ihrem Gesicht drückte sich Hoffnungslosigkeit aus. Wie gerne hätte sie ihrem Mann gewünscht, dass unter einem neuen Pharao sein hartes Los sich zu Besserem gewendet hätte! Unter Haremhabs langer Regierungszeit – sie kannte keine andere – hatte sich nie etwas gebessert. Sie war noch zu jung. So weit sie sich erinnern konnte, war Haremhab König von Ägypten gewesen. Tutenchamun und Eje kannte sie nur dem Namen nach. Von Echnaton – von dem niemand offen sprach – hatte sie, nachdem Amram sie zur Frau genommen hatte, nur gerüchteweise gehört.
Amram klagte nur selten, wenn er nach tage- oder wochenlanger Arbeitszeit nach Hause kommen durfte. Doch sie sah es ihm an, dass er unter der harten Arbeit litt. Jetzt, da Haremhab tot war, hätte sie gerne für ihn gehofft. Doch die von Generation zu Generation übernommene und unter Schweiß und Schlägen in die Seelen der Männer eingebrannte Erfahrung ließ auch den Frauen keine solche Hoffnung.
„Es ist doch mit jedem neuen Pharao nur schlimmer geworden“, sagte Amram. „Weißt du nicht mehr, wie unsere Großväter von ihrer Zeit unter Amenhotep erzählt haben? Auch sie mussten streng arbeiten in den Steinbrüchen. Am besten hatten es jene, die beim Bau der Tempel und Paläste eingesetzt wurden. Sie waren geachtet, und auch ihrer Hände Arbeit wurde hoch geschätzt und so entlohnt, dass sie und ihre Kinder ohne Sorgen leben konnten. Doch schon unter seinem Sohn Echnaton wurde es schlimmer.“
Anders als die Ägypter wagte Amram diesen Namen auszusprechen, hatte Echnaton doch nicht seinen Gott beleidigt, sondern die Götter der Ägypter, denen nichts lieber war, als diesen Ketzer zu vergessen.
„Ja“, antwortete Jochebed, „zuerst dachten unsere Großväter und Väter, unter ihm würden sie weiter so leben können, wie sie es gewohnt waren – im Schweiße ihres Angesichts, aber auch in Dankbarkeit gegenüber dem gütigen Pharao, der ihnen Arbeit, eine bescheidene Hütte, Kleider und Brot gab. Aber dann mussten viele von ihnen wegziehen und dem Pharao seine neue Stadt bauen.“
„Ich erinnere mich, als ich noch ein Kind war“, fuhr Amram fort, „wie mein Vater von dem Umzug sprach. Die Männer wurden von ihren Frauen und Kindern getrennt. Auf Schiffen wurden sie auf dem Nil an die Stelle gefahren, wo die neue Stadt entstehen sollte. Es war eine raue, wüste Gegend, da, wo noch kein Mensch vorher hatte siedeln wollen. Und nun mussten unsere Leute innerhalb eines Jahres eine Stadt bauen mit einem Königspalast, Wohn- und Lagerhäusern und einem Hafen. Echnatons Aufseher trieben sie mit Peitschen zur Eile an. Sie hatten keine Zeit, Steine aus den Felsen zu schlagen. Es musste mit Lehmziegeln gebaut werden, nur damit alles schnell ging und der Pharao von hier aus sein Volk regieren konnte. Als die Stadt Achet-Aton gebaut war, durften manche zurückkehren. Viele aber mussten bleiben, und etliche hatten die Strapazen nicht überstanden und starben fern von ihren Familien. Aber auch jene, die heimkehrten, wurden gleich wieder unter ein neues Joch gespannt.“
„Und zuerst hatten unsere Väter und Mütter gedacht, Echnaton sei ein gütiger Herrscher und freundlich zu uns Hebräern, weil er wie wir nur einen einzigen Gott verehrte“, sagte Jochebed. „Doch schon bald merkten sie, dass dem nicht so war. Denn sein Gott war nicht unser Gott, nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sein Gott war nicht anders als die anderen Götter der Ägypter. Er war nur einer von ihnen. Echnaton betete die Sonne an, nicht den wahren Gott, den unsichtbaren, der sich unsern Vätern offenbart hat.“
„Er war ein grausamer Herrscher“, erinnerte sich Amram. „Er verbreitete seinen Glauben mit Gewalt. Wer nicht an Aton glaubte, wurde getötet. Die Tempel der anderen Götter wurden geschändet. Nicht nur wir Hebräer stöhnten unter seiner Schreckensherrschaft. Auch das ägyptische Volk litt unter ihm. Um nicht verfolgt zu werden, wurden viele zu Heuchlern. In der Öffentlichkeit bekannten sie sich zu Aton, im Geheimen aber beteten sie weiter ihre alten Götter an und hielten Statuen ihres Lieblingsgottes versteckt. Doch jetzt geht es den Ägyptern wieder so gut wie zu Thutmosis’ und Amenhoteps Zeiten. Nur wir Hebräer werden unterdrückt, weil wir ihnen fremd sind.“
„Es ist ja wahr“, seufzte Jochebed, „wir sind Fremde in diesem Land.“
„Und wir vermehren uns immer mehr“, unterbrach sie Amram. „Das macht den Ägyptern Angst. Deshalb zwingen sie uns zur Arbeit wie Sklaven. Haremhab hat uns geholt, damit wir seinen Palast und die alte Residenz in Memphis neu erbauen. Hat ihn Echnaton auf den Geschmack gebracht, uns mit immer neuen Bauten zu beschäftigen, um uns so unter seiner Kontrolle zu halten? Wer weiß, ob nicht Ramses wieder eine neue Stadt bauen will.“
„Es ist ja gut“, meinte Jochebed, „wenn die Männer immer genug Arbeit haben, aber je mehr sie euch schinden, umso mehr werden wir auch von den Ägyptern verachtet und erniedrigt. Auch wir Frauen und unsere Kinder leiden unter den Anfeindungen.“
„Gott der Herr wird uns helfen“, versuchte Amram sie aufzumuntern. „Wir dürfen den Glauben nicht verlieren. Eines Tages wird er uns zurückführen in das Land unserer Urväter.“
„Mögest du Recht haben“, sagte sie, „aber ob wir das noch erleben werden?“
Amram wusste keine Antwort mehr. Er zuckte nur die Achseln. Auch er mochte nicht so recht daran glauben, dass sich dies noch zu seinen Lebzeiten erfüllen würde.
Wenn Amram oft wochenlang in den Steinbrüchen war, lebte Jochebed allein mit ihrer Tochter und ihrem Sohn. Mirjam war schon zehn Jahre alt und ein hübsches Kind mit schwarzen Locken. Aaron war vier Jahre alt und ein aufgeweckter Knabe. Er trieb sich gerne mit den gleichaltrigen Jungen in der Siedlung umher. Er war groß für sein Alter und spielte sich als Anführer auf. Wenn er dann schmutzig und verschwitzt vom Spielen zum Essen nach Hause kam, hatte Jochebed ihre liebe Mühe mit ihm. Nur ungern ließ er sich Hände und Gesicht waschen, und sein Mund sprudelte nur so über von dem, was er von seinen Abenteuern mit den anderen Jungen zu berichten wusste.
Unter dem Herzen trug Jochebed ein weiteres Kind. Sie freute sich auf seine Geburt, auch wenn sie oft in Sorge war wegen der schlechten Zeiten. Was wusste man denn, was den Kindern noch bevorstand? Gerade jetzt, da der alte Pharao gestorben war und ein neuer kommen sollte. Von ihm hieß es, dass er besonders den Gott Seth verehre. War nicht das schon ein schlechtes Zeichen? Zwar kannte sie sich nicht aus mit den Göttern der Ägypter, aber es hieß, dieser Gott sei ein schrecklicher Gott, der einen anderen Gott, den Osiris, umgebracht habe. Sie konnte nicht verstehen, wie ein Gott einen anderen töten könne, doch da sie ohnehin nicht an diese Götter glaubte, wäre es ihr eigentlich gleichgültig gewesen. Aber einem Herrscher, der einen solchen Gott verehrte, war ebenso Schlimmes zuzutrauen. Wie wird dies alles noch enden?, dachte Jochebed im Stillen.
Die Krönung des neuen Pharaos wurde im Land mit großen Festlichkeiten begangen, bei denen viel Bier, vom gütigen Pharao gespendet, getrunken wurde. Für das ägyptische Volk gab es nichts Schöneres, als im Rausch für ein paar Tage den auch für sie nicht einfachen Alltag zu vergessen. Und die Herrschenden sahen es gerne, wenn die Untertanen solche Festgeschenke mit dankbarem, einfältigem Sinn annahmen.
Die Hebräer berührte dies wenig. Sie hatten nur einen Tag lang nicht zur Arbeit in den Steinbrüchen oder Ziegeleien und auf den Bauplätzen gehen müssen. Nicht ihretwegen war ihnen dieser freie Tag geschenkt worden. Die Aufseher, die Ägypter waren, sollten mit dem Volk feiern. Doch schon am nächsten Tag und an den folgenden, an denen das gehobenere Volk und der Adel noch weiterfeierten, hatten die Aufseher wieder anzutreten und über die Arbeit der Hebräer mit aller Strenge zu wachen.
Der neue Pharao jedoch begann schon bald nach seiner Krönung und dem Fest, sich Gedanken zu machen, wie er sein Reich noch besser regieren könne, als dies sein Vorgänger Haremhab getan hatte. Wie dieser wollte auch er Tempel bauen, Tempel für Seth und vielleicht, damit das Volk mit ihm zufrieden sei, auch einen für Osiris. Arbeitskräfte gab es ja mehr als genug. Ja, wirklich: viel zu viele. Solange sie beschäftigt waren, regten die Leute sich nicht über sie auf, aber an den freien Tagen, wenn sie in die Stadt und auf die Märkte kamen, fielen sie doch ziemlich stark auf. Und da waren ja auch noch ihre Frauen und Kinder. Auch wenn die meisten in eigenen Siedlungen lebten, kamen sie, wenigstens ein Teil von ihnen, mit den anderen Leuten in Berührung. Man begegnete ihnen mit Argwohn, und es gab viele Gerüchte. Man wusste ja nicht, wie sie in ihren Siedlungen lebten. Doch in der Phantasie dachte man sich seltsame Dinge aus. Sie sahen anders aus und waren ärmlich und nicht wie die Ägypter gekleidet. Zudem glaubten sie an einen anderen Gott. Das war früher nie ein Problem gewesen. Die Ägypter hatten den Fremden immer gestattet, an ihre eigenen Götter zu glauben und ihnen Stätten zu errichten, wo sie sie verehren und ihnen opfern konnten, ob sie nun Baal, Ishtar oder Astarte hießen. Aber die Hebräer glaubten an einen seltsamen, namenlosen und unsichtbaren Gott. Und sie behaupteten, außer ihm gebe es keinen anderen. Dasselbe hatte schon Echnaton behauptet. Und Echnatons Glaube an einen einzigen Gott war zumindest seit Eje und Haremhab verfemt und verboten.
Weshalb versteckten diese Hebräer ihren Gott? War das nicht verdächtig?
Ramses rief seine Getreuen zu sich, um sich mit ihnen zu beraten. Sie kamen herein in den Thronsaal, die Beamten und Berater mit ihren schönen Titeln, die oft gar nicht das Amt bezeichneten, das sie in Wirklichkeit ausübten: der Königliche Schreiber, der Erste Sandalenträger, der Fächerträger zur Rechten des Königs, dazu der Oberste Heerführer, der Schatzmeister und verschiedene weitere Persönlichkeiten wie der Oberste Aufseher aller Bauten, der Zeremonienmeister und die Magier. Auch Seti, der Sohn des Pharaos, war dabei. Ihn hatte Ramses schon kurz nach seiner Krönung zum Hohepriester des Gottes Seth ernannt.
Alle außer Seti, der in stolzer Haltung und selbstgefälliger Miene neben dem Thron seines Vaters stand, warfen sich vor Ramses auf den Boden und warteten, bis er mit dem Fuß das Zeichen zum Aufstehen gab.
Ramses saß in majestätischer Haltung auf dem Thron, in seine kostbaren königlichen Gewänder gekleidet. Auf dem Haupt trug er zwar nicht die Doppelkrone wie bei Staatsanlässen, aber das Königskopftuch. Dies, und dass er alle seine wichtigsten Berater geladen hatte, bedeutete, dass es um eine wichtige Sache ging.
„Was wisst ihr über die Hebräer?“, fragte er sie, als sie sich erhoben und um ihn versammelt hatten. „Was wisst ihr von ihrem Gott?“
Ramses schaute sich in der Runde um und wartete auf eine Antwort. Schließlich blieb sein Blick auf dem Ersten Sandalenträger haften. Er war für die inneren Angelegenheiten zuständig. Ramses hatte ihn zu diesem Amt ernannt, nachdem er den Träger dieses Titels wegen dessen hohen Alters nach dem Tod von Haremhab verabschiedet hatte. Suten Hamu, dies war der Name des von Ramses ernannten Ersten Sandalenträgers, hatte schon unter Haremhab ein höheres Amt bekleidet. Als Ramses noch Feldherr gewesen war, hatte dieser den noch jungen Suten Hamu als in Staatsgeschäften tüchtigen und gewissenhaften Mann kennen gelernt und sich mit ihm befreundet.
„Herr“, begann nun Suten Hamu, als ihn der Pharao mit einem aufmunternden Nicken aufforderte, seine Meinung kund zu tun, „das Volk weiß kaum etwas über sie ...“
„Ich will nicht wissen, was das Volk weiß, ich will wissen, was euch bekannt ist“, unterbrach ihn der Pharao.
Eine Weile herrschte Schweigen. Der Pharao schaute wieder einen nach dem anderen fragend an. Doch keiner wusste eine Antwort.
Als Erster fasste der Hohepriester des Ptah Mut, hatte er doch einige Kenntnis von dem, was in sein Gebiet, die Theologie, gehörte. Er sprach:
„Mein Herr, sie beten einen Geist an. Sie haben keine Bilder, keine Statuen von ihrem Gott.“
„Also weiß niemand, wie ihr Gott aussieht?“, fragte Ramses.
„Sie nennen ihn den Gott Abrahams und sagen, er habe keinen Namen“, fuhr der Hohepriester fort.
Dem Pharao kam das seltsam vor. Ein Gott ohne Namen, das konnte er nicht verstehen. Alles, was existierte, hatte einen Namen, und was keinen Namen hatte, existierte auch nicht. Ein sonderbares Volk, diese Hebräer.
„Wer sind ihre Priester?“, fragte Ramses den Hohepriester.
„Ich kenne keinen.“
„Herr, ich habe gehört, dass sie auch keine Priesterinnen haben“, sagte einer der Schreiber.
Der Hohepriester runzelte missmutig die Stirn. Wollte der Schreiber mehr wissen als er, der Priester? Wollte er sich vor dem Pharao hervortun? Das hätte auch er, der Hohepriester, erwähnen können, wenn er es für wichtig befunden hätte. Doch der Hinweis, dass er selber keinen Priester kenne, schien ihm zu genügen.
Seti schwieg verlegen. Als Hohepriester des Seth hätte er eigentlich in theologischen Fragen Bescheid wissen müssen. Doch er übte dieses Amt erst seit kurzem aus. Kronprinz – Horus im Nest – war er ja auch erst seit ein paar Monaten. Seine Erziehung als Sohn eines Heerführers hatte sich auf das Allernotwendigste im Bezug auf die Gottheiten beschränkt. Mehr Zeit war auf seine körperliche Ertüchtigung aufgewendet worden. Von ihm verlangte Ramses auch keine Antwort. Der kannte seinen Sohn zu gut, als dass er von ihm einen brauchbaren Hinweis auf die religiösen Sitten der Hebräer hätte erwarten können
Der Erste Sandalenträger meldete sich nun erneut zu Wort.
„Wenn sie zusammenkommen, sind die Männer unter sich wie Verschwörer“, sagte er.
Diesmal war es der Oberste Heerführer, der seinen Unwillen kuntat, doch, anders als der Hohepriester des Ptah, mit Worten, nicht nur mit finsterem Mienenspiel.
„Warum hast du mir nichts gemeldet von dieser Verschwörung?“, rügte er Suten Hamu.
Der versuchte sich zu rechtfertigen:
„Ich weiß nichts von einer Verschwörung. Ich sagte nur, dass sie zusammenkommen wie Verschwörer.“
„Das genügt, um mir von so was Bericht zu erstatten“, sagte der Heerführer. „Schließlich bin ich auch für die innere Sicherheit verantwortlich.“
Suten Hamus Blick verfinsterte sich. Die innere Sicherheit gehörte auch zu seinem Aufgabenbereich. Solange er aber keine Veranlassung sah, militärisch einzugreifen, gab es auch keinen Grund, den Obersten Heerführer zu informieren. Durch dessen Vorwurf fühlte er sich in seiner Ehre verletzt. Doch er schwieg und würgte seinen Ärger hinunter.
Andere ergriffen nun das Wort, und sie redeten noch eine Weile hin und her. Das Volk misstraue den Hebräern, hieß es. „Sie sondern sich ab. Sie sind anders als wir. Es sind zu viele geworden. Sie murren. Sie sind unzufrieden. Sie sind undankbar. Sie sind eine Gefahr.“
Der Pharao hatte endlich genug erfahren. Er ließ seine Berater gehen.
Er dachte in der Nacht auf seinem Lager nach über das, was sie ihm gesagt hatten. Es gab zu viele von den Hebräern. Und die Worte Verschwörung und Gefahr waren gefallen. Das beunruhigte ihn. Finstere Gedanken flatterten ihm wie schwarze Vögel durch den Kopf. Am Morgen wusste er, was er zu tun hatte.
Ramses besprach sich mit dem Ersten Sandalenträger. Was er vorhatte, sollte geheim bleiben. Suten Hanu beauftragte er, zwei oder drei verschwiegene Boten auszuwählen und sie in die Provinz Gosen zu den Hebräern zu schicken. Sie sollten alle ihre Hebammen auf einen bestimmten Tag zu ihm an den Hof bringen.
Die Geburtshelferinnen erschraken. Was hatte das zu bedeuten? Dergleichen war noch nie vorgekommen.
Sie trafen sich, zwei, drei, kamen unterwegs mit einer anderen Gruppe zusammen. Am Ende waren sie eine ansehnliche Schar. Sie hatten ihr bestes Kleid angezogen. Unterwegs tuschelten sie miteinander. Keine wusste mehr als die andere. Wer wird uns empfangen, ein Wesir, der Pharao selber? Was will er von uns? Wie tritt man einem König gegenüber?
Man führte sie in einen kleineren, kunstvoll bemalten Raum, der ihnen einen Respekt einflößte, der kaum größer hätte sein können, wenn es der Thronsaal gewesen wäre. Sie alle waren zum ersten Mal im Königspalast. Sie waren so verängstigt, dass sie sich kaum umzusehen getrauten. Ein älterer Mann – war es ein Zeremonienmeister? – erklärte ihnen, was sie zu tun, wie sich zu benehmen hatten. Der Pharao selber werde mit ihnen sprechen. Doch sie dürften nur reden, wenn sie gefragt werden. Dann verließ er die ängstlichen, verstörten Frauen.
Stumm und eingeschüchtert warteten sie eine geraume Weile auf den Herrscher und warfen sich, als er eintrat, vor ihm auf den Boden, wie der alte Mann es sie gelehrt hatte. Als der Pharao ihnen das Zeichen zum Aufstehen gegeben hatte, sprach er zu ihnen:
„Habt keine Angst, es geschieht euch nichts.“
Die Hebammen, die mit gesenktem Blick dastanden, schielten zu ihren Nachbarinnen. Sollten sie dem Wort des Pharaos glauben? Keine schien sich dessen sicher. Sie hatten wohl gemerkt, dass unter ihnen keine ägyptischen Hebammen waren. Das beunruhigte sie noch mehr.
Der Pharao bemühte sich, einen freundlichen Ton anzuschlagen, doch die Frauen trauten ihm immer noch nicht. Das Lächeln auf seinem geschminkten Gesicht schien aufgesetzt, nicht ehrlich. Seine Augen verrieten eher etwas Unangenehmes.
„Ihr werdet doch oft zu den Weibern gerufen, wenn sie gebären“, sagte er, „das wird bei euch wohl nicht anders sein als bei uns. Erzählt mal, wie es bei euch ist. Bekommen eure Weiber viele Kinder? Du!“, und er zeigt auf eine, die ihm gerade am nächsten stand. „Wie heißt du? Erzähl!“
„Ich heiße Schiphra“, antwortete sie mit unsicherer Stimme. „Ja, wir helfen bei vielen Geburten.“
Sie schwieg wieder und wusste nicht, was sie sonst noch antworten sollte.
„Ich habe gehört, dass die Hebräer viele Kinder haben“, sagte Ramses, an Schiphra gewandt.
„Das ist wahr“, antwortete diese. „Schon unsere Vorväter hatten viele Kinder. Jakob, der in dieses Land kam und – dem Pharao sei’s gedankt – freundlich aufgenommen wurde, hatte zwölf Söhne und viele Töchter. Von den zwölf Söhnen sind zwölf Stämme ausgegangen, die alle in diesem fruchtbaren Land bleiben durften.“
Schiphra erschrak beinahe über sich selber. Auf einmal waren die Worte einfach so aus ihr herausgekommen. Hatte sie den richtigen Ton getroffen? Was beabsichtigte der Pharao mit seinen Fragen?
„Ich weiß“, antwortete Pharao. „Und ich weiß, dass euer Volk sich vermehrt und immer größer wird.“
Was hat das mit uns zu tun?, fragten sich die Frauen im Stillen. Sie sahen den Pharao, der in seinem weißen, goldverzierten Gewand hoheitsvoll vor ihnen stand, ängstlich fragend an.
„Unser Land ist ein fruchtbares Land“, fuhr der Pharao fort, „aber ihr wisst, es ist ein Land, das auch aus viel Wüste besteht. Es vermag nicht uneingeschränkt viele Menschen zu ernähren. Deshalb habe ich euch holen lassen. Es liegt in eurer Hand.“
Der Pharao sah die verständnislosen Blicke der verwirrt dreinschauenden Frauen. Sein Lächeln war verschwunden. Jetzt zeigte er sein wahres Gesicht. Seine Stimme war auf einmal strenger geworden. Er ging direkt auf sein Ziel los:
„Wenn ihr zu einer Gebärenden gerufen werdet und sie auf dem Gebärschemel sitzt und ihr seht, dass das Kind, das aus ihrem Leib gekommen ist, ein Mädchen ist, dann ist es gut. Lasst es leben.“
Was soll das heißen?, fragten sie sich. Das ist doch selbstverständlich. Das ist doch unser Beruf, den Kindern zum Leben zu verhelfen. Doch es blieb ihnen keine Zeit, darüber nachzudenken; denn er Pharao fuhr fort:
„Aber wenn ihr seht, dass es ein Knabe ist, dann erwürgt es und sagt der Mutter, das Kind sei tot geboren. Habt keine Angst, es geschieht euch nichts, wenn ihr meinem Befehl gehorcht.“
Das war also ein ausdrücklicher Befehl – ein fürchterlicher Befehl.
Die Hebammen erschraken, als sie das hörten, aber sie wagten nicht, ihr Erschrecken zu zeigen. Erst als der Pharao sie entlassen hatte und sie draußen in einiger Entfernung vom Palast in einer fast menschenleeren Gasse waren, getrauten sie sich, ihrer Empörung Luft zu machen.
„Das können wir nicht tun“, sagte die, welche Schiphra hieß.
„Gott würde uns strafen, wenn wir die Knaben unserer Frauen töten würden“, antwortete eine andere.
„Aber was sollen wir tun?“, fragte eine Dritte, die den Namen Pua trug. „Sie werden uns töten, wenn wir den Befehl nicht ausführen.“
Und eine Vierte sagte: „Eher will ich mich töten lassen, als dass ich ein Kindlein umbringe.“
„Warum verlangt der Pharao das von uns?“, fragte eine andere. „Warum nicht von den ägyptischen Hebammen? Wir leben doch in Gosen. Uns stört es nicht, dass wir viele sind. Hungern wir etwa? Können wir uns nicht von unserem Land ernähren? Wenn es die Ägypter nicht können, sollen sie doch ihre eigenen Neugeborenen töten.“
„So darfst du nicht reden“, wies Pua sie zurecht. „Das eine wie das andere ist Unrecht. Fragt euch lieber, was wir tun sollen.“
„Wenn man uns ruft“, schlug wieder eine andere vor, „dann sollten wir einfach nicht hingehen. Lassen wir doch die Frauen ohne uns gebären. Stirbt ein Kind, so ist es nicht unsere Schuld, und lebt ein Knabe, dann kann uns die Strafe auch nicht treffen, weil wir nicht dabei waren.“
Sie wussten schließlich keinen anderen Rat, als dass jede mit ihrem Gewissen verantworten müsse, was sie tun oder unterlassen würde.
Auf dem Heimweg sprachen sie kaum mehr miteinander. Jede war mit sich selbst, mit ihrer Angst, ihrem Gewissen beschäftigt. Was da von ihnen verlangt wurde, war so grausam, dass es ihnen die Kehle zuschnürte und die Brust beengte.
Als sie in Gosen anlangten und sie auseinander gingen, warfen sie sich zum Abschied nur stumme, traurige Blicke zu. Der einen und anderen entrang sich dabei ein tiefer Seufzer.
Mirjam und Aaron hatten draußen vor der Hütte gespielt. Als Mirjam genug hatte und aufhören wollte, schrie Aaron los und schlug mit seinen kleinen Fäusten auf seine Schwester ein.
„Lass das!“, rief sie, und obwohl ihr die Schläge nicht wehtun konnten, lief sie davon. Aaron rannte hinter ihr her auf die Weide neben dem Haus. Sie hörten den Ruf ihrer Mutter nicht sofort. Erst als sie wieder näher waren, schien es Mirjam, die Mutter schreie nach ihr.
Mirjam trat durch die Tür, während Aaron schmollend draußen blieb.
„Wo seid ihr denn?“, fragte Jochebed, ohne eine Antwort zu erwarten. Sie hatte jetzt andere Sorgen. „Schnell! Eil zu Pua, der Hebamme! Sag ihr, sie soll sofort kommen. Die Wehen haben eingesetzt.“
Mirjam wusste Bescheid. Ihre Mutter hatte ihr erklärt, was bevorstand und was dann zu geschehen habe.
Das Mädchen eilte hinaus.
„Wohin gehst du?“, fragte Aaron. „Ich will auch mit.“
„Nein, das kannst du jetzt nicht. Geh hinein! Mutter hat Schmerzen“, rief sie im Vorbeilaufen.
Aaron gefiel das nicht. Seine Schwester hatte ihm doch nicht zu befehlen. Trotzig setzte er sich auf die Bank vor der Hütte. Mit wem sollte er jetzt spielen. Von den andern Jungen war gerade keiner zu sehen. Wegzulaufen und sie zu suchen getraute er sich aber auch nicht. So blieb er denn sitzen und ließ die Füße baumeln, bis ein bunter Schmetterling sich nicht weit von ihm auf einer Blume niederließ. Gerade als er von der Bank sprang und den farbigen Sommervogel fangen wollte, hörte er seine Mutter rufen. Ihre Stimme tönte anders als sonst, ein wenig weinerlich.
Aaron trat zögernd durch die offene Tür in den düsteren Raum. Jochebed streckte eine Hand aus und zeigte auf ein Tuch, das neben dem Herd lag.
„Nimm das Tuch“, sagte sie, „geh nach draußen, tauch es ins Wasser und bring es mir dann.“
Aaron nahm das Tuch und ging vor die Hütte, wo ein Bottich voll Wasser stand, das zum Waschen gebraucht wurde. Wasser zum Trinken und zum Kochen bewahrte Jochebed in Krügen auf einem Gestell neben dem Herd auf.
Als ihr Aaron das nasse Tuch gebracht hatte, legte sie es auf die Stirn, dankte Aaron für seine Hilfe und schickte ihn wieder hinaus.
Mirjam wusste, wo die Hebamme wohnte. Doch zu ihrem Haus brauchte man, selbst wenn man schnell lief, eine Viertelstunde.
Heftig schnaufend kam sie bei Pua an.
„Du musst sofort kommen. Bei meiner Mutter geht’s los“, stieß Mirjam, immer noch atemlos, hervor.
Pua hatte wohl gewusst, dass Jochebeds Niederkunft nahe bevorstand. Aber nun erschrak sie doch, als ihr Mirjam die Nachricht brachte. Es war die erste Geburt, der sie beistehen sollte, seit dem furchtbaren Befehl des Pharaos. Was sollte sie tun? Ach, wäre sie doch nicht zu Hause gewesen! Aber sie brachte es nicht über sich, das Mädchen mit einer Ausrede abzuweisen. Sie konnte doch dem Mädchen auch nicht sagen, dass sie das Kind erwürgen müsste, wenn es ein Knabe werden sollte.
„Ich muss noch meine Sachen holen“, sagte sie und verschwand in einem anderen Zimmer. Dort setzte sie sich erst einmal auf einen Stuhl. Ihr Herz hatte zu klopfen begonnen. Sie spürte es bis zum Hals hinauf. Am liebsten wäre ihr gewesen, ihr Herz zerspringe und sie fiele tot um.
„Herr, hilf!“, sagte sie leise und mit flehender Stimme vor sich hin.
Doch Gott schwieg. Sie bekam keine Antwort.
Eine ganze Weile saß sie wie gelähmt. Doch dann raffte sie sich auf. Sie musste doch Jochebed helfen. Vielleicht, hoffte sie, gibt mir Gott unterwegs ein Zeichen, einen Gedanken.
Warum braucht sie so lange?, dachte Mirjam und wurde ganz ungeduldig. Doch Pua nahm sich Zeit, mehr Zeit als sie brauchte. Endlich erschien sie wieder unter der Tür, den Gebärschemel unter dem Arm und eine Tasche in der anderen Hand.
„Wir müssen uns beeilen“, mahnte Mirjam.
Mit einem beklemmenden Gefühl in der Brust folgte Pua dem Kind. Sie kannte zwar den Weg, aber sie ließ Mirjam vorausgehen. Das Mädchen schaute immer wieder zurück und trieb sie zur Eile an.
„Nicht so schnell!“, rief Pua, „ich bin nicht mehr so jung wie du.“
Vielleicht komme ich zu spät, dachte sie. Wenn das Kind schon geboren ist, können sie mich nicht bestrafen. Der Pharao hat doch gesagt, dass wir das Kind töten müssen, wenn die Gebärende auf dem Gebärschemel sitzt. Vielleicht ist das Kind aber schon da, wenn ich mit dem Schemel komme. Oder es ist ein Mädchen.
So recht wollte sie aber doch nicht glauben an das, was sie sich im Stillen einredete.
„O Gott, lass es ein Mädchen sein“, betete sie halblaut vor sich her, „ein Mädchen, bitte, ein Mädchen.“
Viel zu langsam für Mirjam, aber viel zu schnell für die verzagte und mit sich selbst ringende Pua erreichten sie die Hütte, wo Jochebed wohnte. Als sie eintraten, hörten sie Jochebed stöhnen.
Mein Gott, es ist noch nicht so weit. Was soll ich tun? Lass es ein Mädchen sein, dachte sie noch ein letztes Mal, ehe sie zu Jochebed hintrat.
Sie schickte Mirjam hinaus zu Aaron.
„Willst du jetzt wieder mit mir spielen?“, fragte Aaron. Doch Mirjam hatte keine Lust. Sie wollte lieber in der Nähe der Tür bleiben und horchen, was drinnen geschah.
„Geh mit den anderen spielen!“, sagte sie. Und Aaron eilte davon, barfuß und nur mit einem Hemdchen aus grobem Leinen bekleidet, um seine Spielkameraden zu suchen.
Pua setzte die Gebärende auf den Schemel und sprach ihr zu.
Jochebed hatte bereits Tücher und ein Becken mit warmem Wasser bereitgestellt.
Die Hebamme setzte sich vor Jochebed auf den Boden.
Die Geburt ging rasch vonstatten. Das Kind glitt heraus, kaum dass sie die schwarzen Haare in der Öffnung gesehen hatte. Sofort erkannte sie, dass es ein Junge war. Einen ganz kurzen Augenblick zögerte sie. Sie könnte die Nabelschnur um den Hals des Knaben wickeln und ihn erwürgen. Das sähe aus, als ob die Natur es so gewollt hätte. Aber insgeheim wusste sie, dass sie es nicht tun könnte. Sie fürchtete Gott. Ihr Beruf war, zum Leben und nicht zum Tod zu verhelfen. Sie nahm den Knaben auf und hielt ihn in die Höhe. In diesem Moment fing er an zu schreien.
O Gott, hilf mir!, flehte sie in Gedanken.
Als Jochebed sah, dass sie einen Knaben geboren hatte und er gesund und munter war, ging ein entspanntes Lächeln über ihr Gesicht.
Pua trennte das Kind von der Nabelschnur und wusch ihm den weißlichen, mit Blut gemischten Schleim ab. Dann legte sie das Kind in Jochebeds Arme.
Pua brachte es noch nicht über sich, Jochebed zu sagen, dass das Kind in Gefahr war. Sie wollte warten, bis die Frau das Kind gestillt hatte. Aber auch als dies geschehen war, fand sie noch keine Worte.
Eigentlich hätte sie nun gehen können. Sie hatte ihre Arbeit getan.
Jochebed hatte in einem Säcklein Brot und Salz und ein Krüglein Öl für die Hebamme als Lohn bereitgestellt und ihr bereits übergeben. Als aber Pua immer noch keine Anstalten machte zu gehen, glaubte Jochebed, mit dem Kind sei etwas nicht in Ordnung. Pua schien auch so seltsam verstört.
„Sag mir“, fragte sie, „was ist los? Ist das Kind nicht gesund?“
Da nahm Pua all ihren Mut zusammen und erzählte der Frau, was der Pharao allen Hebammen befohlen hatte.
„Erzähl niemandem, dass ich bei der Geburt dabei war“, bat Pua. „Der Pharao wird mich töten lassen, wenn er es erfährt, und dein Kind auch.“
Jochebed erschrak und presste den Knaben fest an ihre Brust.
„Was soll ich tun?“, fragte sie mit zittriger Stimme.
„Ich weiß es nicht“, antwortete Pua.
Ich kann mein Kind doch nicht verstecken, überdachte Jochebed. Es wird schreien und sich so verraten. Mein Gott, ich kann es doch nicht umbringen lassen.
„Leg es vor das Haus eines Ägypters“, empfahl ihr Pua. „Wenn man es findet, wird niemand wissen, dass es ein hebräisches Kind ist. Man wird es aufnehmen, und es wird ein gutes Leben haben. Einen besseren Rat weiß ich nicht.“
Als Pua dies gesagt hatte, verabschiedete sie sich rasch. Nun war sie erleichtert, dass ihr im letzten Augenblick dieser Gedanke gekommen war. Sie glaubte, Gott habe ihn ihr eingegeben.
Auf dem Heimweg beschlich sie aber dennoch ein ungutes Gefühl. Nicht wegen des Rates, den sie Jochebed gegeben hatte. Nein, sie wusste, bald würde sie zur nächsten Geburt gerufen. Wie würde sie sich dann verhalten? Würde sie es wieder so machen? Sie wusste, sie könnte kein Kind töten. Dazu fürchtete sie Gott zu sehr. Aber was würde geschehen, wenn immer mehr Kinder ausgesetzt würden? Sie konnte sich auch nicht vorstellen, dass die anderen Hebammen anders handeln würden. Eines Tages würden sie wieder zum Pharao geholt und mit dem Tod bestraft werden.
Aber sie wollte lieber sterben, als neugeborene Kinder zu töten. Dieser Gedanke wuchs, während sie so ging, zur Gewissheit heran. Doch die Ruhe, die sie, seit sie vor Pharao gestanden, verlassen hatte, kehrte nicht in sie zurück.
Jochebed in ihrer Hütte war der Verzweiflung nahe. Sie hatte sich so sehr auf das Kind gefreut. Und nun sollte sie es wieder hergeben. Aber sie musste es tun. Das Kind durfte nicht sterben.
Mirjam sah, dass ihre Mutter unruhig und traurig war.
„Bist du nicht glücklich?“, fragte sie. „Ich freue mich doch auch, dass ich ein Brüderlein bekommen habe.“
Da weihte Jochebed ihre Tochter in das schreckliche Geheimnis und den Rat, den Pua ihr gegeben, ein.
Aaron aber, der während der Geburt draußen mit anderen Jungen gespielt und den Pua im Vorbeigehen nach Hause geschickt hatte, wollte gleich wieder hinausrennen, nachdem er das Kind gesehen hatte, um es seinen Kameraden zu erzählen.
Doch Mirjam hielt ihn zurück. Sie war ein verständiges Mädchen und wusste, was das bedeuten konnte, wenn Aaron berichtete, dass er einen Bruder bekommen habe.
„Du darfst niemandem etwas sagen“, befahl sie ihm.
„Warum?“, fragte er.
Mirjam schaute ihre Mutter an. Doch diese schüttelte nur den Kopf. Wie sollte man einem vierjährigen Knaben so etwas erklären?
Aber beide wussten, dass Aaron in seinem Drang, alles zu erzählen, was ihm oder seiner Familie widerfuhr, nicht zurückzuhalten war. Was geschehen musste, musste rasch geschehen. Sie durften es nicht einmal wagen, abzuwarten, bis der Vater in einigen Tagen von seiner Arbeit nach Hause kam.
Am Abend, nachdem Aaron eingeschlafen war, berieten Jochebed und Mirjam, wie sie es anstellen wollten, dass niemand merke, wem das Kind gehöre, wenn es gefunden werde.
„Wir können das Kind doch nicht einfach irgendwohin tragen, ohne dass wir gesehen werden“, sagte Mirjam.
Dann überlegte sie lange.
„Ich hab’s“, erklärte sie auf einmal. „Wir legen das Kind in ein Körbchen. Dann sieht es aus, als ob wir zum Markt gehen.“
Sie war stolz auf ihren Einfall und freute sich, dass sie mit diesem Vorschlag der Mutter helfen konnte.
„Aber das Kind wird schreien“, antwortete Jochebed, „und uns verraten.“
Über das Gesicht des Mädchens flog der Schatten der Enttäuschung. Doch Mirjam gab nicht auf. Wieder überlegte sie.
„Wir müssen einen Weg wählen, wo wenige Leute gehen. Wir gehen über die Schafweiden bis in die Nähe der Stadt.“
„Die Stadt ist zu weit entfernt. Da müssten wir zwei oder drei Tage unterwegs sein“, antwortete Jochebed.
„Wir müssen ja nicht bis in die Stadt gehen. Unterwegs gibt es Bauernhöfe“, überlegte Mirjam.
„Aber dort in der Nähe ist auch der Palast des Pharaos. Das ist viel zu gefährlich“, fürchtete Jochebed.
„Weißt du was?“, fragte Mirjam. In ihr keimte ein listiger Gedanke. „Am Rand der Weide, ehe man zum Palast kommt, ist sumpfiges Gebiet. Da wächst viel Schilf. Wir legen vor dem Park das Körbchen auf das Wasser. Wenn das Kind Hunger bekommt und zu schreien beginnt, dann wird jemand darauf aufmerksam werden und das Körbchen finden. Und wir sind bis dann schon wieder weit weg.“
„Aber dort kommt doch niemand vorbei“, befürchtete Jochebed. „Vielleicht ein Schafhirte. Aber wenn es Tage dauert, wird das Kind nicht überleben.“
Mirjam antwortete mit einem verschmitzten Lächeln auf ihrem klugen Gesicht. „Vielleicht findet ein Diener oder eine Dienerin aus dem Königspalast das Körbchen.“
Daran aber mochte Jochebed nicht denken.
„Glaubst du im Ernst, der Pharao würde das Kind am Leben lassen, da er doch seinen Tod befohlen hat?“
Mirjam schaute ihren kleinen Bruder an. Dann sagte sie: „Er sieht doch gar nicht aus wie ein Hebräer. Man könnte sogar glauben, er sei ein Ägypter.“
„Ja, und dann wird er einmal ein Diener des Pharaos, der ihn ermorden lassen wollte“, ereiferte sich die Mutter. „Soll ich das zulassen?“
„Er wird es doch gut haben. Er wird in einem großen Haus wohnen und immer reichlich zu essen haben. Ist das nicht besser als zu sterben?“, fragte Mirjam.
Jochebed wusste schließlich auch nichts Besseres. Langsam fand sie sich mit dem Gedanken ab, dass ihr Junge dereinst in der Nähe des Mannes aufwachsen würde, der eigentlich seinen Tod wollte.
Auf einmal kam doch etwas Hoffnung in ihr auf. Auch ein wenig Schadenfreude, nur einen kleinen Augenblick lang, als sie daran dachte, dass der Pharao auf diese Weise eigentlich für seinen Unterhalt aufkommen müsste.
„Aber das Körbchen wird sich mit Wasser voll saugen und untergehen, und das Kind wird ertrinken“, befürchtete Jochebed.
Dann aber, nachdem sie eine Weile überlegt hatte, sagte sie: „Nein, ich weiß, wie wir es machen.“
Amrams Hütte war die letzte der Siedlung gegen das Grasland hin. Wenn man die Weide überquerte, gelangte man, wenn man tüchtig ausschritt, nach ungefähr zwei Stunden zum Sumpf und zu einer kleinen Bucht, die ein Nilarm gebildet hatte. Hinter der Bucht war der riesige Park des Pharaos, und mitten darin stand der Königspalast.
Jochebed schickte ihre Tochter zum Sumpf, Schilfrohre zu holen. Es war beinahe Vollmond in dieser Nacht. Der Mond stand noch nicht sehr hoch am Himmel, aber er gab genug Licht, dass Mirjam über die Schafweide zum Sumpf gelangen konnte. Sie kannte sich gut aus, denn sie hatte oft beim Hüten der Schafe geholfen.
Sie war noch keine Stunde gegangen, da kam sie zu einem schmalen Wassergraben, über den ein kleiner Steg aus zwei Holzlatten gelegt war. Sie kannte den Steg. Man musste aufpassen, dass man nicht ins Wasser fiel. Vielleicht hatte sie früher immer ihr Augenmerk so sehr auf diesen Steg gerichtet, dass sie gar nicht gesehen hatte, wie etwa hundert Schritte weiter nördlich am flachen Ufer sich etwas wie ein Gestrüpp erhob. Es schimmerte im Mondschein. Und als sie näher hin sah, erkannte sie, dass es Schilf war. Sie ging dem Graben entlang bis zu der Stelle, wo in einem Stück sumpfigem Boden, das nicht größer war als das Gärtchen ihrer Mutter neben der Lehmhütte, etwas Schilf wuchs. Rasch schnitt sie sich so viele Rohre ab, als sie dachte, es würde für ein Körbchen genügen, und eilte damit zurück.
Die Mutter staunte, dass Mirjam so schnell zurückgekommen war. Während Mutter und Tochter zusammen ein Körbchen flochten, erzählte Mirjam, wie sie das Schilf gefunden hatte. Jochebed bestrich die Zwischenräume mit lehmiger Erde, die sie neben der Hütte zusammengescharrt hatte, und mit Pech, das der Vater immer für etwelche Arbeiten im Haus bereit hatte. Gegen den Morgen war der Lehm trocken. Das Körbchen war nicht gerade eine Zierde. Es sah aus wie ein Kästchen. Hätten sie noch Zeit gehabt, es zu verschönern, hätten sie es sicher mit Farbe bemalt und geschmückt.
Jochebed gab dem Knaben zum letzten Mal an der Brust zu trinken. Dann wickelte sie ihn in Tücher und legte ihn in das Kästchen. Obendrauf legten sie den Deckel, den sie ebenfalls aus Schilfrohr gemacht hatten. So hatte das Kind genügend Luft zum Atmen.
Aaron schlief noch, als Mutter und Tochter die Hütte verließen. Wenn sie zurückkämen, wollten sie Aaron sagen, das Kind sei gestorben und sie hätten es draußen vergraben.
Sie gingen über die Schafweide. Das Knäblein in dem Körbchen verhielt sich ruhig. Jochebeds regelmäßiger Gang auf dem weichen Trampelweg hatte den Kleinen in den Schlaf gewiegt. Sie trug ihn vorsichtig, stets darauf bedacht, in der Dunkelheit nicht zu stolpern, um ihn nicht aufzuwecken. Als sie zum Sumpf kamen, gingen sie an ihm entlang. Schon dämmerte der Morgen.
Vor sich sahen sie bereits den königlichen Park. Sie gingen noch bis zu einer kleinen Bucht, wo der Schilfgürtel aufhörte. Weiter konnten sie nicht gehen, ohne gesehen zu werden.
„Hier sind wir nahe beim Königspalast“, sagte Mirjam. „Wenn das Kind aufwacht, wird es schreien; dann wird es bestimmt jemand hören.“
In ihren Worten war jedoch mehr Hoffnung als Gewissheit. Sie hatte leise flüsternd gesprochen, obwohl sie keinen Menschen sahen.
Auch Jochebed bemühte sich, leise zu sein. Sie ging beinahe auf Zehenspitzen, damit man ihre Schritte nicht hören konnte. Sie zögerte. Sie sah sich verstohlen um. Sie waren wenige Schritte zuvor an einem Strauch vorbeigekommen.
„Vielleicht sollten wir ihn doch besser in jenem Strauch verbergen“, meinte sie. „Wer weiß, ob ihn zwischen dem Schilf jemand findet. Oder ob er nicht doch im Wasser versinkt.“
„Aber dort im Strauch könnte ihn ein wildes Tier aufspüren“, sagte die kluge Mirjam.
Jochebed musste ihr zustimmen. Sie setzte das Kästchen behutsam aufs Wasser und stieß es ein wenig von sich weg, damit es zwischen das Schilf schwamm, ohne ganz verdeckt zu werden.
„Siehst du“, sagte Mirjam aufmunternd zu ihrer Mutter, „so wird er bestimmt gefunden werden. Wenn die Leute im Palast aufgewacht sind, wird ihn sicher jemand hören und nachsehen, woher das Schreien kommt.“
Jochebed hatte Tränen in den Augen, als sie sich endlich abwandte, nachdem das kleine Schiffchen zwischen dem Schilf zum Stehen gekommen war.
„Komm, jetzt müssen wir gehen!“, mahnte sie. „Man darf uns hier nicht sehen.“
„Ich möchte noch bleiben“, bat Mirjam, „und warten, bis es gefunden wird.“
Ja, es wäre beruhigend zu wissen, dass das Kind tatsächlich gefunden würde, dachte Jochebed. Sie willigte in Mirjams Vorschlag ein, denn die Gewissheit, dass das Kind weiterleben würde siegte über die Angst, dass Mirjam entdeckt und damit auch der ganze Plan zerstört werden könnte. Sie sagte:
„Aber wenn du siehst, dass jemand kommt, um das Kind zu holen, musst du sofort weglaufen.“
„Ich möchte sehen, wer das Kind findet“, erwiderte Mirjam.
„Das möchte ich doch auch, aber wir müssen vorsichtig sein. Es wird sicher in gute Hände kommen. Warte nicht so lange, bis man dich sieht.“
Daraufhin machte sich Jochebed auf den Weg zu ihrer Hütte. Mirjam aber blieb. Sie ging ein Stück zurück bis zu dem Strauch und verbarg sich hinter ihm.