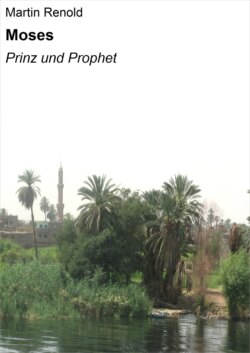Читать книгу Moses - Martin Renold - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die wundersame Errettung
ОглавлениеAn diesem Morgen war Henut-taui, die Tochter des Pharaos, früh wach. Die Pavianweibchen, die ihr Vater im Park hielt, hatten sie durch ihr Schreien, mit dem sie das Heraufkommen des Sonnengottes begrüßten, aufgeweckt. Sie lag mit offenen Augen auf ihrem Bett und schaute zur Fensteröffnung in der Höhe unter der Decke, durch die die frische Morgenluft hereindrang. Sie sah den von der aufgehenden Sonne gelblichrot gefärbten Himmel. Die Helligkeit in ihrem Zimmer war so groß, dass sie die in bunten Farben gemalten Bilder an den Wänden deutlich sehen konnte. Sie liebte es, nach dem Aufwachen ihren Blick in diesen Bildern schweifen zu lassen. Neben der Tür stand ein liebliches Mädchen mit einem Krüglein in der Hand. Ihr schlanker Körper schimmerte durch das feine Leinenkleid, das ihr nur bis zu den Knien reichte. Es hätte ihr Abbild sein können. Auf der andern Seite der Tür stand ein Knabe mit einem Becher. Wie schon oft, glitt auch an diesem Morgen beim Betrachten der beiden ein Lächeln über ihr Gesicht. Sie musste daran denken, dass das Mädchen seinem Bruder nie den Becher mit süßem Saft füllen könnte, weil ja die Öffnung der Tür trennend zwischen ihnen stand.
An der Wand gegenüber sah sie Weinranken, von denen junge Männer mit entblößtem Oberkörper die Trauben pflückten und in eine Schale legten. Auf einem anderen Bild sah sie Tiere, Pferde, Rinder, Katzen, Löwen. Und an der Wand über ihrem Lager war ein Papyrusdickicht abgebildet. Zwischen den Papyrusstängeln schwammen Enten im blauen Wasser oder flatterten in die Höhe, und am blauen Himmel tummelten sich bunte Vögel. Es war ein glückliches Erwachen jeden Morgen, als würde sie draußen inmitten eines Papyrussumpfs ihre Augen aufschlagen. Und die Stimmen der Vögel, die durch die Fensteröffnung unter der Decke drangen und die das Geschrei der Paviane abgelöst hatten, verstärkten diese schöne Illusion.
Seit ihr Vater nach dem Tod Haremhabs Pharao geworden war, bewohnte die Prinzessin dieses Zimmer. Das war noch nicht so lange her. Doch sie hatte sich rasch daran gewöhnt und schon viele schöne Stunden in diesem Raum erlebt. Hier plauderte sie mit ihren Gespielinnen, hier tauschten sie ihre kleinen Geheimnisse aus oder eiferten im Senet-Spiel um den Sieg. Manches kam ihr schon vor, als wäre es eine Ewigkeit her. Sie musste lachen, als sie daran dachte, wie sie, als sie im Palast eingezogen waren, noch ihre Jugendlocke getragen hatte. Jetzt war sie doch schon beinahe erwachsen. Vielleicht würde sie bald einmal einen Gemahl bekommen und Kinder kriegen. Sie liebte kleine Kinder. Schade, dass sie keine kleine Schwester hatte. Ihr einziger Bruder, Seti, war zehn Jahre älter als sie. Er würde einmal Pharao werden. Doch das konnte noch dauern. Jetzt war erst vor nicht allzu langer Zeit ihr Vater Pharao geworden, und der war noch nicht so alt, dass er nicht noch viele Jahre leben könnte. Seti war für sie nie ein Spielkamerad gewesen. Er war groß und stark und interessierte sich nur für kriegerische Spiele mit Streitwagen. Die Amalekiter hatten vor vielen Generationen Pferde und Streitwagen nach Ägypten gebracht. Sie, die von den Ägyptern Heka Chasut – fremde Herrscher – genannt wurden, waren, als das Reich zerfallen und von Dutzenden kleinen Pharaonen regiert worden war, in Ägypten eingedrungen und hielten es hundertfünfzig Jahre lang besetzt. Seither kämpften auch die Ägypter mit diesen zweirädrigen, von Pferden gezogenen Wagen, und die jungen Königssöhne übten sich schon früh im Wagenkampf. Seti besaß eigene Pferde und einen eigenen Wagen, den er vor allem zum Zeitvertreib, um im Land herumzufahren, und für die Jagd benutzte. Am liebsten hätte er Löwen gejagt, doch die liefen nur oben in Nubien frei herum.
Seti war verheiratet mit Tuja. Henut-taui mochte ihre Schwägerin nicht. Als Seti sie geheiratet hatte, war Henut-taui noch ein Kind gewesen. Tuja hatte sich damals schon wie eine Prinzessin gefühlt, obwohl zu jener Zeit noch niemand daran gedacht hatte, dass ihr Schwiegervater Pharao werden könnte. Auf ihre kleine Schwägerin hatte sie beinahe verächtlich herabgeschaut. Und auch jetzt noch behandelte sie sie wie ein Kind, das noch der Erziehung bedurfte.
Auch ihre beiden Knaben, Meriamun und Ramses, behütete sie wie Kostbarkeiten, die man schützen musste. Wie gerne hätte Henut-taui manchmal die Kleinen auf ihren Schoß genommen oder mit ihnen gespielt. Tuja ließ dies nicht zu, auch jetzt nicht, da sie doch eine vernünftige junge Frau geworden war. Eigentlich hatte sie sich damit jetzt abgefunden. Die beiden Bengel waren ohnehin aus dem Säuglingsalter herausgewachsen, in dem sie am herzigsten waren. Doch die frostigen Gefühle zwischen den beiden Frauen waren geblieben. Ja, seit Tuja wusste, dass sie einmal die Große Königsgemahlin sein würde, hatte sich ihr Hochmut gegenüber Henut-taui nur noch verstärkt.
Zum Glück vertrug sich Henut-taui gut mit ihren Dienerinnen, die zugleich ihre Gespielinnen waren, vor allem die fröhliche May, die ihr eine liebe Freundin geworden war.
Wie nun Henut-taui an diesem viel versprechenden Morgen die Wand mit den Papyruspflanzen und den Enten und Vögeln betrachtete, kam sie die Lust an, baden zu gehen. Sie erhob sich und rief nach May.
„Du bist schon auf?“, fragte May. „Was hast du vor?“
„Lass uns baden gehen, noch vor dem Frühstück“, antwortete Henut-taui. „Es ist ein so schöner, frischer Morgen.“
May half der Prinzessin beim Ankleiden und kämmte ihr die Haare. Schminken wollte sie sich erst später.
Als sie fertig waren, stürmten sie hinaus.
Vor dem Palast dehnte sich ein weiter Park mit Sykomoren, Akazien und Palmen. Dahinter begann Grasland bis zu einer kleinen Bucht. Barfuß rannten sie zum Sandstrand.
„Fang mich!“, rief Henut-taui.
May folgte ihr und versuchte, sie zu erwischen. Doch die Prinzessin war schnell oder wich ihr plötzlich zur Seite aus, wenn May ihr nahe kam.
Sie lachten, und als sie ans Wasser kamen, blieb Henut-taui stehen und schloss May in die Arme und ließ sie nicht los, bis sie wieder Atem geschöpft hatten.
Auf der Seite, wo sie nun standen und sich ihrer Kleider entledigten, war das Wasser seicht. Langsam setzten sie Fuß vor Fuß in das Wasser. Sie spürten den weichen, feinen Sand unter ihren Sohlen. Bald wagten sie sich weiter hinein. Das Wasser umspielte ihre Knie, ihre Schenkel, bald darauf den Bauch und die Brüste. Sie lachten und spritzten sich gegenseitig an. Dann schwammen sie ein Stück um die Wette.
Hier waren sie ungestört. Der kleine Sandstrand gehörte zum Palast. Niemand hatte sonst Zutritt. Auf der anderen Seite der kleinen Bucht schützte sie ein Schilfgürtel vor zudringlichen Blicken.
Auf einmal hörten sie ein Schreien, wie von einem kleinen Kind.
„Was ist das?“, fragte Henut-taui. „Hast du das auch gehört.“
„Ja, das kommt von dort drüben hinter dem Schilf“, antwortete May.
„Schau doch einmal nach, ob da jemand ist, der uns beobachtet. Vielleicht ist es eine Familie mit kleinen Kindern.“
May schwamm hinüber und stieg dort, wo das Schilf aufhörte an Land. Henut-taui sah sie hinter dem hohen Schilf verschwinden.
Aber May sah niemand. Doch da hörte sie wieder das Schreien.
Unterdessen hatte auch Mirjam nicht nur das Lachen der jungen Frauen, sondern nach einiger Zeit auch das Schreien ihres Brüderchens gehört und war aufmerksam geworden, ob wohl jemand kommen würde. Nun sah sie ein nacktes Mädchen daherkommen. Es musste aus dem Wasser gestiegen sein, denn das Wasser tropfte noch von ihrer Haut.
May begann in die Richtung zu schauen, woher das Weinen kam. Doch sie konnte nichts sehen. Behutsam ging sie ins Wasser und teilte die Schilfrohre auseinander.
Diesen Augenblick wollte Mirjam benutzen, um ihr Versteck zu verlassen und nach Hause zu eilen. Aber sie fürchtete, ertappt zu werden, wenn das Mädchen wieder aus dem Schilf hervorkäme. Sie ging deshalb rückwärts, so dass sie immer die Stelle im Blick hatte, wo May verschwunden war. Sobald sie auftauchte, ging Mirjam auf sie zu, als ob sie von weit her komme.
May hatte das Kästchen entdeckt und trug es ans Land. Mirjam trat wie zufällig herbei.
May hatte bereits den Deckel von dem Kästchen weggenommen und es vor sich ins Gras gelegt. Das Kind wimmerte immer noch. Als Mirjam neben May niederkniete, schaute May auf und sah das Mädchen an, das eine Hebräerin zu sein schien.
Mirjam gab sich Mühe, sich nichts anmerken zu lassen.
„Hast du das Kind hier ausgesetzt?“, fragte May. „Ist es dein Kind?“
„Oh, nein“, antwortete Mirjam, „ich bin ja selber noch ein Kind.“
„Bist du schon lange hier?“, fragte May weiter.
„Nein, ich bin eben gekommen“, log Mirjam.
„Dann hast du niemand gesehen, der dieses Kind in dem Kästchen ins Wasser gelegt hat?“
Mirjam schüttelte nur den Kopf. Ihr Herz klopfte heftig. Hoffentlich merkte die junge Frau nichts von ihrer Angst.
„Das muss ein neugeborenes Kind sein. Es ist noch so klein. Sieh nur die kleinen Fingerchen“, sagte May zu der jungen Hebräerin.
Mirjam kamen beinahe die Tränen, als sie ihr Brüderchen anschaute, das vom Schreien im Gesicht ganz rot geworden war. Am liebsten hätte sie es der jungen Frau wieder weggenommen. Aber sie wusste, das wäre der Tod für ihren Bruder und vielleicht auch für sie und für Vater und Mutter und Aaron.
„Komm mit mir“, sagte May. „Ich bringe das Kind der Prinzessin.“
Eigentlich wusste sie selber nicht, weshalb sie dieses fremde Mädchen zum Mitgehen aufforderte. Aber vielleicht war es besser so. Sie wusste ja nicht, was Henut-taui mit dem Kind vorhatte. Wenn sie nichts mit ihm anzufangen wusste, war wenigstens jemand da, dem sie es mitgeben konnte.
May hob das Kind aus dem Kästchen und nahm es auf den Arm. So schritten sie dem Ufer entlang um die Bucht herum.
Als Mirjam hörte, dass sie zur Prinzessin mitgehen sollte, fuhr ihr doch ein kleiner Schreck in die Glieder. War das die Dienerin der Königstochter? Was würde nun mit ihrem kleinen Bruder geschehen? Halb fürchtete sie, der Pharao könnte doch erkennen, dass das Kind hebräischer Herkunft war, halb freute es sie, dass ihr Bruder vielleicht bei der Prinzessin und ihrer Familie aufwachsen könnte. Wenn nur alles gut ginge. Dann würde er sicher ein schönes Leben haben.
Die Prinzessin, als sie sah, dass May mit einem fremden Mädchen zurückkehrte, schlüpfte rasch in ihr Kleid und ging den beiden entgegen.
„Sieh, was ich gefunden habe!“, rief May schon von weitem. „Ein neugeborenes Kind.“
Henut-taui beugte sich über den Arm ihrer Gespielin, in dem das Kind sich inzwischen beruhigt hatte.
May erzählte, wie sie das Kind gefunden hatte und wie dieses Mädchen dazugekommen war.
„Sie hat gesagt, sie habe niemand gesehen.“
„Niemand, dem es gehören könnte?“, fragte Henut-taui.
Mirjam schüttelte wieder den Kopf. Sie brachte kein Wort hervor.
„Dann will ich es behalten. Es ist ein schönes Kind. Ich liebe kleine Kinder.“
„Ist es ein Mädchen oder ein Knabe?“, fragte May.
Beinahe hätte sich Mirjam verraten. Die Antwort wollte ihr schon über die Zunge hüpfen.
Aber sie konnte sich zurückhalten. Die Frage war ja gar nicht an sie gerichtet.
Die Prinzessin hatte das Kind May vom Arm genommen und es auf den sandigen Boden gelegt. Sie wickelte es aus den Tüchern und rief: „Schaut, es ist ein Knabe. Wir müssen ihm einen Namen geben. Was meint ihr, wie soll er heißen?“
Bevor die beiden anderen einen Namen nennen konnten, rief sie: „Ich weiß, ich werde ihn einfach Moses, Sohn, nennen. Er ist ja jetzt mein Kind.“
May erinnerte ihre Herrin und Freundin daran, dass das Kind gestillt werden müsste.
„Ich kenne eine Frau“, platzte Mirjam heraus. „Sie hat kürzlich ein Mädchen bekommen, das nach der Geburt gestorben ist.“
„Dann bitte ich dich, sie zu holen. Ich werde sie reich belohnen“, sagte die Prinzessin zu Mirjam, die schon davoneilen wollte.
„Sie soll in den Palast kommen und nach der Prinzessin fragen“, rief May ihr nach.
Als Mirjam zu dem Schilfgürtel kam, sah sie das leere Kästchen und den Deckel daneben auf dem Boden. Gerührt blieb sie davor stehen und wischte sich eine Träne aus den Augen. Obwohl sie noch nie einen Sarg gesehen hatte oder vielleicht auch gar nicht wusste, was ein Sarg war, kam ihr der leere Behälter nun doch vor, als hätte er etwas mit dem Tod des Kindes zu tun, den sie in diesem Augenblick erst bewusst verloren hatte, als ob er gestorben wäre. Sie zögerte, ob sie das Kästchen aufheben und als Erinnerung nach Hause tragen solle. Doch das schien ihr verräterisch und zu gefährlich. Aaron könnte Fragen stellen. Und die Mutter würde vielleicht nur noch trauriger werden, wenn sie das Kästchen sah. Sie hob es auf, füllte es mit Sand und legte den Deckel darauf. Dann legte sie es wieder ins Wasser, sah zu, wie es versank, und wartete, bis es nicht mehr zu sehen war.
Alles war ihr wie eine heilige Handlung vorgekommen.
Als sie weiterging, war ihr, als wäre sie ein Stück älter geworden.
Jochebed saß in ihrer Hütte und wartete ungeduldig auf Mirjam. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, aber das Mädchen war noch nicht zurückgekommen. Das konnte nur bedeuten, dass ihr kleines Kind noch nicht gefunden wurde oder dass etwas schief gelaufen war. Beides ließ trübe Gedanken in ihr aufkommen. Sie machte sich große Sorgen.
Aaron saß ungewohnt still in einer Ecke und spielte mit einem Stück Holz, das er gestern gefunden hatte. Er begriff, dass die Mutter traurig war. Sie hatte ihm erzählt, dass das Brüderchen gestorben sei. Dass aber Mirjam nicht zurückgekehrt war, als sie das Kind begraben hatten, verstand er nicht. Doch er wagte nicht zu fragen.
Endlich kam Mirjam mit aufgelöstem Haar hereingestürmt. Sie war den ganzen Weg gelaufen. Zum Glück war sie so außer Atem, dass ihr die Luft fehlte, um gleich mit der Neuigkeit herauszuplatzen, denn zuerst musste Aaron zum Spielen hinausgeschickt werden. Er sollte nichts von alledem erfahren.
Immer schicken sie mich hinaus, dachte er, wenn die Großen sich etwas zu erzählen haben. Für ihn war auch Mirjam schon beinahe eine Erwachsene.
Mirjam berichtete, was geschehen war.
Als Jochebed hörte, dass sie sich der Frau, die das Kind gefunden hatte, genähert und mit ihr gesprochen hatte, erschrak sie. Doch Mirjam beruhigte sie. Sie hätten nichts zu befürchten. Und sie erzählte weiter. Die Prinzessin selber hätte das Kind als ihren Sohn angenommen und ihm den Namen Moses gegeben.
„Zieh dein bestes Kleid an“, sagte Mirjam, „und geh in den Palast. Frag nach der Prinzessin. Ich habe ihr gesagt, dass ich eine Frau kenne, die ein totes Mädchen geboren hat. Sie will, dass du Moses’ Amme wirst. Ist das nicht großartig? Nun kannst du doch dein eigenes Kind stillen.“
Jochebed konnte es kaum glauben. Sicher war das eine Falle. Die beiden Frauen hatten Mirjam durchschaut. Wahrscheinlich wusste die Prinzessin von dem Befehl ihres Vaters und versuchte auf diese Weise, sie zur Rechenschaft zu ziehen.
Aber es blieb ihr nichts anderes übrig. Der Aufforderung der Prinzessin musste sie folgen. Sonst würde sie wohl die Häscher ausschicken, sie zu suchen.
Doch bei all diesem Argwohn blieb doch ein Funke Hoffnung, dass alles so komme, wie Mirjam erzählt hatte, und dass sie schon heute ihr Kind wiedersehen und es stillen dürfe, bis es entwöhnt würde.
Eine Auswahl an Gewändern hatte Jochebed gerade nicht. Aus der Truhe holte sie das Kleid, das sie an Festtagen trug. Mirjam kämmte ihr das Haar. Das tat sie besonders gerne. Als Jochebed bereit war, musterte Mirjam sie von oben bis unten. Dann meinte sie:
„Du bist schön. So darfst du ruhig vor die Prinzessin treten.“
„Aber was soll denn aus euch werden?“, fragte Jochebed.
„Wir werden schon zurecht kommen“, antwortete Mirjam. „Du weißt ja, ich kann schon Brot backen, und das Schaf kann ich auch melken. Vielleicht dürfen wir dich manchmal im Palast besuchen.“
Jochebed glaubte nicht, dass ihre Kinder in ihren ärmlichen Kleidern in den Palast gelassen würden. Doch sie sagte nichts.
Dann begleitete Mirjam ihre Mutter. Aaron blieb mit einigen Kameraden zurück. Er war mit denen so sehr beschäftigt, dass er es kaum beachtete, wie seine Mutter sich von ihm verabschiedete.
„Ich werde bald zurück sein“, rief ihm Mirjam noch zu. Doch er hörte nicht auf sie. Er ahnte ja nicht, dass Mirjam allein und seine Mutter vielleicht für lange Zeit gar nicht zurückkommen würde.
Jochebed und Mirjam gingen wieder über das Weideland. Aber diesmal achteten sie darauf, dass sie ihre Sandalen nicht schmutzig machten. Dort, wo sie das Kästchen mit Moses ins Schilf gelegt hatten, blieb Mirjam zurück.
„Nur Mut!“, sagte sie zu Jochebed. Und die hatte die Aufmunterung nötig. Furchtsam näherte sie sich dem Palast.
Dem Wächter, der den Park überwachte, fiel die Frau sofort auf. Sie war nicht wie eine Ägypterin gekleidet, und ihr Schritt war zaghaft.
„Was suchst du hier?“, fragte er die Fremde ziemlich barsch. Und mit weit ausgestrecktem Arm pflanzte er seine Lanze vor sie hin.
Jochebed fuhr zusammen. Das war nicht gerade ein freundlicher Empfang.
„Ich bin zur Prinzessin bestellt“, antwortete sie zaghaft.
Der Wächter musterte sie fast wie vorher Mirjam von oben bis unten, doch misstrauisch, nicht aufmunternd, wie ihre Tochter es daheim getan hatte.
„Folge mir!“, befahl er, zog seinen Arm mit der Lanze zurück und ging ihr voraus zum Königspalast. Jochebed ging eingeschüchtert hinter ihm her.
Sie betraten den Palast durch eine kleine Nebentür. Sie gingen durch lange Gänge und kamen in einen größeren Raum mit Säulen, den sie überquerten. Jochebed schien alles so groß, so gewaltig und prunkvoll. Sie kam sich so klein und armselig vor und wagte sich nicht umzusehen. Am Ende des Raumes übergab der Wächter Jochebed einer Dienerin, der sie bis zum Zimmer der Prinzessin folgte.
„Warte hier!“, befahl die Dienerin.
Nach einer Weile kam die Frau aus dem Zimmer und forderte Jochebed höflich auf, einzutreten und sich vor der Prinzessin auf den Boden zu werfen.
Doch Henut-taui trat rasch auf sie zu und bat sie, stehen zu bleiben.
Auf dem Bett der Prinzessin sah Jochebed ihren Sohn auf Kissen liegen. Am liebsten wäre sie auf ihn zugeflogen, um ihn in die Arme zu nehmen.
„Du weißt, warum du gerufen wurdest?“, fragte die Prinzessin. „Hat es dir das Mädchen gesagt?“
„Ja“, antwortete Jochebed. „Ist das das Kind?“
„Schau es dir an!“, forderte die Prinzessin sie auf. „Ist es nicht ein schönes Kind?“
Jochebed trat auf ihr Kind zu. „Ja, es ist ein schönes Kind.“ Und sie lächelte dabei.
Henut-taui hatte ihr Vertrauen eingeflößt. Sie dachte gar nicht mehr daran, dass es vielleicht eine Falle sein könnte. Die Prinzessin schien sie wirklich als Amme bei sich zu wünschen.
„Es ist ein Knabe. Ich nenne ihn Moses – mein Kind“, sagte die Prinzessin.
Du hast kein Recht, ihn dein zu nennen, dachte Jochebed. Aber sie freute sich trotzdem, weil sie sah, dass Moses es bei ihr gut haben würde. Etwas Besseres hätte ihm gar nicht geschehen können, als im Palast aufgezogen zu werden. Sie dachte in diesem Augenblick auch nicht daran, dass es der Palast des Königs war, der befohlen hatte, dass ihr Kind getötet werden müsse.
Als der Knabe zu weinen anfing, sagte Jochebed:
„Er wird Hunger haben. Darf ich ihn stillen?“
Als die Prinzessin es ihr erlaubte, setzte sie sich neben dem Bett in die Kissen und nahm Moses an ihre Brust.
„Moses, mein Kind“, flüsterte sie ihm leise in ihrer Sprache ins Ohr, aber auch so, dass die Prinzessin es nicht hören sollte, „nun darf ich doch deine Mutter sein, und du bist bei mir, solange du an meiner Brust trinken kannst. Gebe Gott, dass dies lange so sein darf.“
„Was murmelst du vor dich hin?“, fragte die Prinzessin. „Sprichst du mit ihm?“
„Ich habe ihm gesagt, wie lieb er ist, und ihm ein langes Leben gewünscht“, antwortete Jochebed, ein wenig unsicher, weil sie sich ertappt fühlte. „Ich habe mit meinen Kindern immer leise gesprochen, wenn ich sie gestillt habe. Ich habe eine Tochter und einen Sohn.“
Sie erschrak. Vielleicht habe ich schon zu viel gesagt, dachte sie. Hoffentlich fragt sie mich nicht nach Mirjam.
„Mein jüngstes Kind ist leider tot zur Welt gekommen“, sagte sie rasch.
„Das tut mir Leid“, sagte die Prinzessin und fragte nicht weiter.
Die Ablenkung war geglückt.
Als das Kind gestillt war, rief die Prinzessin ihre Dienerin und Freundin.
„Bring der Frau neue Kleider“, sagte sie zu May, die sogleich wieder verschwand und nach einer Weile mit Gewändern über dem Arm zurückkehrte.
„Ich möchte, dass du hier bleibst“, sagte Henut-taui. „Man wird dir ein Zimmer herrichten.“
„Herrin“, antwortete Jochebed, „ich habe einen Mann und zwei Kinder.“
„Sie sollen hierher kommen. Sie können bei dir wohnen“, antwortete die Prinzessin, „so lange, wie du meinen Sohn stillen kannst. Du kannst sie jetzt holen, aber bleib nicht zu lange.“
Jochebed versprach, sich zu beeilen.
Eine Dienerin führte sie bis zum Ausgang und übergab sie dem Wächter, der sie hineingeführt hatte. Der begleitete sie durch den Park bis zu der Bucht.
Als sie allein war, wurde ihr erst bewusst, dass die Prinzessin Mirjam wiedererkennen würde. Sicher würde sie dann Fragen stellen. Wohl war ihr nicht bei dem Gedanken. Aber jetzt gab es kein Zurück. Sie musste gehorchen, diesen beschwerlichen Weg gehen, der ihr doch auch das Glück brachte, bei ihrem kleinen Sohn bleiben zu dürfen.
Unterwegs ging ihr so viel durch den Kopf. Dass nun die ganze Familie in den Königspalast umziehen sollte, bereitete ihr Bauchweh. Was dachte die Prinzessin? Das war doch nicht so einfach. Amram, ihr Mann, war bei der Arbeit. Seit sie das Kind geboren hatte, war er noch nicht zurückgekommen. Das konnte noch einige Tage dauern. Sie wusste nicht einmal genau, wo der Steinbruch war, in dem er arbeitete. Sie konnte niemand hinschicken.
Sie entschloss sich, ihrer Nachbarin zu sagen, was geschehen war. Nicht alles der Wahrheit entsprechend. Nur dass sie ein totes Kind geboren habe und dass sie jetzt als Amme in den Palast gerufen worden sei und dort mit Mirjam und Aaron wohnen müsse. Wenn ihr Mann zurückkomme, solle sie ihm das sagen.
Weil sie kaum glaubte, dass Amram mit ihr und den Kindern in den Königspalast umziehen wolle, bat sie die Nachbarin, falls dies so wäre, ihm fürs Erste ein frisches Brot zu reichen und vielleicht eine Suppe zu kochen. Mehr brauche sie nicht zu tun. Später wisse er sich schon selbst zu helfen.
Die Nachbarin war neugierig und wollte wissen, wie Jochebed dazu käme, als Amme in den Palast geholt zu werden. Und ob dem Pharao ein Sohn oder eine Tochter geboren worden sei. So viel sie wisse, habe er doch schon einen erwachsenen Sohn.
Nein, man habe ihr gesagt, das Kind gehöre einer Hofdame, redete sich Jochebed heraus und überhörte geflissentlich die anderen Fragen. Sie müsse sich beeilen. Und sie verabschiedete sich rasch.
Nachdem sie dies in Ordnung gebracht hatte und auch die Kinder ihre Festtagsgewänder angezogen hatten, nahm sie die beiden an die Hand und ging mit ihnen zurück zum Palast.
„Du bist doch das Mädchen, das heute früh zu der Bucht gekommen ist, wo Moses gefunden wurde“, sagte die Prinzessin, als sie Mirjam sah.
Obwohl ihre Mutter sie auf diese unvermeidliche Frage vorbereitet hatte, schoss Mirjam das Blut ins Gesicht. Sie nickte verschämt.
„Ah, und da hast du sofort an deine Mutter gedacht, als wir von einer Amme sprachen. Welch glücklicher Zufall“, meinte Henut-taui.
Jochebed stand beiseite und versuchte zu erraten, was in der Prinzessin vorging. Es schien, als hätte sie alles durchschaut. Doch Henut-taui schwieg. Und Mirjam atmete erleichtert auf.
„Vielleicht war es eine Fügung Gottes“, sagte Jochebed. Sie bedachte nicht, dass die Prinzessin ihren Gott nicht kannte, sondern an andere Götter glaubte.
„Ja, das war eine gute Fügung des Himmels“, bestätigte die Prinzessin und bat May, die Frau und die beiden Kinder in ihr Zimmer zu begleiten.