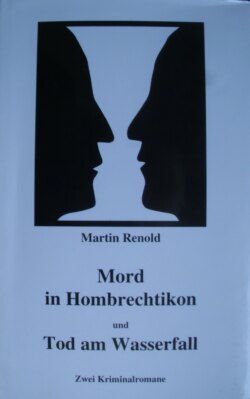Читать книгу Mord in Hombrechtikon und Tod am Wasserfall - Martin Renold - Страница 3
1. Kapitel
ОглавлениеArthur Strahm, Detektivwachtmeister der Kantonspolizei Zürich, wohnte im Tiefenbrunnen. Vom Wohnzimmerbalkon seiner Wohnung aus überblickte er den unteren Teil des Zürichsees. Vereinzelt schossen Raketen in den Nachthimmel, von der billigen Sorte, solche, die nur in die Höhe zischen und oben einen Knall loslösen. Allmählich sah man auch die teureren, bei denen in mehr oder weniger raschem Fall eine einzelne farbige Lichtkugel niedersinkt und irgendwo zwischen Himmel und Erde verglüht. Weiter oben am Seeufer, bei Zollikon, wo die reichen Villenbesitzer Partys geben, sah man auch Raketen, bei denen farbige Kugeln in zehn, zwanzig oder hundert farbige Sterne auseinanderspritzen, aus denen weitere tausend herausgeschleudert werden wie beim Urknall, auch drüben, am anderen Ufer, in Wollishofen und Kilchberg. Weiter oben, wahrscheinlich in Rüschlikon, war ein ganz großes Feuerwerk im Gang.
Grund für diese Feuerwerkerei war der 1. August, der schweizerische Nationalfeiertag, kurz Bundesfeier genannt.
Wann hatte Strahm zum letzten Mal an einer Bundesfeier teilgenommen – mit Darbietungen der Turner, der Männer- und Frauenchöre, der Harmoniemusik, mit der Ansprache des Stadtpräsidenten oder gar eines Bundesrats!? Das war, als seine beiden Kinder noch klein gewesen waren. Jetzt waren beide erwachsen und verheiratet, der Bub und das Mädchen. Strahm wusste nicht einmal genau, ob es heute solche Bundesfeiern nach alter eidgenössischer Tradition überhaupt noch gab oder ob sich alles nur in dieser Knallerei und einer Ansprache des Bundespräsidenten am Fernsehen erschöpfte.
Früher, in seiner ledigen Zeit, da war noch mehr Romantik dabei gewesen. Nachts um das Feuer herum, von den roten Lampions der Kinder, den schönen runden mit dem Schweizer Kreuz, nicht den gelben mit Sonnen und Monden darauf, made in China. Und auf dem Heimweg durch den dunklen Wald, wenn die Lampions sich auf und ab bewegten und am Ausflackern waren, war es leicht gewesen, ein Mädchen, das hübscheste, das man sich im Schein des Feuers ausgesucht und beim allgemeinen Aufbruch nicht aus den Augen gelassen hatte, anzusprechen, ihm auf dem steinigen Weg den Arm anzubieten und, wenn es dann trotzdem unweigerlich stolperte, ihm den Arm um die Taille zu legen, damit es nicht noch einmal passiere. Das gab den Mädchen Sicherheit. Das waren noch Zeiten gewesen! Da musste die Polizei nicht ausrücken wegen unsittlicher Belästigung, nur weil man ein Mädchen angesprochen hatte.
Heute würden sich die Mädchen ja gar nicht mehr in der Nacht allein zu einem solchen Fest droben über dem Wald wagen. Als Polizist wusste er das zur Genüge. Heutzutage scheint ja niemand mehr sicher zu sein. Da lauern überall Gefahren: Raub, Vergewaltigung, Mord und Totschlag. Selbst Jugendliche rauben einander aus. Und wie war das vor ein paar Jahren, als er zu einem Mord gerufen wurde, als ein zwölfjähriges Mädchen vergewaltigt und erdrosselt wurde! Zu dritt waren sie gewesen. Zwei Mädchen hatten fliehen und die Polizei verständigen können.
Eines aber hatten alle Bundesfeiern gemeinsam, damals schon wie heute: die Knallerei, die Frösche und Schwärmer, die Kanonendonner und die Raketen.
Über dem Albis, bei Thalwil, zog ein Gewitter herauf. Schon ein paar Mal hatten Blitze gezuckt. Man wusste eigentlich nicht recht, war es Feuerwerk von jenseits der Albiskette, oder war es wirklich ein herannahendes Gewitter. Jetzt aber hörte man auch den Donner. Das Gewitter schien in Richtung Zürcher Oberland zu ziehen. Ein Ausläufer kam auch über den Uetliberg. Als die ersten Tropfen auf den Balkon spritzten, ging Strahm ins Wohnzimmer. Aber er ließ die Balkontür offen. Er liebte den würzigen, frischen Duft von der Erde, vom Garten vor dem Haus. Und schiere Begeisterung konnte ihn erfassen, wenn ein nächtliches Gewitter so nahe kam, dass seine Blitze die Stube – er drehte dann immer das Licht aus oder zog im Schlafzimmer die Vorhänge zurück – taghell erleuchtete und der Donner unmittelbar darauf krachte, so dass Gertrud, seine Frau, die Ohren zuhielt oder sich unter der Decke versteckte. Das war etwas anderes, etwas Gewaltigeres als diese blöde Feuerwerksknallerei.
Es regnete nicht lange. Das eine Gewitter war im Norden vorbeigezogen, das andere im Süden. Aber die Blitze zuckten immer noch, und der Donner widerhallte ununterbrochen.
Gertrud Strahm saß in einer Ecke des Wohnzimmers und las in einem Buch. Turi, so nannte ihn seine Frau, hatte die Zeitung auf dem Tisch ausgebreitet, aber er hatte keine Lust mehr zum Lesen. Es war schon spät.
„Ich lese nur noch zwei Seiten“, sagte die Frau, dann ist das Kapitel zu Ende. Geh doch schon zu Bett. Ich komme gleich nach.
Als Strahm sich gerade erhob, schrillte das Telefon.
„Was ist los?“, fragte die Frau, als er den Hörer auflegte.
„Ich muss noch weg. Walser hat angerufen. Ein Mord in Hombrechtikon. Der Schriftsteller Federbein.“
„Was, Michael Federbein!?, rief Gertrud und hielt sich die Hand vor den Mund, als ob sie die Frage zurückhalten wollte. „Das ist doch unmöglich.“
„Doch. Hast du schon etwas von ihm gelesen=“
„Ja, seinen letzten Roman.“
„Walser wird mich gleich abholen. Wir fahren zusammen in seinem Wagen.“
Strahm zog Schuhe und Kittel an.
Keine zehn Minuten später klingelte es.
Strahm, der schon ungeduldig im Zimmer hin und her gegangen war, griff hastig nach dem alten Schlapphut auf dem Garderobenbrett, ohne den er nie ausging, drückte ihn tief in die Stirn und riss die Tür auf.
„Pass auf!“, mahnte Gertrud und schloss hinter dem Hinauseilenden die Tür ab.
Walser steuerte in Richtung Zollikerberg auf die Höhenstraße zu. Die Straßen waren schon beinahe wieder trocken. Als sie auf die Forch kamen, sahen sie, dass sich das Gewitter gegen das Oberland verzogen hatte. Über dem Hörnli und gegen das Toggenburg und den Säntis wetterleuchtete es noch. Im Westen über dem Zürichsee hatten sich die Wolken schon geteilt, und der aufgerissene Himmel verhieß für morgen wieder einen schönen, heißen Sommertag.
Als sie bei der Kirche von Hombrechtikon vorbeifuhren, schlag es gerade zwölf.
„Weißt du, wo es ist?“ fragte Strahm.
„Ja, auf der andren Seite des Dorfes, im Laufenbach“, antwortete Strahms Kollege. „Nach der großen Kurve Richtung Wolfhausen… Jetzt, da vorne, müssen wir rechts abbiegen.“
„Erst im letzten Moment, bei der großen Scheune, sahen sie die kleine Tafel mit der Aufschrift „Laufenbachstraße“ und die Abzweigung.
Das Haus des ermordeten Schriftstellers war nun leicht zu finden. Es war bereits von der Polizei umstellt.
Strahm kannte den Schriftsteller Michael Federbein nur von Bildern in Zeitungen und Illustrierten und aus dem Fernsehen. Gelesen hatte er noch keines seiner Werke. „Das unschuldige Haus“, ein Stück von ihm, hatte er vor zwei oder drei Jahren einmal im Schauspielhaus gesehen, zusammen mit seiner Frau. Er erinnerte sich nur noch an den Titel.
Walser hatte den Wagen bei dem kleinen, geteerten Fußweg angehalten, der von der Straße etwa fünfzig Schritte über die Wiese zu dem Bungalow führte. Rechts neben der Eingangstür brannte das Licht. Links neben der Tür stand das vergitterte Küchenfenster offen. In der Küche brannte ein Neonlicht.
Das Grundstück war, so weit man sehen konnte, gegen die Wiese zu, also gegen Norden, umzäunt. Es war jedoch nur ein niedriger Holz-, ein Staketenzaun, über den ein normal großer Mann mit einem Schritt hinwegsteigen konnte, ohne ihn zu berühren.
Walser und Strahm gingen auf das offene Gartentor zu. Der Weg, der zum Eingang führte, war mit Platten belegt. Aber rechts zweigte ein schmaler, ebenfalls mit Platten belegter Weg ab, der um das ganze Haus, bis auf die Vorderseite zu gehen schien.
Strahm trat nicht ins Haus, sondern wählte den Weg durch den Garten. Die Kantonspolizei hatte den ganzen Garten und die südliche Front des Hauses ausgeleuchtet. Der Bungalow hatte den Grundriss eines großen L. Strahm begrüßte die Polizisten, ohne den Hut zu ziehen, mit einem leichten Antippen des vom jahrelangen Tragen bei Sonne, Wind und Regen speckig gewordenen Randes, ging an ihnen vorüber und schritt die ganze Vorderfront ab. Alle Zimmer außer dem einen, auf der Westseite, waren erleuchtet. Strahm stellte fest, dass von jedem Zimmer eine Glastür auf den Garten hinausführte. Neben dem unbeleuchteten Zimmer war ein Schlafzimmer, danach folgte nochmals ein Schlafzimmer, dann ein Arbeits- oder Bibliothekzimmer. Seine Wände waren ringsum von Bücherregalen verdeckt. Auf einer Seite, etwas von der Wand entfernt, stand ein massiger Schreibtisch aus Nussbaumholz.
Im Winkel des Hauses befand sich ein teilweise überdeckter Gartenplatz, der im Osten, wo der Wald anfing, durch die Fensterfront des Wohnzimmers begrenzt und gegen Süden und Westen durch Sträucher etwas abgedeckt war. Auf der Südseite fiel das Gelände ziemlich steil ab. Auch weiter unten war Wald, und über den Wald hinweg sah man auf den See hinunter, der jetzt schwarz dalag, umrandet von den Lichtern am jenseitigen Ufer.
Einen schönen Flecken Erde hat sich dieser Schriftsteller hier ausgesucht, dachte Strahm. So ließe ich es mir auch gerne gefallen. Doch dann dachte er gleich daran, dass Federbein ja tot war. Nun nützte es ihm ja auch nichts mehr.
Strahm nahm den Blick zurück von den Lichtern jenseits des Sees und ließ ihn nur noch kurz über den gepflegten Garten schweifen, ehe er sich dem Haus zuwandte.
Die Fenster des Wohnzimmers bildeten eine einzige Glaswand, die nur von den Fensterrahmen unterteilt war und die beinahe bis zum Boden hinunterreichte.
Neben dem Arbeits- oder Bibliothekzimmer stand eine breite Tür offen, durch die man offenbar in einen Essraum gelangen konnte, der nur durch ein Cheminée vom übrigen Wohnzimmer abgetrennt war. Strahm wollte eintreten, aber er blieb plötzlich stehen und wandte sich nach seinem Assistenten um.
„Da steht doch Federbein himself“, flüsterte er Walser zu. „Da stimmt doch etwas nicht. Oder habe ich dich falsch verstanden?“
Walser zuckte nur die Schulter.
Als Strahm sah, dass Walser ebenso überrascht war wie er, trat er ein.
Federbein erhob sich.
„Strahm“, stellte er sich vor. „Von der Kriminalpolizei. Und dies ist mein Assistent Walser.“
Diesmal griff er mit drei Fingern an die für das Lüpfen des Hutes vorgesehene, ziemlich abgegriffene Stille, doch so, dass sich das lederne Schweißband kaum von seiner Stirne löste. Walser, der Strahms Gewohnheiten kannte, hatte noch nie in Erfahrung bringen können, ob dieser sich seiner spiegelglatten Glatze wegen scheute, den Hut zu ziehen, oder ob es sonst eine seiner Marotten war.“
„Angenehm“, erwiderte der Angesprochene. „Mein Name ist Federbein.“
„Entschuldigen Sie, aber man hat mir gesagt, Sie…“
„Mein Bruder“, fiel ihm Federbein ins Wort. „Ich bin der Bruder des Ermordeten.“ Und er wies mit der Hand gegen das Wohnzimmer, wo noch Aufnahmen von dem Toten gemacht wurden.
„Federbeins Bruder lag auf dem Boden zwischen einem offenen Fensterflügel und der Rücklehne eines leichten, schwarzen Ledersessels, der etwas zurückgeschoben vor einem niedrigen Tischchen stand.
Strahm neigte sich über den Toten und sah ihm ins Gesicht.
Das war die zweite Überraschung. Der Ermordete war das genaue Ebenbild seines Bruders.
„Sind Sie der Schriftsteller?“, fragte Strahm, oder Ihr Bruder?“
„Mein Bruder“, antwortete Federbein – das „mein“ tönte fast wie „moain“ – „ich bin Balthasar. Balz nannte man mich früher. In den Staaten hieß ich Bally. Ich bin erst heute aus New York herübergeflogen. Und jetzt so was. Wir sind Zwillinge, eineiige.“
Strahm warf einen misstrauischen Blick auf Balz Federbein. Irgendetwas machte ihn stutzig. Die Stimme. Strahm hatte ein sensibles Ohr dafür. Etwas an der Stimme war unecht. Der amerikanische Akzent. Er schien falsch, gekünstelt. Wie es oft geschieht bei Leuten, meistens bei jüngeren, die in einer anderen Landesgegend geweilt haben und sich dann den anderen Dialekt schlecht und recht angelernt haben und sich nach ihrer Rückkehr so geben, als könnten sie den eigenen nicht mehr sprechen. So als schämten sie sich ihrer Wurzeln.
„Wie lange waren sie drüben?“, fragte Strahm.
„Ouh?“, überlegte Balz, „an die dreißig Jahre. In all diesen Jahren habe ich Maikl, ich meine Michael, nicht mehr gesehen. Ich bin selber erschrocken, als ich Maikl heute Nachmittag auf dem Flughafen in Kloten traf. Ich habe geglaubt, in den Spiegel zu sehen.“
„Aber Sie haben doch sicher hie und da Bilder Ihres berühmten Bruders gesehen.“
„Naturally, aber es ist doch nicht dasselbe, wenn man sich Aug in Auge gegenübersteht.“
Der anwesende Arzt trat auf Strahm zu, begrüßte ihn und stellte sich als Doktor Petermann vor.
„Sind Sie der Hausarzt des Toten?“, fragte Strahm.
„Nein, Herr Federbein hat mich gerufen. So viel ich weiß, war mein Kollege Bodmer sein Hausarzt. Selbstverständlich habe ich Herrn Federbein, ich meine den andern, den Schriftsteller, auch gekannt. Hier im Dorf kennt man sich noch. Wenigstens die Alteingesessenen. Und besonders einen Mann wie Federbein. Er war übrigens schon einmal bei mir in der Praxis, als mein Kollege im Urlaub war.“
„Warum haben Sie nicht Doktor Bodmer gerufen?“, wollte Strahm von Balthasar Federbein wissen, der die Schultern hob und erklärte, er habe nicht gewusst, wer der Arzt seines Bruders gewesen sei.
„Und warum haben Sie ihn nicht an Ihren Kollegen verwiesen?“, wollte Strahm von Doktor Petermann wissen.
„Doktor Bodmer ist zurzeit leider krank. Er musste sich operieren lassen und liegt noch für ein paar Tage im Spital.“
„Schön, dass es den Ärzten auch nicht besser geht als unsereinem“, redete Strahm halblaut vor sich hin. Dann forschte er weiter: „Wann wurde Herr Federbein erschossen?“
„Soweit ich das feststellen kann, dürfte es etwa um halb elf gewesen sein. Das würde sich, wie ich gehört habe, auch mit der Aussage seines Bruders decken. Der Schuss hat ihn mitten ins Herz getroffen“, antwortete der Arzt.
Unterdessen war der Polizeiarzt eingetroffen, und bald konnte auch er die Aussage von Doktor Petermann bestätigen.
„Um welche Zeit bekamen Sie den Anruf von Herrn Federbein?“, fragte Strahm.
„So etwa um halb zwölf“, antwortete Doktor Petermann.
„Haben Sie die Polizei gerufen?“
„Nein, das hatte Herr Federbein schon getan. Er berichtete mir, dass er sie gleichzeitig angerufen habe.“
„Ja, das stimmt, wir erhielten die Meldung ungefähr zur gleichen Zeit wie Sie“, bestätigte Walser.
Strahm trug beide Zeitangaben in sein Notizbüchlein ein.
„Also eine Stunde zwischen dem tödlichen Schuss und dem Anruf“, murmelte er nachdenklich vor sich hin.
Ein Polizist trat zu Strahm und erklärte: „Wir haben keine Einschussstelle in der Wand oder sonstwo gefunden.“
„Und die Mordwaffe?“
„Ist noch nicht gefunden worden“, antwortete der Polizist auf die Frage und fuhr weiter. „Der Mörder muss von der Straße her um das Haus herumgekommen sein, ohne Spuren zu hinterlassen. Um jene Zeit war hier das Gewitter zur Hauptsache schon vorbei. Aber hinterher hat es noch einmal lange geregnet. Im Gras konnten wir keine frischen Spuren feststellen, und auf den Platten wurde alles vom Regen und von der Erde, die aus den Gartenbeeten gespült wurden, verwischt. Vermutlich hat der Täter sein Opfer durch das offene Fenster hindurch aus nächster Näher niedergeschossen, denn im Haus sind auch keine fremden Spuren zu finden.“
„Und welches ist Ihre Version, Mister Federbein?“, fragte Strahm.
„Meine Version?“, wiederholte Federbein. „Das tönt ja, als erwarteten Sie von mir irgendeine erdichtete Geschichte. Sie vergessen, dass mein Bruder der Dichter war. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich weiß und was ich gesehen – oder in diesem Fall unglücklicherweise nicht gesehen habe.“
„Nun“, unterbrach ihn Strahm, „Sie werden immerhin zugeben müssen, dass es reichlich sonderbar ist, dass Ihr Bruder um halb elf erschossen wurde und Sie erst eine volle Stunde später den Arzt und die Polizei alarmierten. Daraus darf ich doch wohl für mich einige Schlüsse ziehen. Also los. Wie war es?“
Als Strahm dem so Angesprochenen in die Augen blickte, fragte er sich, ob er nicht einen zu heftigen Ton angeschlagen habe. Jedenfalls wie ein Mörder sah der Mann nicht aus. Aber die wenigsten Mörder, das hatte ihn seine lange Erfahrung gelehrt, sehen wie solche aus.
Federbein war mittelgroß, gut aussehend. Seine Haare waren teilweise leicht grau, auf der rechten Seite etwas stärker als links, genau wie er es auch bei seinem Bruder festgestellt hatte. Federbein sah jedoch müde aus. Das Ereignis schien ihn stark angegriffen zu haben. Strahm glaubte, eine echte Trauer von seinem Gesicht ablesen zu können.
„Kommen Sie, setzen wir uns an den Esstisch“, sagte er nun in versöhnlicherem Ton und forderte Balthasar Federbein auf, mit ihm nach vorne zu gehen. „Ihr könnt die Leiche wegschaffen.“
Walser warf nochmals einen Blick auf den Toten, dann nahm er Strahm, der eben am Cheminée vorbei in den vorderen Teil des Raumes gehen wollte, beiseite und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Darauf hielt Strahm den Arm des Polizisten zurück, der ein Tuch über den bereits auf die Bahre gelegten Toten werfen wollte. Einen Augenblick nur – dann ließ er ihn gewähren.
„Wir werden das anhand der Aufnahmen noch vergleichen“, sagte er zu Walser und setzte sich dann zu Balz, der unterdessen mit dem Rücken zur Gartentür Platz genommen hatte.
In diesem Augenblick schreckte eine Stimme den in sich versunkenen Balz auf.
„Mischa“ tönte es, und Balz wandte sich gegen die Tür, von wo der Anruf kam.“
„Was ist hier los?“, fragte der Unbekannte und trat, sichtlich erregt, ein.
Wer sind Sie?“, fragte Balz und sprang auf.
„Mischa, was ist mit dir? Bist du…?“, stieß der andere hervor und trat zu Strahm. „Ich bin Klaus Zumstein, Mischas Freund. Was ist mit ihm, er ist ja ganz verstört? Er scheint mich ja nicht einmal mehr zu kennen.“
Zwei Polizeibeamte in Zivil wollten mit der Bahre an Zumstein vorüber. Dieser blickte auf das weiße Tuch.
„Dein Bruder?“, fragte er Balz, den er für Michael hielt.
„Ihr Freund“, antwortete Strahm anstelle von Federbein und hielt die beiden Bahrenträger auf. Er streifte das Tuch über dem Toten zurück, und Zumsteins Blick fiel auf das Gesicht seines toten Freundes, den er noch vor Sekunden in dessen Bruder zu erkennen vermeint hatte.
„Mein Gott, Mischa“, stieß Zumstein hervor „Was ist passiert? Und er wandte den Kopf fragend zu Strahm.
„Erschossen.“
„Von wem? Das ist doch unmöglich.“
„Wir wissen es noch nicht“, sagte Walser, „aber vielleicht können Sie uns helfen.“
„Woher kommen Sie eigentlich, und was wollten Sie hier mitten in der Nacht?“, fragte Strahm.
„Ich wohne hier im Haus“, erwiderte Zumstein.
„Strahm deckte den Toten wieder zu und gab den Trägern einen Wink. Diese hoben die Bahre wieder auf und trugen sie hinaus.
„Ja, dann, Köbi“, wandte sich Strahm an Walser. „Dann kümmere du dich mal um Herrn Zumstein. Am besten geht ihr in sein Zimmer.“
Die beiden verschwanden, und Federbein und Strahm setzten sich wieder an den Tisch.
„So, und nun erzählen Sie mal von Anfang an?“, forderte Strahm sein Gegenüber zum Reden auf.
Als dieser schwieg, fing Strahm selber an.
„Also, Ihr Bruder hat Sie heute – oder jetzt muss ich sagen gestern – vom Flughafen abgeholt. Wann kam denn Ihr Flugzeug an?“
„Wir landeten um fünf Uhr. Mein Bruder holte mich mit seinem Wagen ab.“
„Und dann fuhren Sie gleich hier herauf?“
„Ja.“
„Kannten Sie das Haus schon?“
„Nein, so viel ich weiß, hat es mein Bruder erst vor sechs oder sieben Jahren gekauft. Es kann auch schon länger sein. Ich war ja fast dreißig Jahre nicht mehr in der Schweiz. Das mag Ihnen vielleicht merkwürdig vorkommen, aber wir hatten unsere Beziehung so gut wie abgebrochen, nachdem ich weggegangen war. Unser Vater war schon vorher gestorben, die Mutter starb einige Jahre später. Ich hatte damals noch keine feste Adresse und erfuhr erst Wochen später vom Tod meiner Mutter. Mein Bruder war mir vor allem in den späteren Jahren, als wir langsam erwachsen wurden, fremd, obwohl er mir immer zum Verwechseln ähnlich sah. Vielleicht war es gerade das, was uns später trennte, unsere Ähnlichkeit. Als Kinder hatten wir zwar oft unseren Spaß daran. Wir haben manchmal unsere Identität vertauscht und die Leute zum Narren gehalten, was wohl alle Zwillinge, die sich so ähnlich sehen wie wir, als Kinder gerne tun. Das Einzige, was uns unterschied, war, dass er immer Glück hatte, ich nicht. Dabei sagt man doch, dass eineiige Zwillinge meistens nicht nur äußerlich gleich sind, sondern auch das gleiche Schicksal haben. Sie sind ja mit der gleichen Erbanlage ausgestattet, genießen normalerweise die gleiche Erziehung und sind zudem unter dem gleichen Sternzeichen geboren.“
Strahm hatte ihm aufmerksam zugehört. Man muss die Menschen einfach reden lassen. Irgendwann erfährt man dann immer etwas, das man verwerten kann. Das wusste Strahm aus langer Erfahrung.
„Glauben Sie an Astrologie?, fragte er jetzt.
„Nein, ich habe keinen Grund dazu. Mein Bruder und ich sind der beste Beweis, dass dies ein Humbug ist. Aber ich muss zugeben, ich verstehe zu wenig davon. Und Sie?“
„Ich halte auch nicht viel davon. Jedenfalls nichts von den Horoskopen. Aber die Charakterisierung der Eigenschaften bei den verschiedenen Typen kann einem in der Kriminalistik schon ein wenig helfen. Aber Sie wollten von Ihrer Jugend erzählen, von Ihrer Ähnlichkeit. Ich wollte Sie nicht unterbrechen.
„Es interessiert Sie vielleicht nicht. Eigentlich gehört es auch nicht hierher.“
„O doch, erzählen Sie nur. So kann ich mir auch ein Bild von Ihrem Bruder machen. Das ist wichtig für unsere Ermittlungen. Wie war er privat? Man hörte natürlich nur immer von ihm als Schriftsteller.“
„Sie vergessen, dass ich lange keinen Kontakt mehr mit ihm hatte.“
„Trotzdem, es interessiert mich. Sagen Sie, was Sie wissen.“
Federbein schien nachzudenken. Strahm wartete, bis er weiterfuhr:
„Ja, ich weiß nicht, vielleicht war ich eifersüchtig auf meinen Bruder. In der Schule war er kaum besser als ich, aber er hatte immer die besseren Noten, obwohl die Lehrer uns nie unterscheiden konnten. Wir haben manchmal unsere Plätze vertauscht.“
„Und dann hat Ihnen Ihr Bruder wahrscheinlich die Aufsätze geschrieben. Vermutlich hatte er damals schon eine dichterische Ader.“
„Nein, ich habe sie, so viel ich mich erinnere, immer selber geschrieben. Wir hatten nämlich beide viel Phantasie. Er konnte sich schriftlich besser ausdrücken, während ich viele Geschichten zusammenlog.
Balz Federbein blickte den Polizeiwachtmeister an. Dieser saß mit auf den Tisch aufgesetzten Ellbogen da, hielt beide Fäuste vor den Mund, stützte mit den beiden Daumen das Kinn und schaute grimmig unter seinem Schlapphut hervor. Ganz wenig bewegte sich sein Kopf auf und ab, ein paar Millimeter nur. Aber es verlieh ihm das Aussehen von Nachdenklichkeit, die jedoch mit anderen Dingen beschäftigt war.
„Wollten Sie das wirklich hören?“, fragte Federbein. „Ich möchte Sie nicht langweilen. Aber es kommt mir jetzt doch so manches in den Sinn. Sie werden verstehen, der Tod meines Bruders ist mir sehr nahe gegangen. Es ist alles so plötzlich gekommen, so unerwartet.“
„Doch, doch, erzählen Sie nur weiter!“, forderte ihn Strahm auf. Warum sind Sie damals eigentlich ausgewandert?“
„Ich? Ja, das ist auch so eine Geschichte. Daran war eben auch meine Phantasie schuld. Ich war damals ein rechter Tunichtgut. Geld hatte ich keines. Einen Beruf auch nicht. Studieren konnten wir beide nicht nach der Matura. Unsere Mutter hatte das Geld nicht dazu. Stipendien, ja, aber damals wäre es doch eine zu große Belastung für unsere Mutter gewesen. Michael bekam eine gute Stelle. Ich hatte keine Lust, mich zu binden. Ich arbeitete mal hier, mal da. Sobald ich irgendwo Geld verdient hatte, lief ich wieder weg. Ich ließ mir neue Anzüge schneidern, gab die Adresse meines Bruders an, der nicht mehr zu Hause bei der Mutter wohnte. Wenn dann mein Bruder mit der Rechnung zu den Scheidern ging und behauptete, er habe die Anzüge nicht bestellt, glaubte ihm natürlich keiner. Wenn er die Geschichte von seinem Zwillingsbruder, der ihm zum Verwechseln ähnlich sehe, erzählen wollte, hielten sie das für einen faulen Trick. Und meinem Bruder blieb nicht viel anderes übrig, als zu bezahlen, wenn er keine Scherereien bekommen wollte. Und solchen ging er am liebsten aus dem Weg. Von mir bekam er das Geld nie zurück. Meist wusste er auch gar nicht, wo ich mich herumtrieb. Verdient hat er auch nicht sehr viel. Geschrieben hatte er schon Einiges, aber noch nichts veröffentlicht, außer einigen kleinen Geschichten in Zeitschriften, was ihm aber nur ein kleines Taschengeld einbrachte. Ich machte Schulden über Schulden, und mein Bruder zahlte immer wieder. Ich suchte teure Kurorte auf und trieb mich in Hotels und Bars herum. Wenn ich dann einige Zeit wie ein Fürst gelebt hatte, ließ ich Kleider und Koffer im Hotelzimmer zurück und machte mich aus dem Staub. Für diese Schulden musste mein Bruder allerdings nicht aufkommen. Ich trug mich immer unter falschem Namen und falscher Adresse ein.“
„Da kann ich doch verstehen, dass ihr Bruder nicht gerade glücklich über Sie war und aufatmete, als Sie von der Bildfläche verschwanden.“
„Ja, ich muss zugeben, ich war ziemlich gemein. Das Geld, das ich selber verdiente, brauchte ich, um den Frauen Eindruck zu machen. Aber die Polizei war bereits hinter mir her. Ich hatte wieder einmal beschlossen, nicht ins Hotel zurückzukehren. In einer Bar in Davos machte sich ein älterer Herr an mich heran. Ich glaube, er war schwul. Ich merkte, dass er viel Geld in der Tasche trug, denn er war schon etwas angeheitert und prahlte vor mir damit. Ich fuhr mit ihm nach Klosters hinunter. Dort besuchten wir wieder eine Bar. Als er stockvoll war, forderte ich ihn auf, seine Jacke auszuziehen, denn es war heiß. Ich zog meine Jacke ebenfalls aus. Das gefiel ihm. Er legte seinen Arm um meine Schultern. Ich sagte, ich müsse einmal telefonieren. Ich stand auf und zog die Jacke von seinem Stuhl, ohne dass er es merkte, so besoffen war er.
Als ich auf der Toilette in die Brieftasche schaute, erschrak ich. Ich hatte höchsten ein- oder zweitausend Franken erwartet. Aber es war ein Vielfaches. Ich ging nicht in die Bar zurück, sondern machte mich auf und davon. In jener Nacht kam ich noch bis nach Zürich zu meinem Bruder, der damals in der Stadt wohnte. Ich wollte mich bei ihm verstecken. Er wollte unbedingt wissen, wovor ich floh. Ich bot ihm an, ihm alle meine Schulden, für die er geradegestanden war, zurückzuzahlen, wenn er mich nicht verrate und mir weiterhelfe. Schließlich seien wir doch Brüder. Aber er wollte nichts von dem gestohlenen Geld, drängte mich, zur Polizei zu gehen, ich könnte alles noch als eine Verwechslung darstellen. Als ich nicht wollte, warf er mich hinaus.
Der Mann in Klosters hatte sofort die Polizei alarmiert, als er feststellte, dass ich mit seinem Geld abgehauen war. Dummerweise fand die Polizei in meiner zurückgelassenen Jacke einen Ausweis mit meinem Namen. Und schließlich wurde ich in einem Zürcher Hotel aufgegriffen. Bei meiner Verhandlung wurde mein Bruder als Zeuge vorgeladen. Ich wurde, da ich bereits vorbestraft war, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.“
„Das sind ja schöne Geschichten, die Sie mir da erzählen“, sagte Strahm und fragte: „Sind Sie später wieder straffällig geworden?“
„Nein. Aber es gibt da noch etwas. Ich lernte im Gefängnis einen Zellengenossen kennen, der bei einem Banküberfall einen großen Betrag erbeutet hatte. Das Geld war nie gefunden worden. Er hatte es versteckt. Obwohl er seiner Freundin nur vage Angaben über das Versteck gemacht hatte, fürchtete er, sie könnte es entdecken, falls sie es nicht schon getan hatte, und mit einem andern Mann abhauen, denn sie hatte seit längerer Zeit nichts mehr von sich hören lassen. Ich entlockte ihm sein Geheimnis und anerbot mich, nach meiner Entlassung nachzusehen und das Geld für ihn aufzuheben. Er vertraute mir, und ich fand das Geld tatsächlich. Damit setzte ich mich nach Amerika ab. Seither habe ich mich aber meist ehrlich durchs Leben geschlagen.
„Mit dem gestohlenen Geld“, blökte Strahm. „Wie hieß denn ihr Zellengenosse?“
Federbein stutzte. Die Frage schien ihm unangenehm zu sein.
„Ich kann mich gar nicht mehr an seinen Namen erinnern.“
Strahm glaubte ihm nicht. Das kam ihm sonderbar vor. Nun gut, das würde er schon noch herausfinden. Im Augenblick tat dies nichts zu der Sache. „Und warum sind Sie zurückgekehrt?“, wollte Strahm wissen,
„Ich wollte mich endlich mit meinem Bruder aussöhnen, man wird schließlich älter und gescheiter. Und dazu schien mir unser fünfzigster Geburtstag gerade der passende Anlass zu sein.
„Sie werden fünfzig?“
„Ja, aber erst im Oktober, am achtzehnten.“
„Dann sind Sie also ein Waagetyp.“
„Ja, man sagt, wir seien ausgeglichen.“
„Und unentschlossen.“
„Und darum auch ein wenig bequem“, seufzte Federbein.
„Ja, aber auch mit viel Sinn für das Harmonische, das Künstlerische. Vor allem bei Ihrem Bruder scheint das ausgeprägt gewesen zu sein. Vielleicht haben Sie wirklich alle schlechten Eigenschaften des Sternzeichens Waage in die Wiege gelegt bekommen, und ihr Bruder die guten.“
Strahm überlegte sich, ob er wohl auf der richtigen Fährte sei, wenn er den Mörder in diesem Mann suchte. Ein Hochstapler, ein gewissenloser Dieb, aber ein Mörder? Dazu noch ein Brudermörder?
Beide Männer schwiegen eine Weile, bis Strahm den Faden wieder aufnahm.
„Ja, und nun, wie war das also heute, was geschah vom Zeitpunkt Ihrer Ankunft bis zur Ermordung Ihres Bruders?“
„Ich glaube kaum, dass Sie alles interessieren kann. Oder verdächtigen Sie etwa mich? Ich kann Ihnen versichern, dass ich meinen Bruder nicht getötet habe. Das müssen Sie mir schon glauben.“
„Ich verdächtige noch niemanden“, log Strahm. „Aber ich muss alle Umstände prüfen. Es ist wichtig zu wissen, was vor dem Mord geschah.“
„Nun gut, wir fuhren gleich hierher. Wenn man sich beinahe dreißig Jahre nicht mehr gesehen hat, gibt es natürlich viel zu erzählen. Aber wir hatten ja noch viel Zeit vor uns – so glaubten wir wenigstens. Da erzählt man sich eben auch viel Belangloseses und manches Wichtigere, das uns jetzt vielleicht nützlich wäre zu wissen, schiebt man für später auf. Ich glaube nicht, dass unsere Gespräche Ihnen weiterhelfen könnten.“
„Vielleicht doch, Mister Federbein“, sagte Strahm, mit einem etwas ironischen Unterton auf der Anrede, denn der andere schien mit seinem Akzent ständig in Erinnerung rufen zu wollen, dass er aus Amerika kam und den Dialekt nicht mehr rein beherrsche.
„Schießen Sie los! Was geschah um halb elf? Wenn ich nicht irre, hatte das Gewitter um diese Zeit seinen Höhepunkt bereits überschritten.“
„Ja, das war wohl so. Wir hatten den ganzen Abend draußen verbracht. Während wir uns unterhielten, haben wir die Raketen gesehen und sind ab und zu durch die Knallerei erschreckt worden. Dann haben wir beobachtet, wie das Gewitter heraufzog. Wir gingen jedoch erst hinein, als die ersten Tropfen fielen. Aber es war schwül im Haus, und wir ließen die Gartentür und einen Fensterflügel offen. Wir saßen dort am kleinen Tisch. Mein Bruder mit dem Rücken zum Fenster. Um halb elf musste ich einmal hinaus auf die Toilette. Plötzlich höre ich einen Schuss. Ich dachte zuerst, es sei eine verspätete Rakete. Aber dann kam es mir doch merkwürdig vor, dass während des Gewitters Raketen abgeschossen würden. Eine Hagelrakete war es auf jeden Fall nicht, überlegte ich mir. Die hatten die Bauern vor dem Gewitter losgelassen, und die hatten viel dumpfer getönt. Ich machte mir also weiter keine Gedanken und beeilte mich nicht. Die ganze Überlegung, die ich anstellte, wurde mir eigentlich auch erst nachträglich bewusst, als ich ins Wohnzimmer zurückgekehrt war und sah, dass mein Bruder nicht mehr im Stuhl saß. Ich machte noch ein paar Schritte, und dann sah ich Michael auf dem Boden liegen. Nachdem ich festgestellt hatte, dass er tot war, löschte ich sofort das Licht und schloss Fenster und Türen. Es war mir richtig unheimlich.“
„Draußen haben Sie nicht nachgeschaut?“
„Doch, noch während ich neben meinem Bruder kniete, blickte ich in den Garten hinaus. Da ich niemanden sehen konnte, kroch ich am Boden zum Lichtschalter, um das Licht auszulöschen. Im Haus war es still, totenstill. Ich war nicht sicher, ob ich alle anderen Türen geschlossen hatte. Deshalb durchsuchte ich zuerst vorsichtig alle Zimmer.“
„Auch das des Freundes Ihres Bruders?“
„Ja, beide. Er bewohnt die beiden westlichen Zimmer, eines gegen den Garten, das andere hinten hinaus. Aus dem dunklen Haus heraus konnte ich gut beobachten, wenn die Blitze aufleuchteten. Aber ich sah niemanden. Nach einiger Zeit wagte ich mich nach draußen und ging ums Haus herum. Als ich nichts Verdächtiges feststellen konnte, kehrte ich zurück und schloss mich wieder ein.“
„Und warum haben Sie nicht gleich die Polizei angerufen?“, fragte Strahm.
„Zuerst kehrte ich zu meinem Bruder zurück. Ich muss wohl einen kleinen Schock erlitten haben. Auch muss ich zugeben, dass ich Angst hatte. Wenn der Mörder nochmals zurückkehrte und mich hier sähe, müsste er annehmen, er habe sein Opfer doch nicht richtig getroffen. Dann hätte er vielleicht nochmals geschossen. Ich war wie gelähmt. Ich weiß nicht, wie lange ich reglos dasaß. Sie haben ja selber gesagt, die Waagetypen könnten keine Entschlüsse fassen. Es mag eine halbe Stunde gewesen sein, eine Stunde oder zwei. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Plötzlich wachte ich wie aus einem schrecklichen Traum auf und tat das, was ich wohl sofort hätte tun müssen.“
„Das wär’s wohl“, sagte Strahm unvermittelt, als Federbein anscheinend nichts mehr zu erzählen hatte, und erhob sich ruckartig, indem er sich mit den Händen von der Tischplatte hochstemmte. Und dann, im Stehen, beiläufig, als ob er dem gar keine besondere Bedeutung beimessen würde: „Sie wissen wahrscheinlich, dass Sie sich durch Ihr Verhalten des Mordes an Ihrem Bruder verdächtig gemacht haben.“
„Vielleicht, aber das ist doch Unsinn“, erwiderte Balthasar Federbein mit einem Ton, der zum ersten Mal echt und ohne amerikanischen Akzent klang.
„Ich will Ihnen nun meine Version darlegen, Mister Federbein, ohne damit zu sagen, dass ich selber daran glaube. Es ist einfach eine Hypothese.“ Und er schritt neben dem Tisch, an dem Federbein saß, hin und her.
„Sie sind kein unbeschriebenes Blatt, das kann man doch wohl sagen, auch wenn das, was Sie in ihrer Jugend getan haben, längst verjährt ist. Sie wissen, dass Ihr Bruder seit einigen Jahren großen Erfolg als Schriftsteller hat. Seine Werke, vor allem die Dramen, sind, so viel ich gelesen habe, in viele Sprachen übersetzt und an berühmten Theatern aufgeführt worden und werfen sicher erhebliche Honorare und Tantiemen ab. Ich gehe wohl nicht fehl, nach allem, was Sie mir erzählt haben, wenn ich annehme, dass Sie der einzige Erbe sind. Vor ein paar Jahren war Ihr Bruder für Sie noch nicht interessant. Aber jetzt plötzlich fassten Sie den Entschluss, herüberzukommen. Außer Ihrem Bruder wusste niemand, dass er Sie erwartete.“
„Er hat es sicher seinem Freund erzählt“, warf Federbein ein.
„Sie konnten aber nicht wissen, dass er es ihm gesagt hatte. Vermutlich wussten Sie überhaupt nicht, dass der Freund hier wohnt. Sie kommen also rechtzeitig zum Nationalfeiertag. Sie wissen, dass überall Feuerwerk gezündet wird. Bei dieser Knallerei wird man Ihren Schuss überhören. Sie warten also, bis Sie zusammen ins Haus hineingehen, dann verlassen Sie für kurze Zeit Ihren Bruder unter dem Vorwand, ein gewisses Bedürfnis verrichten zu müssen. Man hat ja schließlich einiges getrunken, nehme ich an. Sie suchen aber ihr Zimmer auf, holen die Pistole aus Ihrem Koffer, verlassen das Gastzimmer durch die Gartentür und schleichen sich zum offenen Fenster des Wohnzimmers, wo Ihnen Ihr Bruder den Rücken zukehrt. Ich nehme nicht an, dass Sie den Bruder anriefen, damit er dem Mörder noch einmal in die Augen schauen konnte. Diesen Anblick hätten Sie ihm, wenn alles nach Plan gegangen wäre, sicher ersparen wollen. Aber ein Geräusch muss Ihren Bruder erschreckt haben. Er nimmt ja an, dass Sie auf der Toilette sind. Doch er hört jemanden im Garten, er springt auf, und Sie setzen ihm kaltblütig die Pistole auf die Brust. Der Schuss ist höchstens aus einem Meter Entfernung abgegeben worden. Die Obduktion und die ballistische Untersuchung werden das noch genau bestätigen.“
Zum ersten Mal zeigte sich auf Balthasar Federbeins Gesicht ein leichtes, wenn auch etwas mühsames Lächeln.
„Sie haben eines vergessen“, sagte er. „Wie sollte ich durch die scharfen Kontrollen auf dem Flughaben kommen? Sie glauben doch selber nicht, dass ich eine Pistole auf mir tragen konnte.“
„Ich sagte ja auch, dass ich diese Version nicht unbedingt für die richtige halte.“
„Warum erzählen Sie mir denn diese ganze Geschichte? Wollen Sie mir Angst einjagen? Was bezwecken Sie damit?“, fragte Balz.
„Ich bezwecke gar nichts. Ich pflege manchmal nur laut zu denken. Das ist eine Berufskrankheit, falls Sie es noch nicht wissen sollten. Nun, zugegeben, manchmal hat es ganz überraschende Folgen, wenn ich meine Gedanken entwickle. Aber ich bin noch nicht zu Ende“
„Gut, denken Sie weiter, Inspector“, warf Balz ein, und das „Inspektor“ klang wieder ganz amerikanisch.
„Gut, Sie können ja auch ins Zimmer Ihres Bruders gegangen sein und dort aus einer Schublade die Pistole oder den Revolver genommen haben.“
„Woher sollte ich wissen...? Ich bin ja erst einige Stunden in diesem Haus.“
„Zeit genug, ein paar Schubladen aufzuziehen. Sie ahnen ja nicht, wie viele Leute ihre Waffen unverschlossen aufbewahren. Vielleicht kam Ihnen der Zufall zu Hilfe?“
„Sie nehmen doch nicht an, dass ich mich, vorausgesetzt, ich hätte tatsächlich meinen Bruder umbringen wollen, auf den Zufall hätte verlassen können.“
„Herr Federbein, Sie reden ja ganz so, als hätten Sie sich das alles ganz gut überlegt. Mit Vorbedacht.“
„Sie wissen nicht, dass ich einmal die Absicht hatte, einen Krimi zu schreiben.“
„Ich dachte, Ihr Bruder schreibe Romane“, sagte Strahm.
„Ja, schon, aber haben Sie schon einmal einen gelesen?“
Strahm schüttelte den Kopf.
„Dann können Sie natürlich nicht wissen, dass mein Bruder nie einen Krimi geschrieben hätte. Das hätte dann schon etwas ganz Besonderes sein müssen. So weit hätte er sich nicht herabgelassen. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, dass auch ich Phantasie besitze und doch wohl auch einige Erfahrung aus meiner Jugendzeit.“
„Vielleicht wollten Sie mit Ihrem Krimi die Tat im Voraus einmal durchspielen. Doch lassen wir das. Ich gebe ja zu, das mit der Waffe aus der Schublade ist ja auch nicht gerade glaubhaft. Aber auf jeden Fall hatten Sie eine Schusswaffe, und nachdem Ihr Bruder tot war, verwendeten Sie eine Stunde darauf, sie zum Verschwinden zu bringen, die Spuren zu verwischen und den Schreibtisch Ihres Bruders nach Dokumenten, einem Testament vor allem, zu durchsuchen. Irgendetwas müssen Sie ja in dieser Stunde getan haben. Dass Sie nur untätig dagesessen haben, nehme ich Ihnen nicht ab, Mister Federbein. Selbst ein Waagetyp wird sich in einer solchen Situation dazu entschließen können, die Polizei zu rufen.“
„Können Sie nicht verstehen, dass ich einfach wie gelähmt war? Versetzen Sie sich doch in meine Lage. Ich fliege morgens um sechs Uhr in New York ab. Nachmittags um fünf lande ich in Kloten. Der lange Flug, der Jetlag, der Klimawechsel, die Erwartung, nach beinahe dreißig Jahren meinen Bruder…“
„…den geliebten Bruder“, warf Strahm etwas zynisch dazwischen, doch Balz reagierte nicht darauf, sondern fuhr fort:
„…meinen Bruder wieder zu sehen. Die Freude und Erregung des Wiedersehens, die Spannung und die Hoffnung, sich auch geistig wieder zu finden…“
„Was Ihr Bruder ausschlug und sie begreiflicherweise in Wut versetzte. Also nicht vorsätzlich, sondern im Affekt.“
„Sie sind zynisch, Inspector Strääm. Ich verdiene das nicht.“
„Ich sagte doch, ich denke nur. Übrigens hätten Sie noch ein Motiv. Sie verdanken doch Ihrem Bruder ein Jahr im Gefängnis, weil er Ihnen damals nicht zur Flucht verhalf und Sie vor die Tür setzte.“
„Das ist doch Schnee von gestern, Herr Strääm, nach dreißig Jahren?“, parierte Balz Federbein. „Wollen Sie mich jetzt verhaften?“
„Noch nicht“, entgegnete Strahm. „Ich muss noch mehr denken.“
„Übrigens*, wandte er sich an einen Mitarbeiter von der Spurensicherung, „habt ihr schon nachgeprüft, ob Schmauchspuren an Mister Federbeins Händen sind? Und nehmt dann auch gleich seinen Kittel mit ins Labor.“
Als die Spurensicherung abgeschlossen war, trafen die Polizeibeamten Vorbereitungen zur Rückkehr. Ein Polizist trat zu Strahm und übergab ihm die Gegenstände, die sie auf dem Toten gefunden hatten, eine Armbanduhr, Marke Tissot, einen Taschenkalender, ein Portemonnaie mit etwa hundertfünfzig Franken Inhalt, ein angebrochenes Päckchen Medizinalzahnstocher „Stim-U-Dent“, ein silbernes Pillendöschen mit eingravierten Initialen MF und mit drei verschiedenen Sorten Pillen, eine Tabakpfeife mit eingeprägtem M auf dem Mundstück, einen Pfeifenstopfer, einen wildledernen Tabakbeutel und schließlich Auto- und Hausschlüssel.
Strahm überreichte Federbein das Portemonnaie und die Uhr. Alles andere steckte er, sorgsam in ein Plastiksäckchen verschlossen, selber ein. Die Schlüssel behielt er noch eine Weile in der Hand. „Kommen Sie, ich möchte mir noch rasch das Auto ansehen.“
Sie gingen durch das Haus in die Garage, und Federbein zündete das Licht an. Strahm warf nur einen raschen Blick auf den Audi. Dann gingen sie ins Wohnzimmer zurück.
Strahm schaute sich auch hier noch einmal um, weniger, um noch irgendetwas zu entdecken, das zur Aufklärung beitragen könnte, als aus purer Neugierde. Sicher würde auch seine Frau ihn fragen, wie es im Haus eines so berühmten Schriftstellers aussehe. Eigentlich verhältnismäßig bescheiden, dachte er. Es gab hier keinen Swimmingpool, keine goldenen Hähne im Badezimmer, nichts Extravagantes. Nur viele Bücher und einige Bilder, Originale, wie Strahm feststellte, nur zwei in Öl, alles andere Aquarelle von ihm unbekannten Malern.
Aus Zumsteins Zimmer trat Walser.
„Gut, dann dampfen wir ab.“ Und zu Federbein: „Passen Sie auf sich auf! Und halten Sie sich zur Verfügung! Am besten bleiben Sie zu Hause.“
„Ist alles versiegelt, Felix?“, fragte er einen jungen Kollegen, „nichts gefunden? Kein Testament?
„Schwierig bei dem Papier. Lauter Manuskripte, Verträge und Briefe.“
„Gut, du kannst mit uns fahren.“
Nachdem die drei gegangen waren, öffnete Federbein die Tür zum Arbeitszimmer seines Bruders. Der Schreibtisch war versiegelt. Einen Augenblick lang empfand er das Bedürfnis, sich an den Tisch zu setzen. Aber er unterdrückte dieses Verlangen. Vielleicht würde gerade in diesem Moment der Freund Klaus Zumstein eintreten und erschrecken, das genaue Ebenbild des Toten hier in dieser gewohnten Stellung anzutreffen. Er verließ deshalb das Zimmer leise wieder und ging ins Gastzimmer.
Er streckte sich angezogen auf dem Bett aus. Er atmete langsam und tief ein und aus. Zum ersten Mal seit der verhängnisvolle Schuss gefallen war, fühlte er sich ein bisschen entspannt. Er hätte am liebsten geweint, aber er hatte es verlernt. Er war wie ausgetrocknet.
Da hörte er die Tür von Zumsteins Zimmer gehen, und gleich darnach klopfte es an seine Tür. Auf sein „Herein“ trat Zumstein ins Zimmer.
Federbein forderte ihn auf, Platz zu nehmen.
„Entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät noch störe“, sagte Zumstein, und als Federbein sich aufrichten wollte: „Nein, bleiben Sie ruhig liegen. Sie sind sicher müde. Aber da wir nun einmal unter demselben Dach wohnen und einen uns so nahestehenden Menschen verloren haben, meine ich, wir sollten uns doch zuerst einmal kennen lernen. Außerdem interessiert es mich natürlich, was eigentlich geschehen ist. Ich bin ja nur gefragt worden und habe überhaupt nichts erfahren.“
Federbein berichtete, was er schon dem Kriminalbeamten erzählt hatte. Aber als er jetzt von seinem Bruder sprach, überwältigte ihn doch der Schmerz. Immer wieder überschlug sich seine Stimme, und er spürte, wie eine einzelne Träne über die Nasenwurzel zum anderen Auge hinüberrann, dann über die Schläfe und langsam vertrocknete.
Als Federbein mit seinem Bericht zu Ende war, fragte er Zumstein: „Und was haben Sie dem Polizeibeamten erzählt?“
„Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, wie die das ja von einem verlangen“, antwortete Zumstein etwas zynisch im Gedenken an das Verhör, das Walser mit ihm durchgeführt hatte. Doch sogleich merkte er, dass jetzt im Gespräch mit dem Bruder des Toten ein solcher Ton nicht angebracht war.
„Ihr Bruder“, fuhr er fort, „hat mir von Ihrem Brief erzählt, den Sie ihm vor ungefähr zwei Wochen geschrieben haben. Er war überrascht, aber auch erfreut, dass Sie kommen wollten. In der Anfangszeit, nachdem ich hier in dieses Haus einziehen durfte, hat mir Ihr Bruder alles von Ihnen gesagt. Nachher haben wir eigentlich nie mehr von Ihnen gesprochen. Aber Ihr Bruder trug Ihnen nichts nach. Ich glaube, er hat sich aufrichtig auf das Wiedersehen gefreut. Ich hoffe, dass Sie das selber noch spüren durften, ehe…“
„Ja, ich glaube schon.“
Federbein erhob sich nun vom Bett und setzte sich in den zweiten Sessel, der Zumstein schräg gegenüberstand.
„Rauchen Sie?“, fragte er und reichte Zumstein die Zigarettenschachtel, die auf einem Tischchen lag.
„Amerikanische“, fügte er bei. Dann wollte er ihm Feuer geben. Er zog aus der Hosentasche ein Feuerzeug, das aber nicht recht zünden wollte.
„Ach, so geht’s“, sagte Federbein und reichte Zumstein die Flamme.
„Wissen Sie, ich hab das Feuerzeug erst gestern bekommen. Ein Abschiedsgeschenk von einer Freundin.“
Beide rauchten schweigend einige Züge. Erst als Zumstein zum ersten Mal die Asche abstreifte, fragte dieser:
„Und wie denken Sie, dass es nun weitergehen soll?“
„Sie bleiben natürlich hier“, sagte Federbein. „Das ist selbstverständlich. Sie waren schließlich der beste Freund meines Bruders.“
„Darüber können wir später noch reden. Ich möchte nicht, dass Sie sich in der jetzigen Situation zu etwas verpflichten, das Sie später bereuen würden. Nein, ich meine eigentlich, was morgen und in den nächsten Tagen geschehen soll.“
„Vielleicht erzählen Sie mir nun doch zuerst, was Sie dem Polizisten gesagt haben. Ich denke, er hat Sie viel über Mischa ausgefragt.“
„Sie nennen Ihren Bruder auch Mischa?“, fragte Zumstein.
„Nein, Sie haben ihn so gerufen, als Sie heute Nacht vom Garten hereinkamen. Aber es gefällt mir.“
„Ich war ganz überrascht, dass das Haus von der Polizei umstellt war, auf der Straße, im Garten, zwei zogen gerade mit Hunden los, aber offenbar haben sie die Spur verloren. Die Polizisten ließen mich durch, als ich ihnen sagte, wer ich bin und dass ich hier wohne. Ich hörte etwas von Mord. Dann sah ich Sie und glaubte, Sie seien Mischa. Verblüffend diese Ähnlichkeit. Ich wusste dass Sie Zwillinge sind, aber ich habe mir doch nicht vorgestellt, dass man Sie nach so vielen Jahren noch kaum voneinander unterscheiden kann. Im Grunde sehen Sie meinem Freund, als er noch lebte, ähnlicher als dem Toten. Ich habe ihn ja nur rasch gesehen. Aber er sah härter aus.“
„Ja, es ist mir auch aufgefallen“, sagte Federbein. „Der Schreck oder der Schmerz in der Todessekunde scheint seine Gesichtszüge verhärtet zu haben. In den wenigen Stunden, die ich ihn gesehen habe, war er so gelöst, so frei. Seine Gesichtszüge waren weicher. Aber der Tod versteinert alles.“
Beide schwiegen wieder eine Weile. Dann war es Balthasar, der das Schweigen brach:
„Verzeihen Sie die Frage, aber wo waren Sie heute Nachmittag und den ganzen Abend? Sie sind mir ja keine Rechenschaft schuldig, aber es scheint, dass ich des Mordes an meinem Bruder verdächtigt werde, und da verstehen Sie sicher, dass es mich interessiert, was Sie dem Polizisten gesagt haben.“
„Ja, natürlich, Sie haben ein Recht darauf, das zu wissen“, antwortete Klaus Zumstein und zeigte ehrliche Überraschung über den Verdacht, dem der Bruder des Ermordeten offenbar ausgesetzt war.
„Wissen Sie, ich werde ebenso verdächtigt wie Sie. Aber ich habe ein Alibi, das die Polizei morgen wohl überprüfen wird. Ich wollte Ihren Bruder an diesem Tag mit Ihnen allein lassen. Ich bin mit dem Wagen nach Zürich gefahren und habe Renate abgeholt. Das ist meine Freundin. Dann haben wir eine Spazierfahrt an den Vierwaldstättersee gemacht und sind gegen Abend nach Rapperswil gekommen. Im ‚Schwanen‘ haben wir gegessen und sind nachher noch ins Lido ein bisschen tanzen gegangen. Die Klings-Band hat gespielt. Aurelius hat wieder mal so richtig geblufft. Ach, das muss ich Ihnen erklären, das wissen Sie natürlich nicht. Aurelius ist der Sohn von Vera.“
„Und wer ist Vera?“, fragte Federbein.
„Vera Feiner. Sie ist die Geliebte Ihres Bruders. Und Aurelius ist ihr Sohn. Nein, nicht der Sohn Ihres Bruders. Er spielt Trompete in der Klings-Band. Wenn man seine Mutter hört, würde man meinen, er sei das größte Genie und der beste Junge auf der Welt. Dabei ist er ein schwarzes Schaf. – Später hab ich dann Renate nach Hause gefahren.“
„Haben Sie der Polizei von dieser Frau, von Vera erzählt?“, fragte Federbein.
„Ja, ich musste wohl.“
Und von Käthi?“
Sie wissen von…?“
„Ja, mein Bruder hat sie auf der Herfahrt vom Flughafen erwähnt.“
„Ja, auch von ihr.“
„Dumm“, murmelte Federbein vor sich hin und presste die Lippen zusammen und blickte angestrengt vor sich hin, als ob er einem ganz bestimmten Gedanken nachhängen würde.
„Wissen Sie, vielleicht wäre es besser, wenn diese Käthi von einem von uns erfahren würde, was geschehen ist. Nicht dass sie es erst morgen in der Zeitung liest oder in den Nachrichten hört.“
Zumstein stimmte ihm zu.
„Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wer der Mörder meines Bruders sein könnte?“, fragte Federbein.
„Natürlich, aber ich kann mir niemanden vorstellen. Mischa hatte keine Feinde, na ja, wenigstens keine solchen.“
„Und doch hat er einen gehabt“, fuhr Federbein fort. „Ich habe da eine Idee. Wer immer es gewesen ist, ich glaube nicht, dass der gewusst hat, dass Michael noch einen Zwillingsbruder hat, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Können Sie sich vorstellen, wie ein Mann reagieren wird, der einen anderen erschossen hat, dem er auf einen Meter Distanz eine Kugel in die Brust geschossen hat und der ihm nach der Beerdigung, wie der auferstandene Christus seinen Jüngern, erscheint? Das ist unsere Chance, den Täter zu überführen. Glauben Sie nicht auch? Wollen Sie mir dabei helfen?“
„Sie können sich auf mich verlassen, Herr Federbein.“
„Nennen Sie mich Balz.“
„Gerne, und ich bin Klaus. Gute Nacht Balz. Ich glaube, für uns ist es nun Zeit. Es ist schon beinahe Morgen.“
„Sie haben recht. Schlaf gut, Klaus.“
Balz schloss hinter Klaus die Tür zu. Jemand klopfte vom Garten her an die Tür, die vom Gastzimmer in den Garten hinausführte. Balz erkannte einen Polizisten und öffnete.
„Wir sind nun fertig. Wir fahren ab. Wenn Sie Hilfe brauchen, einer von uns bleibt noch draußen im Wagen, bis es hell wird. Auf Wiedersehen.“