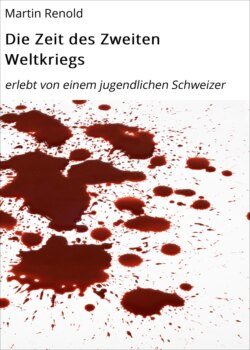Читать книгу Die Zeit des Zweiten Weltkriegs - Martin Renold - Страница 3
Auf meiner Bettkante sitzend
ОглавлениеNeujahr 1989. Noch nichts vom Mauerfall. Nichts von deutscher Wiedervereinigung. Nichts von „wer hätte das noch vor einem Monat gedacht?“
Neujahr 1989. Jahresanfang. Anfang? In der Rundschau von Bayern 3 hinter dem Nachrichtensprecher auf der Karte noch immer die gestrichelten Grenzen des Deutschen Reiches von 1937. Ostpreußen. Pommern. Schlesien. Jenseits von Oder und Neiße. Alte Heimat. Die bösen Polen. Tag für Tag. Um 17 Uhr. Um 18 Uhr 45 schon wieder. Um 21, um 23 Uhr und ein letztes Mal nach Mitternacht.
1989. Helmut Kohl will immer noch nicht. Die Heimatvertriebenen. Als hätte es keinen Krieg gegeben. Keinen Führer. Kein „Heil Hitler!“ Kein „Sieg Heil!“ Kein „Führer befiehl, wir folgen dir!“. Kein „Wollt ihr den totalen Krieg? Ja, wir wollen den totalen Krieg!“
Ich sitze auf meiner Bettkante. Ich, Martin Pfändler. Damals bekamen wir noch diese einfachen Namen: Paul, Emil, Joseph, sogar Adolf. Die Eltern unserer Generation konnten sich noch einen Adolf leisten. Zwei, drei Jahre später verschwanden sie aus den schweizerischen Taufregistern. Die meisten Adolfe ließen sich Dölf rufen.
Vor mir auf dem Boden liegt ein Berg von Büchern, Broschüren, Ordnern. Ein wildes Durcheinander. Ich habe die Möbel meines Zimmers umgestellt. Der Bücherschrank war zu schwer. Ich habe ihn an die Wand gegenüber geschoben. Auf den oberen Tablaren stehen die Bücher schon wieder in Reih und Glied. Auf dem Boden liegt noch der Inhalt des unteren, abgeschlossenen Sockelteils.
Alter Kram. Stiefmütterlich behandeltes Gut. Doch jetzt sollte mal richtig Ordnung geschaffen werden. Unnützes in die Altpapiersammlung. Was der strengen Prüfung standhält, kann weiter gelagert werden.
Ein Ordner, Korrespondenz, mindestens zwanzig Jahre alt, findet keine Gnade. Weg damit.
Manuskripte, vor Jahren geschrieben, zwei-, dreimal kopiert, aber nie veröffentlicht, kommen auf das obere Tablar, ganz links außen.
Vor mir liegt eine Illustrierte. Ich blättere. Farbige Aufnahmen von den ersten Menschen auf dem Mond. Ein kurzes Zögern. – Doch: Das ist ein Zeitdokument. Vielleicht werden meine Nachkommen einmal danach greifen. Mein Sohn. Nach meinem Tod. Wird darin blättern. Wird es ein Leben lang aufbewahren. Für seinen Sohn. Auch die zwei Nummern von „Sphere“ und die „Illustrated London News“ aus der Kriegszeit mit den gemalten Seeschlachten unter schwarzem, blitzezuckendem Himmel und den Luftaufnahmen ausgebombter deutscher Städte, die aussehen wie schwarze Setzkästen, in denen früher die Setzer in den Buchdruckereien die bleiernen Lettern aufbewahrten.
Und dann sind da einige dünne, vergilbte Broschüren. Ach ja, die habe ich nach dem Tod meiner Mutter beim Räumen ihrer Wohnung an mich genommen. Stockfleckig liegen sie in meiner Hand. Mein Vater, Otto Pfändler, überzeugter Sozialdemokrat, elf Jahre vor meiner Mutter gestorben, hat sie seinerzeit gekauft. Als sie noch nicht stockfleckig waren. Als noch Explosivkraft in ihnen steckte.
Der modrige Duft des Papiers erinnert mich an die Zeit meiner Jugend in St. Gallen. Die Buchhandlung in der Schmiedgasse, wo ich als kleiner Angestellter im Keller nach alten Ladenhütern geschmökert habe. Immerhin fand ich einige Kostbarkeiten. Eine Dünndruckausgabe von Gustav Freytags „Soll und Haben“ für RM 2,40. Und Otto Weiningers „Geschlecht und Charakter“, das ich später der Altpapiersammlung mitgab, weil es meiner Frau in die Hände geraten war und ihr Selbstbewusstsein erschüttert hatte. Frauen hätten keine Seele, behauptete er, und die Juden, die er den Frauen gleichsetzte, demzufolge auch nicht. Meine Frau, sie ließ sich später von mir scheiden, war beeindruckt. Vielleicht hatte er recht. Nicht wegen der Juden. Sie war keine Emanze. Sie empörte sich nicht. Im Grunde hatte ich ihr Selbstwertgefühl zerstört. Ich hatte ihr eine andere Frau vorgezogen. In Weininger fand sie die Begründung. Was half es, dass ich ihr einhämmerte, Weininger sei an seiner falschen Theorie selbst zugrunde gegangen, habe mit einundzwanzig Jahren Selbstmord verübt. Das Gegenteil war der Fall. Wer mit zwanzig Jahren oder früher so was schreibe, sei ein Genie. Und wer keine Seele besitze, könne gleich Schluss machen. Ich musste ihr das Buch wegnehmen. Ich nehme an, heute hat sie Weininger vergessen.
Ich schnuppere gern an alten Sachen. So steigen Erinnerungen auf. Ich schaue auf den Titel: „Wie ist Hitler zur Macht gekommen?“ Eine Flugschrift, herausgegeben in Zürich, datiert vom Juli 1933. Auf der letzten Seite ein Zwischentitel: „Die große Gefahr“: Was wird nun weiter in Deutschland geschehen? Werden dem Volke bald die Augen aufgehen? Dies scheint wenig wahrscheinlich. Die Hitler-Regierung wird… jede Opposition im Keime rücksichtslos unterdrücken und noch lange auf ihrer Seite geborene Untertanen haben, die in Deutschland vorläufig noch sehr zahlreich sind … hat sie durch den Judenboykott viel Porzellan zerschlagen … Was den inneren Frieden betrifft, so kann es sich hier nur um die Ruhe des Friedhofs handeln. Was aber den äußeren Frieden angeht, so wäre es ein Wunder, wenn das Dritte Rich ihn lange genießen könnte.“
Das zweite Heft trägt mit roten Lettern den Titel: „Der Aufstand der österreichischen Arbeiter“. Erschienen am 19. Februar 1934 in Prag. Wie ich darin blättere, fällt ein kleiner Zettel heraus. Ein Lieferschein der Fabrik „Rätia“ A.-G. Chur. „Diplom 1. Klasse – Goldene Medaille“ steht in kleinen, geschwungenen Lettern unter dem Firmennamen. Die verblasste Handschrift kann ich nur mit Mühe lesen. 27.2.1934. Darunter die Anschrift meines Vaters. Otto Pfändler, Scheidwegstraße 13. St. Gallen.
Und dann die gelieferte Ware: 3 kg Stachelbeer. Nein, Stachelbeeren im Februar? Das kann wohl nicht sein. Ich trete ans Fenster. Jetzt kann ich es entziffern. Ich schließe die Augen und sehe auf einmal einen Kessel vor mir mit einem zähen, schwarzen Inhalt. „Natürlich: Wacholder. „Wacholderlatwerge“ oder, wie meine Patin sagte, „Räckholderlattwäri“. Eingedickter, gezuckerter Wacholdersaft.
Ich schaue hinaus und weiß nicht, träume ich oder bin ich wach. Mein Blick geht zu den Jurabergen. Sie sind von starkem Raureif bedeckt. Geschneit hat es nicht. Weihnachten war wieder einmal grün. Der Schnee lässt noch auf sich warten.
Mein Blick geht weiter als bis zur Wasser- und zur Gislifluh. Die Hügel dort hinten sind der Kaien und die Eggersrieter Höhe. Ich stehe im Haus in St. Gallen an der Scheidwegstraße 13. Baujahr 1904. Diese Zahl stand in dem dreieckigen Mauergiebel gerade unter den beiden Stubenfenstern unserer Wohnung im zweiten Stock. Ob der wohl noch dort steht, nachdem der neue Besitzer das Haus renoviert hat? Damals hat die Mutter, keine zwei Monate nach Vaters Tod, die Kündigung bekommen. Am 24. Dezember, am Heiligabend, lag sie in ihrem Briefkasten. Frohe Weihnachten. Es war der Nachbarssohn, den sie schon als Schuljungen gekannt hatte. Jetzt führte er den Betrieb seines Vaters. Seine Mutter hatte uns voller Stolz erzählt, dass ihre Firma das neue Kirchturmdach der katholischen Kirche in St. Georgen errichtet habe.
Meine Erinnerung geht weiter zurück. Eine Woche nach Lieferung der Wacholderlatwerge wurde ich sieben Jahre alt. Meine Schwester war mehr als neun. Sie behauptete immer, drei Jahre älter als ich zu sein. Sie zählte nur die Jahreszahlen. 1924 und 1927. In Wirklichkeit war sie nur zwei Jahre und vier Monate älter. Ihre Angeberei ärgerte mich.
Noch jetzt, oder richtiger, jetzt wieder fühle ich die klebrige Masse in meinem Mund. Ein Kessel „Latwäri“ steht vor mir auf dem Tisch. Wenn man mit dem Messer hineinstach und es wieder herauszog, rann ein langer schwarzer, immer dünner werdender Faden herab. Mutter verstand es, das Messer so rasch zu drehen, dass der größte Teil auf dem Messer blieb und bald nur noch einige zähe Tropfen in den Kessel zurückfielen. Dann rasch das Butterbrot daruntergeschoben, die glänzende Masse darauf verstrichen. Jetzt sah sie goldbraun aus. Auf den Teller mit der Brotscheibe. Mitten durchgeschnitten. Das Brot mussten wir schön waagrecht halten, sonst lief uns der klebrige Saft wie Lava über die Finger. Dann musste man sie ablecken und gleich danach die Hände unter dem kalten Wasserstrahl über dem Schüttstein waschen.
Warmes Wasser gab es nicht. Höchstens im Winter aus dem Ofenrohr. Da stand immer eine alte Emailkann voll Wasser. Am Morgen durfte jedes einen Viertel daraus in ein Becken und ein Glas gießen, etwas kaltes Wasser dazu, dann den Waschlappen in das Becken getaucht und danach die Zahnbürste ins Glas Mit dem noch warmen, feuchten Waschlappen drückte ich ein Loch in die Eisblumen am Küchenfenster. Oft klebten die Vorhänge an der Scheibe. Manchmal versuchte ich, mit dem Lappen das Gewebe aus dem Eis zu befreien. Ich musste rasch handeln. Sonst gefror das Wasser sogleich wieder. Das feine Gewebe zerriss oft, wenn ich ungeduldig daran zerrte. Ich erinnre mich nicht, dass Mutter je gescholten hat.
„Iss dein Brot!“ Aus fünfundfünfzig Jahren Entfernung dringt Mutters Stimme an mein Ohr. „Die Wacholderlatwäri ist gesund. Oder möchtest du lieber Lebertran? Na, also!“
Nein, schlecht war sie nicht, die Wacholderlatwerge. Aber drei Kilogramm? Bis die aufgezehrt waren! Da wurde es Sommer, bis die erste Erdbeerkonfitüre eingekocht war. Da konnte einem der Appetit schon vergehen. Aber jetzt fühle ich, wie mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Auf der Zunge fühle die die Konsistenz wie von flüssigem Honig.
Ich setze mich wieder auf die Bettkante.
„Ein Kulturvolk protestiert“ ist der nächste Titel. „Die öffentliche Meinung Englands über den Hitler-Terror“. 34 Seiten. Keine Jahreszahl. Ich beginne zu lesen und stelle fest, dass die Schrift 1933 erschienen sein muss:
Die antisemitischen Ausschreitungen der letzten paar Wochen sind weit schlimmer, als man sich anfänglich hätte vorstellen können … Diese Exzesse sind … das Ergebnis einer jahrelangen antisemitischen Propaganda der Nazis, einer Mittelstandspartei, die von Bankiers, Industriellen und Geschäftsleuten unterstützt wird. Diese Partei hat ihren Anhängern in Versammlungen, Zeitungen, Büchern und Broschüren den Juden als ekelhaft und böse hingestellt. Die Agitation der Nazis war eine fortwährende Aufreizung zu Pogromen, und der Hauptanstifter ist Adolf Hitler, der deutsche Reichskanzler.
So zu lesen am 27. März 1933 im „Manchester Guardian“, fünfeinhalb Jahre vor der Reichskristallnacht.
Jüdische Geschäfte wurden geschlossen und geplündert, jüdische Wohnungen durchsucht und demoliert und Hunderte von Juden misshandelt und beraubt.
Am Abend des 15. März verhafteten Braunhemden drei Juden im Café New York und brachten sie in einem Auto nach dem SA-Lokal in der Wellnertheater-Straße, wo sie um einige hundert Mark beraubt, mit Gummiknüppeln blutig geschlagen und in halb bewusstlosem Zustand auf die Straße geworfen wurden.
Und am 20. April 1933: Der braune Terror verschärft sich täglich … Alle Gewerkschafter, bürgerlichen Pazifisten, Sozialisten, Kommunisten und Internationalisten, die irgendwo als Organisatoren, Schriftsteller, Redner … eine Rolle gespielt haben, sind fast in ganz Deutschland durch Entlassung, durch Misshandlung oder durch Verhaftung gefährdet … Gegen die Braunhemden gibt es keinen Schutz … Die Opfer sind völlig wehrlos.
Angehörige der Sozialdemokratischen Partei werden in der Regel durch dreißig Hiebe mit Gummiknüppel auf den entblößten Rücken, Mitglieder der kommunistischen Partei mit vierzig Hieben bestraft … Der Terror ist so entsetzlich und die Zahl der Opfer so gewaltig, dass er weder in Deutschland noch im Ausland geheim gehalten werden kann. Die vielen Tausende mit wunden Rücken, bandgierten Köpfen, zerschundenen Gesichtern, gebrochenen Gliedern oder Zähnen, die mit Stichwunden, Schusswunden … in Spitälern liegen oder durch die Straßen hinken –, sie alle sind Beweis genug.
Ich lese nicht weiter. Später. Später. Jetzt muss ich aufräumen. Aber meine Gedanken sind ganz in jener Zeit. Mein Erinnerungsvermögen, was die Politik betrifft, reicht allerdings nicht so weit zurück. 1930 – das ist eine meiner frühesten Erinnerungen – sind wir vom Westen der Stadt, von Straubenzell, ins Krontal, im Kreis Ost gezogen. Meine Patin hat mich und meine Schwester Ruth am frühen Morgen abgeholt. Im Tram – so sagt man in der Schweiz zu der Straßenbahn – saß ich links von meiner Patin, Ruth rechts von ihr. Ich sehe es noch genau. Uns gegenüber die lange Bankreihe unter den Fenstern, vor denen die Häuser vorüberziehen. Als wäre es gestern gewesen. Nicht vor bald sechzig Jahren. Vom Nachbarsgarten aus, wo meine Patin wohnte, im Stockwerk über jenem Jungen, der dreißig Jahre später am Heiligabend einen tränenauslösenden Umschlag in Mutters Briefkasten warf, schauten wir zu, wie die Zügelmänner und auch Vater die Möbel ins Haus trugen. Eben kam Vater vorbei mit dem großen gelben Schaukelpferd, das ich von meinem Götti, dem Schreinermeister in Brunegg, geschenkt bekommen hatte.
„Ich möchte reiten – gib mir das Gampiross über den Zaun!“
„Heute nicht, jetzt wird zuerst einmal alles versorgt.“ Und schon war er über die fünf Stufen und durch den Eingang verschwunden. Tränen gab’s keine. Aber die Enttäuschung war groß. Nicht wegen des Gampirosses. Nein. Weil Vater so hart sein konnte. So kannte ich ihn gar nicht. Hatte er in seinem Eifer überhaupt richtig zugehört? Spürte er nicht, was mir dieses Schaukelpferd bedeutete? Gerade jetzt, in dieser neuen, unbekannten Umgebung – etwas Vertrautes, etwas, das allein mir gehörte.
„Weißt du, Vater hat jetzt keine Zeit“, erklärte mir die Patin. Ich verstand nicht. Er hätte das Gampiross doch nur über den Zaun heben müssen. Doch drei Schritte vor meiner Nase, die ich durch den Maschenzaun steckte, trug er es vorüber.
Diese erste Erinnerung an meinen Vater hat meine spätere Beziehung zu ihm nicht geprägt. Eigentlich, so scheint mir, ist dies die einzige negative Erinnerung. Freilich, Vater war wortkarg, manchmal etwas mürrisch – zärtlich? Nein, kaum, aber nie bös, nie, dass man sich vor ihm hätte fürchten müssen. Fröhlich kannte ich ihn eigentlich nur später, wenn er etwa mit seinen Kameraden vom Straßenbahner Männerchor zusammen war, oder in den Ferien, wenn wir ein paar Tage mit andern Mitgliedern vom Touristenverein „Die Naturfreunde“ in der Hütte auf der Schwägalp am Fuße des Säntis oder auf der Amdener Höhe verbrachten. Aber die Korrektheit, ja, das war er in Person. Er verachtete Menschen, die sich nicht im Zaum halten konnten, die über die Hutschnur tranken, Öl am Hut hatten, wie die Mutter zu umschreiben pflegte. An heißen Sommertagen auf Ausflügen, wenn wir einkehrten und wir Kinder – Höhepunkte der Familienausflüge – einen Sirup und einen jener klebrigen Nussgipfel bekamen, dann trank er einen Becher Dunkles. Helles Bier war damals allgemein nicht gefragt. Wer ein Helles trank, galt schon beinahe als ein Snob.
Genau datierbare Erinnerungen an die frühesten Jahre in meinem Leben gibt es nicht. Eine Jahreszahl. 1933. Vater besaß ein Radio, eine schwarze, viereckige Kiste mit zwei großen drehbaren Knöpfen. Selber gebastelt. Wenn er vom Dienst nach Hause kam, stülpte er sich den einen der zwei Kopfhörer über die Ohren. Abends, wenn wir im Bett waren, setzte sich Mutter zu ihm unter den zweiten Kopfhörer. Wenn Vater Spätdienst hatte, las Mutter meist in einem Buch – sie selber besaß nur wenige – oder im Heftli. Zwei hatte man abonniert. Das eine, „Der Aufstieg“, der Weltanschauung wegen, das andere „In freien Stunden“, wegen der Versicherung.
Einmal hat Vater einen langen, langen Draht zum Küchenfenster eines Freundes vom Elektrizitätswerk, der schräg gegenüber wohnte, gespannt. Antenne hieß dieses Ding. Unter dem Tischchen, auf dem das Radio stand, befanden sich zwei schwere Holzkistchen, fast so groß wie das Radio selber. Von Zeit zu Zeit musste sie Vater ins Ewe tragen. Das Ewe befand sich nahe bei Tramdepot und bei den Gaskesseln, die seltsamerweise mal hoch, mal niedrig waren. Wenn Vater die beiden Kistchen nach zwei oder drei Tagen zurückbrachte, waren die schwarzen Dinger mit dem komischen Zapfen – Batterien nannte sie Vater – wieder aufgeladen, und die Eltern konnten wieder die Kopfhörer aufsetzen und an den Knöpfen drehen und den Stimmen und der Musik lauschen, die auch ich hörte, wenn mich einmal der Gwunder, die Neugier, stach und ich einmal für ein paar Augenblicke die schwarzen Schalen über meine Ohren stülpen durfte.
Eines Tages kam ein Mann. Mein Vater musste ihm etwas zahlen. Und dann klebte der Mann eine Marke auf die Sperrholzrückwand. Wie jene Abziehbildchen, die wir in der Apotheke bekamen, wenn Mutter Medizin oder Hustensirup für uns oder Kopfwehpulver für sich holte. „1933“ und daneben ein Schweizer Kreuz. Und klein darunter „Konzession bezahlt“ oder etwas Ähnliches.
Und in diesem Jahr 1933 stand also im „Manchester Guardian“ zu lesen: Der Terror ist so entsetzlich, dass er weder in Deutschland noch im Ausland geheim gehalten werden kann.
Und trotzdem „Sieg Heil“ und „Führer befiehl“. Später habe ich diese Rufe selber gehört am Radio, an dem auch in den folgenden Jahren immer noch dieselbe Marke mit der Jahreszahl 1933 klebte, bis die schwarze Kiste eines Tages durch ein kleines schmuckes Kästchen ersetzt wurde. Auf der Vorderseite bespannt mit braunem Stoff. An der Wand ein großer runder Schalter. Kabellautsprecher. Rediffusion. Drei Linien zur Auswahl. Die Antenne zum Nachbarhaus wurde heruntergeholt.
Ich war empört über diesen Adolf Hitler, diesen Schreihals, und die Millionen Schreihälse, die mit ihm schrien. Konnte denn ein ganzes Volk diesem Mann zujubeln? Durchschaute ihn niemand? Wie konnten erwachsene Menschen so blind und dumm sein?
Noch immer sitze ich auf der Bettkante. Durch die stockfleckigen Broschüren in meiner Hand sehe ich auf einmal orangenfarbige Zettel, etwas kleiner als Postkarten. Von Frau Stadler, die in der Buchdruckerei Tschudy arbeitete, hatten meine Schwester und ich sie zum Zeichnen erhalten.
Damals war ich schon etwas älter. Aber es war noch vor dem Krieg. Ich ging in die vierte oder fünfte Klasse. Vater besaß eine alte Portabelschreibmaschine Marke „Erika“. Occasion. Manchmal ließ mich mein Vater darauf schreiben. Etwa zehn solche orangefarbige Zettel hatte ich eines Tages eingespannt. Einen nach dem andern. Und auf jeden schrieb ich den gleichen Text. Er war mir spontan eingefallen. Und ich habe ihn mein Lebtag nie vergessen:
Als Hitler mit der großen Schnauze
vor der Reichstagsrede stand,
schimpfte er und schnauzte
und rühmte nur sein Land.
Aber plötzlich kam ‚ne Kugel,
schoss den alten Gauner tot,
und im ganzen Land ertönte:
Nun gibt’s ein Ende mit der Not.
In der Schule verteilte ich diese kindlichem Empfinden und Wunschdenken entsprungenen, unbeholfenen Verse. Heimlich. Der Elf- oder Zwölfjährige wurde zum politischen Agitator. Ich hörte von Spitzeln. Fröntler oder Frontisten – wie man sie nannte – gab es auch in St. Gallen. Ich hatte keine Angst. Unter den Eltern meiner Schulkameraden waren bestimmt keine, auch später im Gymnasium wusste ich niemanden, der aus einem solchen Hause gestammt hätte.
Mario Karrer, der Name kommt mir jetzt wieder in den Sinn, war ein solcher Fröntler. Eine Schande sei es gewesen, hat Vater später noch immer gesagt, dass so einer im „Schützengarten“ öffentlich auftreten durfte und zweitausend Zuhörer gekommen waren. Natürlich nicht nur aus St. Gallen. Karrer hatte ja damals nur etwa achthundert Getreue im ganzen Kanton und im Appenzellerland. Viele waren wohl nur aus purer Neugier gekommen. Es war eine Schande.
Ein anderes Mal war Vater aufgebracht, als es hieß, ein ganzer Zug von Fröntlern aus der ganzen Ostschweiz sei von St. Gallen aus nach Zürich gefahren. Hakenkreuzfahnen hätten am Versammlungslokal gehangen. Schämen müsse man sich, dass so etwas in der Schweiz vorkomme. Am schlimmsten sei es in Schaffhausen. In diesem kleinen Kanton rechne man mit zwei- bis dreitausend Fröntlern. Viele von ihnen hofften auf einen Anschluss der Schweiz an Deutschland, manche bereiteten ihn sogar vor.
Auch Namen wie Mettler wurden als Nazi genannt. Und die Rolle von Hausamann, einem Hauptmann und späteren Major der Schweizer Armee, schien dubios. Später lernte ich ihn kennen. Ich sah ihn oft in der Stadt. Nun war er ein älterer Herr. Hager, groß, gut gekleidet und von aristokratischer Haltung. 1945 war seine Rolle – er betrieb einen privaten Nachrichtendienst, das Büro Ha – richtig bekannt geworden. Bis zur Machtergreifung Hitlers hatte er wohl vom Nationalsozialismus einiges erwartet. Ein Freund der Sozis und der Kommunisten war Hausamann sicher nicht. Bald aber erkannte er, was da gespielt wurde. Seine Beziehungen zu wichtigen Stellen und Männern in Deutschland benutzte er nun, um geheime Nachrichten an den Chef des Eidgenössischen Militärdepartements, an General Guisan und wahrscheinlich auch an alliierte Stellen weiterzuleiten. In einem amtlichen Bericht des Bundesrates wurde ihm 1947 bescheinigt, dass „er mit der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgabe dem Land wertvolle Dienste geleistet hat“.
Auch unter den Unterzeichnern der „Eingabe der 200“, die die Presse mundtot machen wollten und „Anpassung“ forderten, befanden sich einige St. Galler.
Allerdings, von über tausend Nazifreunden in der Stadt St. Gallen zu reden, wie das später einige taten, die jene Zeit nicht miterlebt haben, wäre doch übertrieben. 1942 wurde jener Mario Karrer von den zweihundert Mitgliedern seiner Partei in den Kantonsrat gewählt. Doch schon bald wurde seine Partei verboten, und Karrer verlor sein Mandat.
Nein, St. Gallen, das damals über siebzigtausend Einwohner zählte, als nazifreundlich zu bezeichnen, ist eine üble Verleumdung. Karrer hatte im ganzen Kanton kaum mehr als die zweihundert Stimmen seiner Gefolgsleute erhalten. Ein recht kleines Häufchen. Dumme und Unverbesserliche gibt es ja immer und überall.
Trotzdem war Vorsicht geboten für meine Agitationstätigkeit. Doch, so dache ich, in der Schweiz gelten noch Recht und Gerechtigkeit und Anstand und gesunder Menschenverstand. Besaß ich, der Elfjährige, solchen und Millionen deutscher Männer und Frauen nicht?
Auf dem vierten Heft in meinen Händen prangt auf rotem Hintergrund ein Portrait Hitlers mit zugekniffenem Mund und starrem Blick. Sieht man ihm nicht den Wahnsinnigen an?
„Hitler rast – Die Bluttragödie des 30. Juni 1934“. Ich überfliege das Vorwort:
In vielen deutschen Papiergeschäften sieht man eine Fotografie: Adolf Hitler beugt sich zu einem kleinen Mädchen nieder, das ihm einen Blumenstrauß überreicht. Der Reichskanzler lächelt, denn mit einem so unschuldigen kleinen Wesen muss man ja lächeln. Aber dieses Lächeln sieht merkwürdig aus; die Kinnladen sperren sich nussknackerartig auseinander, das Gesicht hat etwas Verzerrtes, Ausdruckloses. Man fürchtet, im nächsten Augenblick werde er das Mädchen beißen. So wird er dem deutschen Volke gezeigt: der gütige Führer, der Freund des Volkes, der einfache, bescheidene Mensch. Selten sind die Augenblicke, in denen er sich ganz zeigt, wie er wirklich ist. Jetzt ist das einmal ausnahmsweise geschehen. Die Welt hat einen Tag erlebt, an dem Adolf Hitler ganz aus sich heraustrat. Das war der Blutsamstag vom 30. Juni. Der Tag wird in Deutschland nicht so bald vergessen werden.
Es ist schon viele Jahre her. Adolf Hitler vergoss damals noch kein Blut, er sprach nur viel davon. Er wetterte und drohte, wie er, wenn er erst die Macht habe, seine Gegner köpfen und erschießen werde. „Jawohl!“, rief er in einer Versammlung, „man fragt uns: ‚Werdet ihr’s denn wirklich übers Herz bringen, eure Gegner hinzumachen?‘ Seid überzeugt: wir werden’s übers Herz bringen!“
Ich erinnere mich. Nach Mutters Tod habe ich diese Broschüre gelesen. Es ist die Geschichte vom Mord an Röhm, die Geschichte von Schleicher, Strasser, Papen und Konsorten.
Auch dieses Heft lege ich beiseite. Später. Ich werde mein Wissen auffrischen. Die Vergangenheit lässt mich nicht los. Ich muss daran denken, dass mein Vater all diese Broschüren gelesen hat. Er nahm ihre antifaschistische Gesinnung in sich auf. Gesprochen hat er nicht viel davon. Nicht vor uns Kindern. Und doch hat er diese Gesinnung geteilt, und sie ist schon damals auf mich übergegangen.
Bleibt noch das letzte Heft, das am wenigsten vergilbte. Auch da ein roter Umschlag. Eine Fotografie von einem Friedhof. Im Hintergrund ein paar Grabsteine, vorn ein aufgeschüttetes Grab ohne Kreuz, ohne Stein, ohne Umrandung, ohne Blumen. Darunter der Titel „Mein Herz schlägt weiter“. Briefe aus der Schutzhaft von Felix Fechenbach. Kultur-Verlag St. Gallen. 1936. Das Vorwort von Heinrich Mann.
Wer war dieser Felix Fechenbach? Sein Name ist meiner Erinnerung bekannt. Ein Dichter und Schriftsteller. Redakteur des sozialdemokratischen Parteiblatts in Detmold, das Anfang März 1936 verboten wurde.
Felix Fechenbach wurde am 11. März 1933 in „Schutzhaft“ genommen und am 7. August 1933 „auf der Flucht“ erschossen.
So steht es lapidar in der Einführung zu diesem schmalen Buch. Und auf der letzten Seite: Fechenbach sollte in ein Konzentrationslager überführt werden. Auf der Paderborner Chaussee, nahe dem Ort Scherfede, hielt der Wagen, wurde Felix Fechenbach in eine Waldlichtung gezerrt … An dem völlig versteckten Ort fand man später in einer Blutlache das zerrissen Uhrenarmband des Toten. Erst auf dem Umweg über das Ausland wurde bekannt, wann und wo Felix Fechenbach geendet hatte. Man weiß, dass, nachdem der Antrag auf Freigabe der Leiche genehmigt war, ein Stirnschuss an ihr festgestellt wurde. Gegen diese Feststellung wusste der anwesende Arzt nichts zu erwidern, als dass man schweigen solle.
Zwischen diesen beiden Fakten stehen die Briefe und Kurzgeschichten, die Fechenbach während der Haft schrieb.
Ich blättere. Eine kleine Fotografie zeigt die drei Kinder Fechenbachs, einen Jungen und zwei Mädchen. Das ältere musste damals etwa fünf oder sechs Jahre als sein, also nicht viel jünger als ich. Ich blättere weiter. „Schlafliedchen für Lotte“ steht über drei kurzen Strophen:
Schlaf, Lotte, schlaf,
und sei recht lieb und brav,
dann sing ich dir ein Liedchen fein
vom Hahn und seinen Hühnerlein.
Schlaf, Lotte, schlaf:
Ich erinnere mich genau. Meine Eltern, Vater und Mutter, haben von Felix Fechenbach und seinem Schicksal erzählt.
Wieder klingt Mutters Stimme in meinen Ohren. Dieses „auf der Flucht erschossen“. Sicher hat sie dieses kleine Buch gelesen. Aber sie sprach nicht wie von etwas Gelesenem. Es klang, auch jetzt in meiner Erinnerung, wie etwas unmittelbar Erlebtes. Aber warum hat sie es erzählt? Ich musste damals schon etwas älter gewesen sein.
Natürlich. Lotti Fechenbach. Dieses blonde Mädchen auf dem Bild. Das hab ich doch selber gekannt. War das nicht jenes Mädchen, mit dem ich 1939 zuerst im Volkshaus in St. Gallen und dann an der Landesausstellung in Zürich in jenem Theaterstück „Pechvogel und Glückskind“ gespielt habe? Der Pechvogel war ich, und Lotti, sie war das Glückskind. Oder spielt mir die Erinnerung einen Streich? Aber jenes Glückskind war eine Deutsche, ein Flüchtling. Die Zusammenhänge werden mir klar. Franz Schmid, der Redakteur der „Volksstimme“, hatte die Mutter mit den drei Kindern unter seine Obhut genommen. Kultur-Verlag – der gehörte wahrscheinlich zur „Volksstimme“. Bald nach der Aufführung in Zürich, noch vor Ausbruch des Krieges, war Lotti mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nach England ausgewandert.
„Glückskind“ – ein Glückskind, dessen Vater angeblich „auf der Flucht“ erschossen wurde? Und ich als Pechvogel. Ich erinnere mich noch genau an die beiden Kostüme, die ich trug. Eines zerlumpt, eines Pechvogels würdig, das andere das eines Prinzen mit Pluderhosen und Barett. Auf einem Spaltstock aus Pappe musste ich mit einem hölzernen Beil Holz spalten. Es gibt Löcher in meiner Erinnerung. Irgendwie begegnete ich der Prinzessin Glückskind und bekam einen Kuss von ihr. Da wurde sie sehr, sehr traurig. Und sie erzählte ihrem Vater, dem König, warum sie so traurig war. Ein zerlumpter Junge hatte ihr einen Kuss geraubt. Doch er war ein gütiger König, und er schickte Boten ins Land hinaus, dass sie den Jungen suchten und er seiner Tochter den Kuss zurückgeben konnte, damit sie wieder glücklich wurde. Und die Häscher fanden mich und führten mich gefesselt vor den König. Der aber löste mir die Stricke, und ich bekam neue Kleider, musste der Prinzessin den Kuss zurückgeben und durfte sie heiraten.
Und das alles war so gekommen. Schuld war eigentlich die Frau Stadler von der Buchdruckerei. Bei ihr in der Druckerei oder zu Hause durfte ich – wann ich nur wollte – Abfallpapier holen. Ach, was waren da für schöne bunte Papiere dabei, große Blätter und kleine, gummierte Reste, aus denen man Sterne oder einen Mond, ganze Häuser und Kirchen und Wälder schneiden und zu nächtlichen Bildern auf mattschwarze Bögen kleben konnte.
Lieber als in der Druckerei holte ich das Papier bei Frau Stadler zu Hause. Das hatte seinen Grund. Ihr Sohn, der Elektriker, besaß nämlich eine Eisenbahn. Nicht irgendeine, wie man sie in Spielwarenladen kaufen konnte. Mit seinen Schalthebeln brachte er gleich drei Lokomotiven und viele Wagen zum Fahren und zum Stehen und zum Manövrieren. Eine riesige Hügellandschaft, die auf Brusthöhe ein ganzes Zimmer einnahm, hatte er selber gebaut. Und die Schienen und die Fahrleitungen, die Signale, alles von Hand gemacht. Wenn einmal ein Zug entgleiste, kroch Paul unter den grünen Vorhang, und dann tauchte irgendwo zwischen den Hügeln Pauls Kopf auf, und ein Arm zwängte sich durch die enge Öffnung, die Hand streckte sich aus und stellte Lokomotive und Wagen wieder aufs Gleis.
Paul war der Leiter der „Roten Falken“. Eines Tages fragte mein Vater mich und Ruth: „Wollt ihr nicht auch zu den Roten Falken gehen? Paul Stadler holt euch morgen Nachmittag ab.“
Ich hatte keine Ahnung, was für Vögel diese Roten Falken waren. So eine Art Pfadfinder, erklärte uns der Vater.
Anderntags läutete Paul an der Tür. Wir beide mochten ihn. Er war fast so etwas wie ein großer Bruder.
Von da an gingen wir jede Woche ins Buchenwald-Schulhaus.
Im Sommer, bei schönem Wetter, traf man sich allerdings oft auch anderswo, wanderte dann über die Hügel, streifte durch die Wälder, spielte auf einem einsamen Waldweg Völkerball oder hatte Gelegenheit, ein paar Rehe zu beobachten. Wir sagten „Freundschaft“, wenn wir uns begegneten oder verabschiedeten. Nicht „Gruezi“ oder „Tschau“. Freundschaft war ein schönes Wort. Doch als Begrüßung kam es mir nur zögernd über die Lippen.
Einige der Jungen und Mädchen trugen blaue Hemden mit einem roten Halstuch, das sie zu einem Dreieck zusammengelegt über die Schulter trugen und vorn verknoteten. Meine Schwester und ich hatten keine Uniform. Vielleicht weil Vater kein Geld dafür hatte. Uns war’s recht. So fielen wir auf dem Hin- und dem Heimweg nicht auf.
Die Italienerkinder im Buchwaldquartier, das als „Tschinggenviertel“ bekannt war – Mutter kaufte dort immer vor Weihnachten in einem kleinen Laden einen großen Salami –, riefen uns so schon „Sozi“ nach. Hätten wir uns in der Abenddämmerung nicht auf Umwegen heimgeschlichen, hätte es wohl auch Prügel absetzen können. Besonders im Winter, wenn es abends schon dunkel war, begleitete uns die Angst.
Agitation, wie ich mit meinem Hitler-Vers, gegen die Nazis oder für die Roten betrieben wir nicht. Wir standen im Werkraum des Schulhauses um die Tische und bastelten oder saßen auf den breiten Fenstersimsen und sangen Lieder, die man in der Schule nicht lernte:
Brüder, zur Sonne, zur Freiheit,
Brüder, zum Licht empor,
hell aus dem dunklen Vergangnen
leuchtet die Zukunft hervor.
Oder aber auch „Die Internationale erkämpft das Völkerrecht“. Oder harmlosere wie „Schwarzbraun ist die Haselnuss“.
Und dann kam eines Tages Franz Schmid. Wir durften Franz zu ihm sagen.
Er erzählte von der geplanten Landesausstellung und dass es dort ein Kinderparadies gebe. Wir seien allerdings schon zu alt. Das sei nur für die Kleinen, die dort abgegeben würden, damit ihre Eltern in Ruhe durch die Ausstellung gehen könnten. Dort sollten wir ein Märchenspiel aufführen. „Pechvogel und Glückskind“. Dazu brauche er ein paar Schauspieler, Knaben und Mädchen, die gut auswendig lernen könnten.
„Was meinst du? Wie heißt du? Martin Pfändler. Ach so, du bist der Bub vom Otto Pfändler. Du könntest den Pechvogel spielen. Frag doch einmal deinen Vater. Oder soll ich’s tun?“
Und so kam es, dass ich Woche für Woche im Volkshaus probte. Und Woche für Woche fieberte ich jener kurzen Szene entgegen, in der ich vom Glückskind den Kuss empfangend durfte.
Zur Uraufführung lud ich meinen Lehrer ein. Dem war es wohl ein wenig peinlich, an einem Sonntagnachmittag ins Volkshaus zu gehen, das er sicher nur von außen kannte und wo nur die Sozis hineingingen. Doch er kam. Und nach der Vorstellung durfte ich verlegen sein Lob entgegennehmen.
Und endlich kam der ersehnte, aufregende Tag. Mit dem Zug fuhr die Schar nach Zürich. Zweimal spielten wir, am Vormittag und am Nachmittag. Dazwischen gab es als Verpflegung ein feines Birchermus mit frischen Erdbeeren und Schlagrahm. Und wie die Kleinen lauschten wir in der Mittagspause zu Füssen der Märchentante und fuhren wir in den kleinen Autos auf der kurvenreichen Bahn den Hang hinunter, ehe wir selber wieder in Aktion traten.
Wenn Lotti mich küsste und wenn ich ihr den Kuss zurückgab, wusste ich, dass nicht sie, sondern ich das Glückskind – und sie der Pechvogel war.
Berichtigung: Nachdem das Buch 1992 zum ersten Mal erschienen war, bekam ich einen Brief von Lotti Fechenbach. Ehemalige Mitschülerinnen vom Talhof in St. Gallen hatten sie auf mein Buch aufmerksam gemacht. Sie sei zwar auch bei den Roten Falken gewesen, aber sie habe nie Theater gespielt. Es muss also doch das andere Flüchtlingskind gewesen sein, das mit seinen Eltern nach England auswanderte. Welches Schicksal jenes Mädchen in Deutschland erfahren hat, weiß ich nicht, aber sicher ändert es nichts an unseren vertauschten Rollen als Pechvogel und Glückskind.
Ich lernte Lotti Fechenbach in Zürich persönlich kennen. Sie wohnte kaum fünfzig Meter von dem Verlag entfernt, in dem ich arbeitete. Bei einer Ausstellung über Felix Fechenbach stellte sie mir auch ihren nach den USA ausgewanderten Bruder vor, der extra zur Eröffnung der Ausstellung gekommen war.
… die Bewegung [gemeint ist die NSDAP] ist antiparlamentarisch, und selbst ihre Beteiligung an einer parlamentarischen Institution kann nur den Sinn einer Tätigkeit zu deren Zerstörung besitzen…“
Adolf Hitler, „Mein Kampf“
Wenn ich so die intellektuellen Schichten bei uns ansehe – leider, man braucht sie ja, sonst könnte man sie eines Tages ja … ausrotten oder so was … dann wird mir fast Angst.
Adolf Hitler, Rede am 10. November 1938
... zahlreiche Götter … deutsche Politiker, ausländische Diplomaten, deutsche Industrielle, Generale und Dienststellen der Reichswehr, Verleger, Ärzte, vermögende Frauen und andere Angehörige des Besitzbürgertums und des Adels [haben] ihn ... schon seit Dezember 1920 …. wirkungsvoll unterstützt.“
Werner Maser, „Adolf Hitlers ‚Mein Kampf‘“
Diese maßgebenden Kreise in Deutschland wären an sich in der Lage gewesen, Hitler entweder von der Regierung fernzuhalten oder ihn nach seiner Machtübernahme abzusetzen. Er ... hatte es verstanden, ihnen die Überzeugung beizubringen, er allein sei zur Rettung Deutschlands berufen und alle seine Maßnahmen dienten nur diesem Ziel.
Max Domarus
Was für ein Glück für die Regierung, dass die Menschen nicht denken.
Adolf Hitler am 18. Januar 1942
Die Masse ist wie ein Tier, das Instinkten gehorcht … Nur die fanatisierte Masse wird lenkbar … In einer Massenveranstaltung ist das Denken ausgeschaltet … in der Kunst der Massenbeeinflussung [ist mir] keiner gewachsen; auch Goebbels nicht.“
Adolf Hitler, 1933, aus: Rauschning, „Gespräche mit Hitler“
Ich habe sie gegeben. Was weiter! Alle haben Streichhölzer gegeben. Fast alle! Sonst wäre nicht die ganze Stadt niedergebrannt … ganz abgesehen davon, dass ich in Treu und Glauben gehandelt habe! … Wir haben nicht gewusst, dass ihr die Teufel seid. Ehrenwort! Wenn wir gewusst hätten, dass ihr wirklich die Teufel seid …
Max Frisch: „Nachspiel zu Biedermann und die Brandstifter“