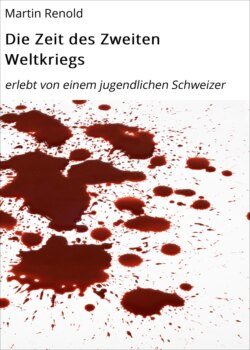Читать книгу Die Zeit des Zweiten Weltkriegs - Martin Renold - Страница 4
Das Geheimnis der vier Oktavhefte
Оглавление1989. Neujahr. Noch DDR. Keine neuen Bundesländer. Noch Mauer. Noch gestrichelte Grenze des Deutschen Reiches bei Bayern 3. Ostpreußen, Pommern. Flieg, Käfer, flieg. Der Vater ist im Krieg. Die Mutter ist in Pommernland, Pommernland ist ab… Pommern ist ab, weg. Alles jenseits von Oder und Neiße ist weg. Jenseits von Oder und Neiße. Erinnert an Jenseits von Gut und Böse. Kohl will immer noch nicht. Will bis zuletzt die Chance bewahren. Es könnte ja einmal ein Wunder geschehen.
Ich sitze immer noch auf der Bettkante. Unter dem Haufen vor mir auf dem Boden lugt die Ecke eines rötlichvioletten Büchleins hervor. Ich hebe die darüberliegenden Hefte und Bücher etwas in die Höhe und entdecke noch drei weitere Büchlein im gleichen Format. Natürlich erkenne ich sie sogleich wieder. Es sind drei schmale Büchlein, die ich selber gebunden habe, das erste, violette, in Kleisterpapier, das zweite und dritte in buntes, gespritztes Papier. Damals im Werkunterricht der Schule. In dem Raum, wo wir uns auch zu den Roten Falken versammelten. Nur das vierte Büchlein stammt eindeutig aus der Papierhandlung. Es ist in schwarzes Wachstuch gebunden. Eigentlich gehörten zu den vier Oktavheften noch zwei größere Quarthefte, die wie das vierte kleine schwarz gebunden waren. Doch ich kann sie nicht finden.
„Chronik I“ steht mit Bleistift geschrieben in großen Buchstaben auf der ersten Seite des violetten Büchleins. Und auf der Rückseite „1. Kriegsjahr“. Auf der dritten Seite steht zuoberst der Titel „September 1939“.
Nur die rechten Seiten sind beschrieben. Sie sind unterteilt in eine linke schmale Spalte, in der Daten notiert sind. Einige rot unterstrichen. In der rechten, breiten Spalte fein säuberlich in Schulschrift der Text. Ich lese die ersten Eintragungen. 1. Sept.: Die Deutschen marschieren in Danzig ein. Polen wird von der deutschen Armee überfallen. Hitler soll sich an die Ostfront begeben haben. 2. Sept.: Mobilmachung in der Schweiz. 3. Sept.: England und Frankreich erklären Deutschland den Krieg.
Die linken Seiten sind mit schwarzer und farbiger Tusche gezeichneten Landkarten vorbehalten: Polen mit der Demarkationslinie, Estland und Litauen, die Gegend um den Ladogasee, später Dänemark, Norwegen und Schweden, Holland, Belgien und Luxemburg. Niederländisch Indien, Belgisch Kongo. Italien. Im dritten Büchlein Frankreich mit der Grenze zwischen dem besetzten und dem unbesetzten Gebiet, die Straße von Gibraltar. Im vierten sind die linken und die rechten Seiten beschrieben. Keine Karten mehr. Die letzten Eintragungen sind vom 1. Dezember 1943: „Konferenz in Teheran zwischen Churchill, Stalin und Roosevelt“ und die allerletzte vom 2. Dezember 1943: „Die Deutschen werden zum Rückzug aus dem Sektor von Leningrad bezwungen.“
Ich weiß bestimmt, dass ich die Eintragungen bis zum bittersüßen Ende des Krieges fortgeführt habe. Vielleicht hab ich die beiden Quarthefte einmal versehentlich zusammen mit alten Schulheften weggeworfen.
In diesem Jahr wird es fünfzig Jahre her sein seit dem Beginn des Krieges. Und am gleichen Tag werden es fünfzig Jahre sein, seit ich heimlich in meinem Zimmer mit den Aufzeichnungen begann. Es sind keine Kommentare, keine persönlichen Stellungnahmen. Lauter lapidare Aufzeichnungen des Kriegsgeschehens. Nachrichten, wie ich sie aus dem Lautsprecher gehört oder in der Zeitung gelesen hatte. Mehr kann man ja wohl auch kaum von einem Zwölfjährigen erwarten. Für Historiker also vollkommen uninteressant. Für mich haben sie einen persönlichen Erinnerungswert.
Ich erinnere mich noch gut an jenen denkwürdigen 1. September 1939, als ich mit den Aufzeichnungen begann. Unser Lehrer, Herr Vogel, war kurz vor der Pause aus dem Schulzimmer gerufen worden. Die Klasse, in der rechten Bankreihe die zwanzig Knaben, in der linken ebenso viele Mädchen, saßen auf einmal ganz ruhig.
Es hatte sich herumgesprochen, dass Hitler losgeschlagen hatte. „Seit 4 Uhr 45 wird zurückgeschossen.“ Niemand zweifelte, dass zuerst die Deutschen angegriffen hatten.
Beinahe im selben Augenblick huben die Glocken von der evangelischen Heiligkreuzkirche auf der andern Seite des Steinachtales und die der katholischen Marienkirche im Neudorf zu läuten an. Ich weiß nicht, was die andern Jungen und Mädchen in diesem Augenblick empfanden. Mir traten Tränen aus den Augen. In meiner Kehle und in der Brust begann es zu würgen. Einen Moment lang nur. Dann klappte ich plötzlich den Deckel der Schulbank hoch und erhob mich. Aufrecht stand ich da in der hintersten Bankreihe und begann zu singen: „Rufst du mein Vaterland“. Die Nationalhymne. Doch ich kann nicht singen. Immer wenn ich es versuchte, tönte es falsch. Zu Hause jedoch hatte ich oft und gerne gesungen. Bis einmal eine der beiden schon ältlichen Töchter der Witwe Zuberbühler, die über uns im dritten Stock wohnten, sagte: „Ich freue mich immer, wenn ich an eurer Tür vorübergehe und dich so frisch von der Leber weg singen höre, auch wenn es ganz falsch tönt.“ Das war ein herber Schlag gewesen. In der Schule bewegte ich nur noch den Mund. Und daheim sang ich von da an nur noch in mich hinein.
Jetzt aber stand ich da und sang die ganze erste Strophe. Keiner stimmte mit ein. Aber es war unheimlich ruhig um mich her. Niemand wagte zu lachen. Man spürte die Betroffenheit der Schüler. Noch immer läuteten die Glocken. Nicht einmal der kleine Alfred Hohl, der mich so oft auf dem Schulweg plagte, mich an eine Hauswand oder einen Zaun drückte oder ins „Schwitzkästchen“ nahm, verzog den Mund. Er, der einmal durchgebrannt und drei Tage vermisst war, weil die Mitschüler ihn, den Kleinsten, gehänselt hatten, er, der es wagte, bei einem Hosenspanner dem Lehrer ins Schienbein zu treten – selbst er trug bei zu der Totenstille, die sich verbreitete, nachdem die Glocken endlich schwiegen und bis Herr Vogel wieder hereinkam und uns mit einer kurzen Erklärung nach Hause schickte.
Wir packten unsere Sachen zusammen. Keiner stürmte auf den Pausenhof hinaus wie sonst. Vor dem Schulhaus und auf der Straße bildeten sich Grüppchen. Es wurde diskutiert. Wie lange der Krieg dauern würde. Zwei, drei Monate? Vielleicht den ganzen Winter über. Man dürfe die Deutschen nicht unterschätzen. Aber wenn die Engländer und die Franzosen den Deutschen den Krieg erklärten, dann könnte es nicht so lange dauern. Dann müsste Hitler auf zwei Fronten kämpfen. Das wird er nicht lange überstehen. Dass er diesen Krieg verlieren würde, daran zweifelte keiner.
Hitler muss diesen Krieg verlieren, dachte ich. Wo bliebe da der liebe Gott, wenn dieser Teufel gewinnen würde? Wo bliebe die Gerechtigkeit? Das war schon damals mein fester Glaube und blieb es ununterbrochen, auch als die Deutschen Frankreich Belgien und Holland eroberten und den ganzen Balkan besetzt hatten, als sie in Russland bis zur Wolga und bis vor Moskau vorstießen und in Afrika bis El Alamein.
Langsam verzogen sich die Grüppchen. Der Schulhof leerte sich. Alfred Hohl und ich hatten den gleichen Heimweg. Wir gingen friedlich nebeneinander her.
Am nächsten Tag marschierte ein Bataillon Soldaten auf den Schulhof und hinüber auf den Rasenplatz. Dort stellten sie sich in Reih und Glied auf. Eine Feldmusik war dabei. Zum ersten Mal hörte ich den eintönigen Fahnenmarsch, der mir durch Mark und Bein ging. Die Soldaten erhoben die Hand zum Schwur. Fahneneid. Wieder kamen mir die Tränen. Wieder spürte ich ein Würgen im Hals.
Sollte ich mich schämen, dass ich bei feierlichen Anlässen die Tränen nicht zurückhalten konnte? Später blieben lange Jahre meine Augen trocken. Heute überwältigt es mich wieder, wenn Vreni Schneider oder Franz Heinzer auf dem Treppchen zuoberst stehen, die Schweizer Fahne hochgeht und die Landeshymne intoniert wird, wenn in Berlin die Menschen sich umarmen, in Prag Dubček neben Havel auf dem Balkon erscheint. Ich habe mich damals nicht geschämt und schäme mich auch heute nicht.
Ich habe an der Landesausstellung 1939 auf dem „Höhenweg der Eidgenossenschaft“ geweint, als ich vor dem Standbild des Wehrmannes stand, der, vor sich den Helm auf dem Boden, sich den Waffenrock überzog und dazu das „Rufst du mein Vaterland“ erklang. Noch war damals kein Krieg. Doch ich wusste, dass der Krieg kommen würde. Ja, ich hoffte, dass die Engländer und die Franzosen dem Treiben Hitlers und Mussolinis nicht mehr länger zusehen würden. Zorn hatte mich erfüllt, als Mussolinis Truppen in Abessinien einfielen. 1936. Ich glaube, das war meine früheste Erinnerung an ein Ereignis auf der großen Weltenbühne. Und dann an jenem Karfreitagmorgen, drei Jahre später, als Mussolini Albanien angriff und annektierte. Und erst das Münchner Abkommen! Dass Chamberlain so blind, so vertrauensselig war, konnte ich nicht verstehen. Ich erinnere mich auch an Vaters Verachtung für Bundesrat Motta, der in einer öffentlichen Rede Mussolini für seine Mitwirkung am Münchner Abkommen gelobt hatte. Mir war klar, dass sich Hitler nie mit dem Sudetenland begnügen, sondern bald auch die ganze Tschechei besetzen würde. Genau so, wie er Österreich seinem Reich angeschlossen hatte.
Der Name Dollfuss ist Teil meiner Erinnerung, obschon die damaligen Vorgänge nicht in mein Bewusstsein gedrungen waren. Wenn von der Ermordung von Dollfuss die Rede war, dachte ich immer an den Teufel mit dem Pferdefuß. Auch Schuschnigg war ein so lächerlicher Name. Ich wusste nicht, was ich von ihm halten sollte.
Eines Tages, als ich von der Schule kam, erzählte mir die Mutter in grenzenloser Empörung, was sie am Radio gehört hatte. Die Deutschen seien in Wien einmarschiert, und die Weiber – sie sagte tatsächlich Weiber – hätten geschrien: „Der Adi kommt, der Adi kommt!“ Nicht etwa aus Angst. Nein, gejubelt hätten sie. Man stelle sich so etwas vor. Bei uns in der Schweiz könnte so was nie passieren. Zwar gebe es auch bei uns – Gott sei’s geklagt – einige Nazis, Fröntler. Aber die wären bald ausgeschaltet. Alle, Frauen und Männer, würden sich wehren. So feig und schlapp wie die Österreicher würden wir uns nicht ergeben. Eine Gefahr sei Hitler schon. Auch für uns. Die gleiche Sprache. Heim ins Reich. Großdeutsches Reich. Der Gotthard. Zum Glück sei Mussolini nicht daran interessiert, dass Hitler bis zur italienischen Grenze vorstoße. Auch wenn er selber gerne das italienischsprachige Tessin zu Italien schlagen würde.
Man munkelte von den guten Beziehungen Mottas zu Mussolini. Dass aber unser Schicksal von solchen Männern abhängen solle, das wollte weder Vater noch Mutter in den Kopf. Auch mir, dem damals Elfjährigen, nicht.
Und jetzt war es, wie vorauszusehen, zum Krieg gekommen. Angst und Zuversicht mischten sich seltsam in meinem Herzen. Darf man sich einen Krieg herbeiwünschen, um einen Wahnsinnigen zu bremsen? Einen Hitler oder Saddam Hussein? Noch konnte ich mir keine Vorstellung von so einem Krieg machen. Wer konnte es denn überhaupt? Die Alten vielleicht? Noch gab es welche, die den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 erlebt hatten. Ab und zu hörte man im Radio, wieder sei ein Veteran des Siebziger Krieges gestorben. Oder jene, die den Weltkrieg miterlebt hatten? Manchmal erzählte Vater von der Grenzbesetzung 1914/18, wie sie im Bündnerland am Umbrail Wache gestanden hatten, und Mutter erinnerte sich, dass sie im Aargau den Kanonendonner aus dem Elsass gehört hatten.
Aber jetzt war der Krieg noch weit weg. In Polen. Die Deutschen drangen rasch vor. In meiner Chronik vom 4. bis 16. September: „Die Polen verteidigen sich wie Löwen. Große Kämpfe bei Lodz. Lemberg und besonders bei Modlin und Warschau.“ Doch am 17. September heißt es: „Die Russen marschieren in Polen ein. Für England und Frankreich ist es keine Überraschung, weil man es schon lange geahnt hat.“ Und am 23. September trug ich in mein Oktavheft ein: „Vom 1. bis 23. September sind etwa 400 bis 600 deutsche Flugzeuge abgeschossen worden.“ Wie viele besaßen sie wohl noch? Offenbar waren diese Zahlen nicht bekannt. Auf den letzten Seiten meines Büchleins hatte ich verschiedene Angaben über die Bestände aus der Zeitung notiert: „5,6 Millionen waffenfähige Männer in England. 10 Millionen in Frankreich, 14 Millionen in Deutschland, 45 Divisionen in England, 154 Divisionen in Frankreich und 102 in Deutschland. 59 Schlachtkreuzer in England, 17 in Frankreich und nur 6 in Deutschland. 161 Torpedozerstörer besaß England, Frankreich deren 61, Deutschland nur 22. Tanks standen England 1500 zur Verfügung, Frankreich 2000 und Deutschland 3500. Schwere Kanonen besaß Deutschland 14‘000, also 3000 mehr als England und Frankreich zusammen, und bei den Maschinengewehren sah das Verhältnis ähnlich aus. Bei den Flugzeugen fehlten Zahlen. Optimistisch hatte ich geschrieben: „Dazu ist zu bemerken, dass Deutschland im Krieg gegen Polen viele Geschütze verloren hat! Deutschland kann während Kriegszeiten keine verlorenen Geschütze ersetzen, geschweige denn neue herstellen. Die Westmächte aber können das!!“
Diese Eintragung entlockt mir ein Lächeln. Vermutlich habe ich diese „Weisheit“ damals auch aus der Zeitung abgeschrieben. Aber die beiden Ausrufezeichen stammten doch wohl von mir und zeigen, dass ich mir diese Auffassung zu Eigen gemacht hatte.
Große Aufmerksamkeit schenkte ich in jenem Winter 1939/40 dem russisch-finnischen Krieg. Immer wieder notierte ich, wie viele Tanks und Geschütze die Finnen zerstörten, wie viele Last- und Panzerwagen und Pferde, am 8. Januar allein deren 1200, sie erbeutet hatten.
Am 23. Januar vermeldete ich den Tod von Bundesrat Motta.
Am 10. Mai 1940 gibt es gleich am Anfang des zweiten Büchleins eine längere Eintragung. Dieser Tag ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Nicht nur wegen des Eindringens deutscher Truppen in Holland, Belgien und Luxembourg, schon gar nicht wegen des deutschen Flugzeugs, das – wie ich jetzt lese – über dem Schweizer Jura zwischen Delémont und Moutier 17 Bomben auf die Bahnlinie abgeworfen hat, auch nicht, weil ich an jenem Mittag, als ich von der Schule in der Stadt nach Hause kam – ich besuchte inzwischen das kantonale Gymnasium –, erfuhr, dass meine Schwester schon am frühen Morgen von der Schule zurückgekehrt war, weil viele Lehrer in Erwartung eines deutschen Angriffs auf die Schweiz ihre Familien in Sicherheit gebracht hatten. Am Gymnasium war der Schulbetrieb noch normal verlaufen. Nein, was diesen Tag für mich unvergesslich gemacht hat, war ein ganz persönlich erlebter Vorfall, der sich in meiner Chronik wie folgt liest: „Am Abend des heutigen Tages überflog ein deutsches Flugzeug die Ostschweiz. Es wurde vermutlich von der Westfront vertrieben. In Dübendorf stellten ihm schweizerische Jagdflieger nach. Sie eröffneten das Maschinengewehrfeuer. In geringer Höhe überflog es Herisau und St. Gallen, wo ihm ein Motor eingeschossen wurde (?). Bis an die Grenze wurde es verfolgt. Dort machte es Anschein zu landen, flog über die Grenze und stürzte ab (?).“
Hätte ich diesen Vorfall nicht in der nüchternen Sprache des Chronisten, sondern in der des herzklopfenden Zeugen zu schildern, so müsste ich ihn ungefähr so beschreiben: Am frühen Abend dieses denkwürdigen Tages spielte ich zwischen den Häusern an der Scheidwegstraße und der Rorschacherstraße mit Bruno Lachauer und Gildo Centina. Der eine war ein Sechstklässler, der andere ging in die Fünfte. Sie waren damals meine besten Freunde, sofern sie sich nicht zwischenhinein aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen für eine paar Tage oder Wochen als meine Feinde erklärten und mir mit Knebeln nachstellten, die ich jedoch jedes Mal heldenhaft abwehrte, obwohl ich unzweifelhaft ein Schwächling war. Aber wie auch gegen Alfred Hohl verlieh mir in solchen Fällen offenbar ein Adrenalinstoß ungeahnte Kräfte, die es zumindest Bruno und Gildo ratsam erscheinen ließen, wieder Frieden zu Schließen und die Freundschaft neu zu bekräftigen. Meiner überlegenen Schulweisheit wegen gestanden sie mir sogar eine gewisse Vormachtstellung zu. Wie wir uns also an jenem Spätnachmittag mit unseren Füßen um einen Ball stritten, vernahmen wir plötzlich ein lautes Motorenheulen. Wir hatten kaum Zeit, gegen die Straße zu laufen, da schoss schon ein zweimotoriges Flugzeug mit eindeutig deutschen Kennzeichen über die Häuser und unsere Köpfe hinweg, so niedrig, dass es beinahe die Kamine streifte, verfolgt, links und rechts, von zwei schweizerischen Jagdflugzeugen. Von vorn auf der Straße konnten wir gerade noch sehen, wie die Flugzeuge am Turm der Neudorfkirche vorbei verschwanden, und wir hörten, wie die schweizerischen Flieger am Ende der Stadt das Maschinengewehrfeuer wieder aufnahmen. Nur wenige Sekunden hatte der Spuk gedauert.
Der Abstand der Häuser war gerade etwa so groß, dass wir den grauen Bomber, der wie ein Schatten den Himmel über uns verdunkelt hatte, für einen Sekundenbuchteil in seiner Gänze sehen konnten. Sein Rumpf fülle den ganzen Zwischenraum aus, und die Flügel hatten uns wie ein Nachtmahr erschreckt. Bruno behauptete steif und fest, er habe den Körper eines deutschen Piloten aus dem Flugzeug heraushängen sehen. Wie ein Sack Kartoffeln. Und Gildo glaubte beobachtet zu haben, wie das angeschossene Flugzeug gleich nach Verlassen des Luftraumes über der Stadt hinter der Neudorfkirche abgestürzt sei. Ich hatte weder das eine noch das andere gesehen. Aber eines waren wir uns alle drei sicher: Das Flugzeug hatte kaum über die Grenze entkommen können. Vielleicht war es schon über Frankreich angeschossen worden und hatte deshalb den vermutlich sicheren Weg über die Schweiz für den Rückflug gewählt. Doch weit gefehlt. Unsere Piloten zeigten sich als Meister. In unseren Augen waren sie Helden.
Fliegeralarm hatte es nicht gegeben. Oder nahm man ihn damals schon nicht mehr oder noch nicht ernst?
Natürlich waren bei allen Häusern die Fenster aufgegangen, und die Nachbarn streckten die Köpfe heraus. Doch hatte keiner etwas gesehen. Der Lärm hatte sie aufgeschreckt. Wir waren stolz, die einzigen Augenzeugen in der näheren Umgebung zu sein, und erzählten aufgeregt, was wir gesehen hatten. Wobei Bruno mehrere Male das Wort Kartoffelsack in den Mund nahm.
Nachdem wir die Neugier an den Fenstern und unser angeschwollenes Selbstgefühl genug befriedigt hatten, verlangte es uns, dem Drängen nachzugeben, um die Bestätigung für den vermutlichen Abschuss zu suchen. Wir riefen unseren Müttern an den Fenstern zu, was wir vorhatten.
Zurückhalten konnten sie uns nicht. Die Mahnungen verhallten ins Leere.
Dann rannten wir drei davon. Bei der Neudorfkirche ging uns der Schnauf aus. Aber noch immer legten wir ein forsches Marschtempo ein. An der Oberen Waid vorbei. Da war der Flieger sicher noch nicht abgestürzt. Auch Gildo musste seine Ansicht revidieren. Aber bei der Unteren Waid. Doch da war weit und breit nichts zu sehen. Auf der Höhe von Mörschwil auch noch nicht. Als wir die ersten Häuser von Goldach erreichten und der Bodensee schon ganz nahe war, dämmerte bereits der Abend.
Irgendwo an einem Haus lagerte eine Frau ihren schweren Busen auf dem Fenstersims. Haben Sie das Flugzeug gesehen? Ja. Ist es abgestürzt? Eine Weile sah es so aus, als ob es im Altenrhein landen wollte, aber es flog noch einmal hoch. Aber im Bregenzer Wald ist es sicher abgestürzt. Man hat einen Knall gehört.
Enttäuscht kehrten wir um. Allzu gerne hätten wir, wenn nicht die Trümmer gesehen, so doch die Gewissheit nach Hause genommen, dass die deutsche Luftwaffe um ein weiteres Flugzeug, abgeschossen von unseren Jägern, geschwächt worden war.
Später kam es noch oft vor, dass deutsche Flugzeuge im Luftkampf über der Schweiz abgeschossen wurden. Sehr zum Ärger Hitlers. Schließlich gab man dem Druck nach. Man versprach, nicht mehr auf deutsche Flugzeuge zu schießen. Was machte es schon aus. Jetzt kamen ja auch keine mehr. Der Krieg in Frankreich war vorbei. Die deutschen Flugzeuge kamen weit weg von der Schweiz zum Einsatz: über England, in Russland, auf dem Balkan, in Afrika. Hitlers unberechenbarer Zorn war besänftigt.
Die alliierten Bomber, die später kamen, wurden nur vom Boden aus beschossen, oder besser gesagt: bedroht.
Albert war der Freund meiner Schwester. Er kannte alle deutschen, englischen und amerikanischen Flugzeugtypen. Er wusste auch, wo sich die geheimen Militärflugplätze der Schweiz befanden, die ich dann auf der Landeskarte an der Wand in meinem Schlafzimmer einzeichnete. Als er es sah, schrie er mich an. „Du Arsch. Das ist doch streng geheim. Hast du dir überlegt, was passiert, wenn die Deutschen kommen?“
„Selber Arsch. Glaubst du, die Karte würde nicht sofort im Ofen verbrannt? Das ist nur, damit ich’s mir selber besser einprägen kann. Ich bin doch kein Landesverräter.“
Da Albert, der bereits Militärdienst leistete, auch sonst über alles Bescheid wusste, glaubte ich selbstverständlich auch die Geschichte, die er mir eines Tages erzählte: Kürzlich seien alliierte Flugzeuge über die Schweiz geflogen, wie dies ja später fast täglich geschah. Die Schweizer hätten hinaufgefunkt: „Ihr fliegt über die Schweiz. Wir müssen auf euch schießen.“ Von oben hätten sie zurückgefunkt: „We know it.“ Die Flak habe das Feuer eröffnet, und die Piloten hätten wieder gefunkt: „Ihr müsst höher schießen.“ Darauf die Schweizer wieder. „We know it.“
Tatsache ist, dass kaum je ein alliiertes Flugzeug heruntergeholt wurde. Während von den deutschen ungefähr jedes zweite abgeschossen worden war, stieg die Abschussrate bei den Alliierten kaum über ein bis zwei Prozent. Und dann war es wohl meist aus Versehen und mit höchstem Bedauern. Natürlich nicht von offizieller Seite. Bei einem Fall handelte es sich sogar um ein führerloses Flugzeug, das über unser Gebiet flog, nachdem die Besatzung schon über Feindgebiet abgesprungen war.
All dies ereignete sich allerdings erst im dritten oder vierten Kriegsjahr. Einmal in jenen Jahren war Sophie, eine Cousine aus dem Aargau bei uns in den Ferien. Es war ein schöner, wolkenloser, fernsichtiger Tag, als ich mit ihr nach Guggeien spazierte, wo man einen großen Teil des Bodensees überblicken kann, und weit in „Feindesland“ hinein. Auf dem Rückweg strolchten wir noch lange im Guggeienwald herum. Ich war verliebt in das zwei Jahre jüngere Mädchen. Doch ich balgte mich oft mit Sophie. Wie anders hätte ich sonst ihren heranreifenden, sich rundenden und lusterregenden Körper berühren dürfen? Was ich als zärtliche Wollust empfand, hielt Sophie für Zudringlichkeit und Streitsucht. Doch je mehr sie sich wehrte, umso heftiger packte ich sie an ihren Armen, zwang sie zu Boden, bis sie in Tränen ausbrach und schließlich abzureisen begehrte. Doch draußen im Freien fühlte sie sich sicher. Und selbst im Wald, wo uns niemand begegnete, hätte ich nicht gewagt, sie festzuhalten, wenn sie vor mir davonsprang und ich sie einzuholen versuchte.
Ich hatte eben eine blauschwarz gestreifte Feder eines Eichelhähers vom Boden aufgelesen, damit Sophies Wangen berührt und sie ihr dann zum Geschenk überlassen, als von der nahen Stadt her die aufheulenden Sirenen ertönten. Fliegeralarm. Doch dies ängstigte uns nicht. Hier im Wald waren wir sicher. Aber plötzlich hörten wir dumpfes Motorengebrumm, das immer näher kam. Ich zog meine Cousine zum Waldrand, wo sich die Wiese sanft zum weiten Talgrund hinunterneigt. Und da sahen wir ganz niedrig über der Talmulde eine Fliegende Festung kreisen. Langsam drehte sie sich, flog auf den Waldrand zu. Wendete. Beinahe über unseren Köpfen. Und dann kam eine zweite, eine dritte und noch eine und noch eine. Alle kamen über den Bodensee herübergeflogen. Schließlich waren es acht oder neun große Bomber. Ein riesiges Karussell, das sich langsam bis zum Kirchturm der Marienkirche im Neudorf drehte. Ich sprang auf die Wiese hinaus, machte mich bemerkbar. Die Piloten mussten mich doch sehen, wenn sie so niedrig flogen. Ich winkte, gestikulierte, zeigte mit beiden Armen nach Westen, Richtung Dübendorf, wo alle angeschossenen amerikanischen Bomber, wenn sie von ihren Luftangriffen auf München oder Friedrichshafen zurückkamen, landen konnten.
Schließlich kamen zwei schweizerische Jagdflugzeuge, kreisten über den fliegenden Festungen, und wie folgsame Kinder auf dem Schulausflug hinter ihrem Lehrer zogen die mächtigen Kolosse in Reih und Glied hinter den beiden Jägern dem sicheren Ziel entgegen.
Endalarm. Noch ehe wir zu Hause anlangten und von unserem Abenteuer berichten konnten.
Anfänglich hatten wir den Alarm nicht so leicht genommen. Schon vor dem Krieg waren Sirenen installiert worden, und bei einigen Probealarmen musste die Bevölkerung sofort den nächsten Keller oder Hausflur aufsuchen.
Eines Nachts aber wurde es ernst. Das Heulen der Sirene riss mich aus dem Schlaf. Ich stürzte aus dem Bett, in die Stube. Vater, Mutter und Ruth kamen aus ihren Schlafzimmern. Wir traten ans Fenster. Vater horchte hinaus in die Nacht. Nachdem der unheimliche, auf- und abschwellende Heulton verklungen war, schien die Stille noch lautloser zu sein als in anderen Nächten. Nur das Herzklopfen. Die Dunkelheit war eine schwarze Unendlichkeit voller Furcht und Grauen. Ich zitterte am ganzen Leib. Kommen die Deutschen? Haben auch wir jetzt Krieg? Vater beschwichtigte. Nein, nein, ihr braucht keine Angst zu haben. Die Deutschen kommen nicht mitten in der Nacht. Am Morgen in der Frühe. Doch nicht um diese Zeit. Aber sicher war er wohl auch nicht. Vermutlich ist ein Flugzeug eingeflogen.
O diese unheimliche Stille, diese Dunkelheit. Kein Licht. Die Nacht stockfinster. Diese Angst. Todesangst. Würde nun doch alles kommen? Bomben? Zerstörung? Besetzung? Gestapo, Schrecken und Tod? – Und dann auf einmal die Erlösung. Das gleichmäßige Heulen der Sirenen. Das Ausklingen und vom Hagenbuchwald herab das Echo – oder war es eine entfernte Sirene? Und dann war wieder alles wie zuvor. Und doch nicht. Der Schlaf war anders. Die Unsicherheit blieb. Die Angst, ob nicht doch am Morgen die deutschen Panzer über die Rheinbrücken und durch die Straßen rasselten.
Vater schaltete frühmorgens den Lautsprecher ein. Zum Glück war nichts geschehen.
Auch in der Schule nahm man den Alarm ernst. Die ersten paar Male mussten wir ein dunkles Kellergewölbe aufsuchen. Einen Luftschutzkeller gab es nicht. Dicht gedrängt saßen wir in dem niedrigen Tonnengewölbe auf dem Boden, wann immer es sich traf am liebsten natürlich neben einer heimlich geliebten Schulkollegin.
Als sich die Alarme häuften, manchmal zwei-, dreimal am Tag, wurde auf dem Dach des Schulhauses eine hölzerne Zinne errichtet. Abwechslungsweise wurden vier Schüler aufgeboten, um mit dem Feldstecher in alle vier Himmelsrichtungen zu spähen. Beim Sichten eines Flugzeuges wurde ein internes Klingelzeichen ausgelöst. Erst dann wurden die Schulzimmer geräumt.
Auch ich musste einmal aufs Dach steigen. Doch außer Tauben, Schwalben und Spatzen flog uns nichts vor die Ferngläser.
Mit der Zeit fühlte man sich sicherer. Eines Tages, während der letzten Vormittagsstunde, ertönte zehn Minuten nach dem Fliegeralarm das Klingelzeichen. „Los, in den Keller!“, befahl unser Geografielehrer. Doch es war ein so schöner Sommertag. Zusammen mit einigen Kollegen flüchtete auch ich durchs Fenster im Hochparterre. Während die andern schon davonrannten, half ich Vania, die auf den Sims gestiegen war, aber noch zögerte. Ich streckte ihr die Arme entgegen und fing sie auf. Vania, ein Auslandschweizermädchen, war mitten im Schuljahr aus Paris gekommen. Ich hatte mich in sie verliebt. Aber sie hatte sich einen Anderen zum Freund gewählt. Zusammen bummelten wir durch die Stadt. Bis die Entwarnung kam. Unter der Tür stand Hungerbühler, unser Pedell. Das bedeutete Arrest. Ich konnte gerade noch Vania am Ärmel fassen und sie hinter die nächste Hausecke ziehen.
Doch so harmlos wie an diesem Tag war es nicht immer. Bomben fielen auf Schaffhausen, auf Stein am Rhein, das alte historische Städtchen. Viele Häuser wurden zerstört. Dutzende Menschen kamen ums Leben. In der Nähe von Zürich und Basel fielen Bomben auf Bahngleise und Güterbahnhöfe. Nicht weit von den Bombeneinschlägen bei Zürich befand sich die Waffenfabrik Bühle. Die Schweiz war gewarnt.
Bei nächtlichen Fliegeralarmen gingen wir nicht in den Keller. Wir hatten uns schon zu sehr daran gewöhnt. Die Engländer, die nachts kamen, wollten doch nur der deutschen Fliegerabwehr ausweichen.
Aber dann kam jene Schreckensnacht, als Friedrichshafen bombardiert wurde.
Nach dem Alarm war ich wieder eingeschlafen. Ein Brummen von schweren Flugzeugen weckte mich wieder. Das mussten Dutzende sein. Aus der Stube vernahm ich die Stimmen der Eltern. Dann ein Zittern wie bei einem Erdbeben. Ich schwang mich aus dem Bett, eilte zur Tür, wollte sie öffnen. Aber es war, als risse mir ein unsichtbarer Geist die Klinke aus der Hand. Der Luftdruck. Der Sog. „Mach das Licht aus!“, rief mir Vater zu. Auch Ruth kam über den dunklen Korridor herbeigeeilt. Vater hob das schwarze Rouleau aus Wachstuch, das wegen der befohlenen Verdunkelung hinter dem Fenster angebracht war. Von draußen drang unerwartetes Licht in die Stube. Vater zog das Rouleau ganz hoch, und alle vier schauten wir in die Nascht hinaus, die keine Nacht mehr war. Große leuchtende Kugeln hingen über dem Hagenbuchwald, über der Eggersrieter Höhe. Es war, als fiele der Sternenhimmel ganz langsam auf die Erde nieder. Alles war taghell erleuchtet.
Und wieder ein Zittern in der Luft und im Gemäuer.
„Rasch in den Keller!“, befahl der Vater. Wir schlüpften schnell in unsere Kleider, zogen Hemd und Hosen über die Pyjamas und eilten über die Treppe in den Keller hinunter. Es war kein ausgebauter Luftschutzkeller. Er war nur halb unter dem Boden und diente zum Lagern von Obst und Kartoffeln und im Winter für die Briketts, mit denen der einzige Kachelofen in unserer Wohnung geheizt wurde.
Von draußen drang das unheimliche Dröhnen der Flugzeuge herein.
Irgendwo fielen schwere Bomben. Es hörte sich an wie nicht allzu fernes Donnerrollen. Die Erschütterung löste Angst aus. Von der Unterseite der Kellertreppe fiel Staub herab. Von den Wänden hörte man das Abbröckeln von Mörtel.
Alle Bewohner des Hauses waren versammelt: die Witwe Zuberbühler mit ihren beiden ältlichen Töchtern; wir; Frau Wagenbach, der das Haus gehörte, mit ihrem Gatten: Herr und Frau Rommel mit ihren Söhnen Max und Eugen. Wir schauten uns mit fragenden Augen an. Auf den Gesichtern standen Angst und Schrecken.
Vater war der Erste, der den Mut fand, die Treppe hinaufzusteigen und auf die Straße zu treten, als wir spürten, dass uns keine unmittelbare Gefahr drohte. Als er zurückkam, war er bleich im Gesicht.
„Das ist die Hölle“, sagte er. „Der Himmel über dem Bodensee ist glühend rot, wie bei einer Feuersbrunst.“
Zusammen mit meinem Vater stieg nun auch ich die Treppe hoch. Ruth, Herr Wagenbach, Max und Eugen schlossen sich uns an. Wir traten vors Haus. Gegenüber stand nur die Strumpffabrik. Links an ihr vorbei sah man zur Eggersrieter Höhe. Noch immer brannten Leuchtkugeln. So viele auch verloschen, so viele entzündeten neu und sanken langsam, wie wir vermuteten, an kleinen Fallschirmen nieder. Von den Flugzeugen war nichts zu sehen. Aber man hörte sie. Schon bald eine Stunde lang drang das Brummen, bald stärker, bald etwas schwächer, aber ununterbrochen herab. Welle um Welle bewegte sich von West nach Ost. Und etwas ferner vernahm man nun auch eine Wellenbewegung von Ost nach West. Hunderte mussten das sein.
Die Strumpffabrik gehört zu meiner Jugend wie das Haus, in dem ich aufwuchs. Am Morgen früh, wenn ich erwachte, hörte ich die Maschinen. Und abends bis zehn Uhr. Besonders im Sommer, wenn hüben und drüben die Fenster offen standen. Immer dieses gleichmäßige, rhythmische metallische Zischen und Anschlagen der Wirkmaschinen. Oft stand ich am Fenster meines Schlafzimmers und sah die Männer und Frauen an den langen Maschinen hin und her laufen. Ihre Handgriffe waren mir vertraut, wenn sie die fertigen Strümpfe aus den Maschinen rissen, neue Spulen einsetzten, die Maschinen wieder anließen. Nur sonntags standen sie still. Dann war es, als fehlte irgendetwas.
Gleich unserem Haus gegenüber war eine Treppe mit etwa zwanzig Stufen, die zu einer weiß gestrichenen Tür führte, die aber immer verschlossen war. Die Treppe diente nur noch uns Kindern zum Spielen. Die Verwegensten sprangen im Winter, wenn der Schnee einen halben Meter hoch oder noch höher lag, was damals noch oft vorkam, von zuoberst auf das noch nicht geräumte Trottoir.
Jetzt in dieser Nacht stieg ich mit den anderen die Treppe hoch bis vor die Tür. Von dort sah man nicht den Bodensee selber, aber das Allgäu und den Horizont dahinter. Und der war jetzt blutrot. Ein riesiges Feuermeer musste sich darunter ausbreiten. Die Erde bebte, und von drüben, von Friedrichshafen, wo sich die Flugzeugwerke befanden, drang das dumpfe Donnern. Und noch immer kamen Flugzeuge von Westen. Viele gerieten in das Scheinwerferlicht. In raschen Bewegungen leuchteten die Strahlen den Himmel ab, standen manchmal für eine Sekunde still, um gleich darauf wieder den ganzen Himmel abzusuchen.
Plötzlich ein lautes Donnern, fast eher ein Knall wie bei einer nahen Explosion. Aber nicht von drüben. Das war näher, im Südwesten. Fielen Bomben auf die Stadt? Wir zogen uns in den Keller zurück. Am nächsten Morgen erfuhren wir, dass ein Flugzeug mitsamt seiner Bombenlast im Toggenburg abgestürzt und explodiert war.
Endlich ließ das Dröhnen von draußen nach. Aber noch lange nachdem ich wieder im Bett lag, hörte ich die Wellen der Bomberstaffeln auf ihrem Heimflug.
Eine solche Nacht erlebte ich zum Glück nicht mehr. Doch manchmal sah ich von meinem Schlafzimmerfenster aus, wenn ich mich ein wenig hinauslehnte, einen Feuerschein am Himmel, wenn die Engländer München bombardierten.
Und einmal kamen an einem wolkenlosen, durchsichtigen Tag Hunderte von Flugzeugen vom Rheintal her über das deutsche Bodenseeufer geflogen. Und wieder luden sie über Friedrichshafen ihre todbringende Last ab. Im Licht der Sonne leuchteten die metallenen Leiber auf. Dazwischen blitzten immer wieder die explodierenden Schrapnells der deutschen Flak, für kurze Zeit schwarze Wölkchen am Himmel zurücklassend. Und wohl zwanzig Mal sah ich, wie eines dieser in der Sonne blitzenden Flugzeuge plötzlich in weitem Bogen mit einem schwarzen rauchenden Schweif zur Erde niederfiel.