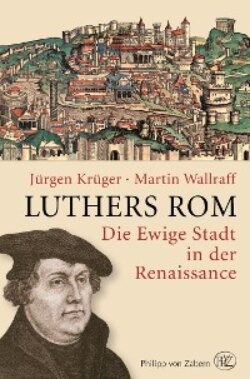Читать книгу Luthers Rom - Martin Wallraff - Страница 9
Bolsena und die hl. Christina
ОглавлениеDas ist schon in Bolsena der Fall – dem Ort am See, an dem sich die mittelalterliche Frankenstraße mit der römischen Via Cassia vereinigt, um mit ihr gemeinsam nach Rom zu laufen. Wir treffen wiederum auf ein Pilgerheiligtum, noch größer und noch bedeutender als in Acquapendente, aber vor allem auf einen Ort mit antik-römischen, ja sogar etruskischen Wurzeln. An diesem altehrwürdigen Ort schrieb ein mittelalterlicher Pilger Theologiegeschichte. Genauer: Es ging dabei um die richtige Lehre vom Abendmahl. Debatten darüber hatte es bereits seit karolingischer Zeit gegeben. Schließlich hatte man beim vierten Laterankonzil 1215 eine „handfeste“, sehr „reale“ Lehre kanonisch festgeschrieben, die Lehre von der realen Präsenz von Fleisch und Blut im Mahl. Man hatte das in den Kategorien aristotelischer Philosophie ausgedrückt: Es finde eine Transsubstantiation statt, eine regelrechte Verwandlung der Substanz zu Fleisch und Blut (bei Wahrung der Akzidentien, also der äußeren Erscheinung von Brot und Wein). Diese Festlegung war theologisch klar, doch zugleich (damals wie heute) reichlich abstrakt. Zweifel und Unklarheiten blieben – bei den Gläubigen wie bei den Priestern.
So ging es offenbar auch einem böhmischen Geistlichen, der im Jahr 1263 hier des Weges kam und im Pilgerheiligtum die Messe feierte. Ein drastisches Wunder räumte seine Zweifel aus: Bei der Brechung des Brotes soll Blut zum Vorschein gekommen sein, ja, Ströme von Blut sollen die Tischwäsche auf dem Altar, dann die Messgewänder benetzt haben und schließlich sogar vom Altar auf den Fußboden geflossen sein. Das Ereignis wurde sogleich dem im nahen Orvieto weilenden Papst Urban IV. berichtet, und dieser nahm es zum Anlass, um ein liturgisches Fest zur Erinnerung daran einzurichten,10 in Wahrheit aber wohl: um der abstrakten Abendmahlslehre Farbe und Anschaulichkeit zu geben. Fronleichnam (Corpus Domini) wurde zuerst 1264 gefeiert und wird bis heute in Bolsena besonders feierlich begangen. Es gibt wenige Feste im christlichen Kirchenjahr, deren Entstehung so klar datierbar ist und vor allem: die so deutlich zur Veranschaulichung abstrakter Theologie dienen. In diesem Sinne ist es ein „didaktisches“ Fest, und mit diesem Gedanken wurde die Geschichte vom eucharistischen Wunder erzählt; ihm verdankt sie wohl auch ihre Entstehung. Das Konzept war überaus erfolgreich: Das Fest und die Geschichte erfreuten sich bald großer Verbreitung. Wie in einem Brennglas konzentrieren sich hier Abendmahlstheologie und -frömmigkeit des westlichen Mittelalters. Raffael hat – gerade zur Reformationszeit – die Szene schließlich in einem der Räume der päpstlichen Privatgemächer im Vatikan gemalt und damit vollends „kanonisiert“.
Vatikan, Stanzen des Raffael, Messe von Bolsena. Der Messfeier wohnt – anachronistisch – der Papst zur Zeit Luthers (Julius II., 1503–13) bei, um die Aktualität des Ereignisses zu betonen.
Hier wüsste man nun doch gerne, was der junge Augustinermönch Martin Luther gesagt oder gedacht hat, als er in Bolsena vorbeikam. Man wird ihm den Altar gezeigt und die zugehörige Legende erzählt haben. Später hat er die Transsubstantiationslehre abgelehnt und das Fronleichnamsfest mit seinen Prozessionen als „überaus schändlich“ verurteilt:11 jene wegen der philosophischen Grundlagen, dieses wegen der Verehrung der Hostie außerhalb der Mahlfeier. Doch gerade die Konkretheit von Fleisch und Blut blieben ihm wichtig; er hat sie gegenüber den Schweizer Reformatoren emphatisch betont.
Der Altar, an dem das Wunder stattgefunden hat, ist bis heute in der Kirche zu sehen, und bis heute werden die verblichenen Spuren des ausgeströmten Blutes dort gezeigt (heute an einem separaten Altar). Eindrucksvoller als diese bescheidenen Farbreste ist indessen der Baldachin über dem Altar: ein herrliches Stück karolingischer Kirchenkunst, Zeugnis für die über Jahrhunderte nie unterbrochene Tradition des Gottesdienstes und der Verehrung an diesem Ort. Christen kamen hierher, um zu beten – auch in den sogenannten „dunklen“ Zeiten des frühen Mittelalters, über die wir sonst so wenig wissen, weil sich kaum etwas erhalten hat. Es gibt nicht viele Orte, an denen das so kontinuierlich der Fall war und an denen wir es bis heute spüren und sehen können, weil alle Generationen ihre Spuren, die Zeugnisse ihrer Frömmigkeit hinterlassen haben.
Bolsena, S. Cristina. Der linke Teil der Fassade steht vor der Kapelle mit dem Altar des eucharistischen Wunders.
Den Kern bildet das Grab der hl. Christina, dazu eine frühchristliche Grabanlage, eine Katakombe mit über 1000 Gräbern, wie wir sie sonst nur an wenigen Plätzen außerhalb Roms finden. Die Anfänge dieser Anlage verlieren sich im Dunkel der Geschichte: Weder können wir sagen, wer Christina war, noch wissen wir über die Umstände ihres Lebens und Sterbens zuverlässig Bescheid. Das ist vielleicht auch nicht so wichtig, denn ihr Grab war zunächst gar kein besonderes. Es lag in einem Nebengang des Friedhofs der örtlichen christlichen Gemeinde, und diese Gemeinde ist als solche besonders genug, denn sie muss sehr alt sein. Schon in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts, also womöglich noch unter Kaiser Konstantin hat sie eine Halle am Hauptplatz der damaligen Stadt (die Basilika am Forum) für die Zwecke des christlichen Gottesdienstes umfunktioniert.12
Das ist sehr ungewöhnlich, denn das Christentum verbreitete sich zuerst in den großen Städten. Außerhalb Roms und seiner direkten Umgebung sind Zeugnisse der neuen Religion vor der Anerkennung durch Konstantin selten. Auf dem Lande blieb die Bevölkerung lange heidnisch, so auch in Latium, und wo das Christentum Fuß fasste, geschah es zunächst in bescheidener Form, kaum einmal so prominent und zentral wie in Bolsena, dem antiken Volsinii.
Eine sehr alte Gemeinde also – im 3. Jahrhundert hat sie sicher schon bestanden – und ein uralter christlicher Friedhof. Eine Besonderheit ist die Formel pax tibi cum sanctis, die sich auf den Grabinschriften in dieser Katakombe häufig findet: „Friede sei dir mit den Heiligen.“ So typisch und so besonders ist die Formel, dass die Gelehrten selbst bei der einzigen römischen Inschrift mit dieser Wendung vermuten, die bestattete Frau stamme aus Bolsena.13 Die Formel entstammt eigentlich der Alltagssprache. Man kann sich vorstellen, wie sich die Menschen mit „Friede sei mit dir und deiner Familie“ oder „mit deinen Freunden“ begrüßten. Und im Tod rief man ihnen nun nach: Friede dir mit den Heiligen, gemeint: mit der Gemeinde der Christen, die schon dort sind, im Jenseits an einem Ort erfrischenden Grüns, wie eine andere Inschrift aus Bolsena sagt. Die „Heiligen“ sind hier noch nicht als „besonders heilig“ kanonisierte Personen, sondern schlicht die christliche Gemeinde, wie auch Paulus schon das Wort gebraucht – einfach als Synonym für „Christen“ (1 Kor 1,2).
Es braucht also nicht die hl. Christina, um diese Gemeinde zu heiligen, und vielleicht war sie auch gar nicht viel heiliger als alle anderen. Möglicherweise war sie einfach eine sehr angesehene Person, und der Rest der Legende kam später dramatisierend hinzu. Die spätere Überlieferung will, dass sie die Tochter des Präfekten Urbanus war und als Märtyrerin unter Diokletian (284–305) starb. Doch bevor es dazu kam, hat sie Dramatisches erlebt: Man band sie an einen schweren Stein und wollte sie im Bolsenasee versenken. Doch der Stein schwamm oben und trug sie sicher ans Ufer zurück. Auch hier suchte und fand man im Mittelalter eine sinnlich-naive Veranschaulichung der Geschichte: Der Stein mit den Fußabdrücken der jungen Frau wird noch heute gezeigt, vielleicht ist es ein Pflasterstein von der Via Cassia: Bei so einem schweren Basaltstein wird die Geschichte von der wundersamen Errettung noch wunderbarer.
Montefiascone, die doppelstöckige Kirche S. Flaviano, an der alten Via Cassia/Francigena gelegen
Ohnehin die Straße: Ohne sie wäre Christina sicher nicht das geworden, was sie ist, nämlich eine der populärsten Heiligen der westlichen Christenheit. Auf der Via Cassia wurde ihr Ruhm (und ihr Kult) in alle Welt getragen – bis heute erkennbar an der weiten Verbreitung des Vornamens Christina.