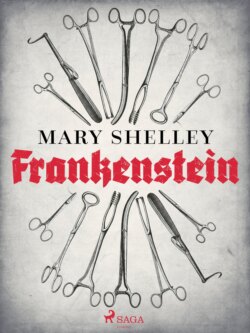Читать книгу Frankenstein - Mary Shelley - Страница 6
1. KAPITEL
ОглавлениеIch bin ein gebürtiger Genfer; meine Familie gehört zu den angesehensten dieser Republik. Meine Vorfahren waren seit vielen Jahren dort Anwälte und Syndici; mein Väter bekleidete verschiedene öffentliche Ämter in Ehren. Er wurde von allen wegen seiner Untadeligkeit und seinem unermüdlichen Eifer für das allgemeine Wohl geachtet. In seinen jüngeren Jahren beschäftigte er sich ständig mit der Politik seines Landes; das und eine Reihe anderer Angelegenheiten hinderten ihn an einer frühen Heirat. Allerdings wurde er auch nicht erst gegen Ende seines Lebens Gatte und Familienvater.
Da die Umstände seiner Heirat Licht auf seinen Charakter werfen, muß ich sie erzählen. Einer seiner besten Freunde, ein Kaufmann in günstigen Verhältnissen, geriet infolge zahlreicher Unglücksfälle in Armut. Beaufort – so hieß der Mann – war stolz und unnachgiebig und konnte es daher nicht ertragen, arm und vergessen im selben Land zu leben, in dem er früher wegen seines reichen Standes angesehen war. Also beglich er auf die ehrenhafteste Weise seine Schulden und zog sich dann mit seiner Tochter nach Luzern zurück, wo er unerkannt und elend lebte. Mein Vater schätzte Beaufort als echten Freund; er war sehr bekümmert über seine Flucht ins Elend. Bitter beklagte er den falschen Stolz, der seinen Freund zu einer jede Zuneigung verachtenden Haltung zwang. Er verlor keine Zeit, ihn ausfindig zu machen, da er ihn zu überreden hoffte, mit Hilfe seines Kredits und seiner Unterstützung von vorne zu beginnen.
Beaufort hatte alles getan, um seine Verborgenheit aufrechtzuerhalten; es dauerte zehn Monate, ehe mein Vater seinen Unterschlupf ausfindig gemacht hatte. Glückstrahlend über diese Entdeckung eilte er auf das Haus zu, das in einer trübseligen Straße nahe der Reuß lag. Als er eintrat, hieß ihn die Verzweiflung willkommen. Beaufort hatte kaum etwas Geld aus dem Wrack seines Vermögens retten können; es genügte als Lebensunterhalt für ein paar Monate. Danach hoffte er eine anständige Arbeit im Hause eines Kaufmanns zu finden. In der Zwischenzeit verstärkte die Untätigkeit, welche Muße zum Grübeln hat, seinen nagenden Kummer; schließlich wurde sein Geist derart davon erfaßt, daß er binnen drei Monaten auf dem Krankenbett lag und zu jeder Anstrengung unfähig war.
Seine Tochter pflegte ihn mit größter Zärtlichkeit, aber sie mußte verzweifelt zusehen, wie ihre geringen Mittel eilig schrumpften, ohne daß Aussicht auf Unterstützung bestand. Caroline Beaufort besaß jedoch einen außergewöhnlichen Charakter. Sie besorgte sich einfache Arbeit: Sie flocht Stroh. Auf diese Weise verdiente sie so viel, daß es gerade für den Lebensunterhalt reichte.
Mehrere Monate vergingen. Ihr Vater verfiel zusehends, und seine Pflege beanspruchte fast ihre ganze Zeit. Die Mittel für den Unterhalt schwanden; im zehnten Monat verschied ihr Vater in ihren Armen und ließ sie als Waise und Bettlerin zurück. Dieser letzte Schicksalsstreich überstieg ihre Kräfte. Sie kniete an Beauforts Sarg und weinte bitterlich, als mein Vater ins Zimmer trat. Er erschien dem armen Mädchen wie ein schützender Geist, und sie vertraute sich seiner Fürsorge an. Nach dem Begräbnis seines Freundes brachte er sie nach Genf und gab sie in die Obhut einer Verwandten. Zwei Jahre später wurde Caroline seine Frau.
Zwischen meinen Eltern bestand ein beträchtlicher Altersunterschied, aber dieser Umstand verband sie nur um so inniger miteinander. Die aufrechte Gesinnung meines Vaters war vom Streben nach Gerechtigkeit beherrscht. Deshalb war es für ihn notwendig, daß er in hohem Maße Achtung aufbringen mußte, um lieben zu können. Vielleicht hatte er vormals an der erst spät entdeckten Unwürdigkeit einer geliebten Frau gelitten und war so dazu gelangt, größeres Gewicht auf erprobten Wert zu legen. In der Neigung zu meiner Mutter zeigte sich eine Dankbarkeit und Verehrung, die gänzlich von der kindischen Verliebtheit des Alters unterschieden war, denn sie beruhte auf der Achtung vor ihren Tugenden und auf dem Wunsch, sie weitestgehend für ihre früheren Sorgen zu entschädigen. Das verlieh seinem Verhalten ihr gegenüber einen Reiz, den ich nicht beschreiben kann. Alles wurde getan, um ihren Wünschen und ihrer Bequemlichkeit nachzukommen. Er bemühte sich, sie vor jedem rauhen Wind zu schützen – wie es ein Gärtner für eine schöne exotische Pflanze tut – und sie mit allem zu umgeben, was ihrem sanften und gütigen Gemüt Freude, bereiten konnte. Ihre Gesundheit und selbst die Ruhe ihres an sich stetigen Geistes waren durch die erlittene Unbill erschüttert worden. Während der zwei Jahre vor ihrer Heirat hatte mein Vater nach und nach seine öffentlichen Ämter aufgegeben. Nach der Hochzeit suchten sie sogleich das angenehme Klima Italiens auf; der Wechsel der Landschaft und der Interessen auf einer Reise durch jenes Wunderland war als stärkende Arznei für die geschwächte Konstitution meiner Mutter gedacht.
Von Italien aus besuchten sie Deutschland und Frankreich. Ich wurde als ihr ältestes Kind in Neapel geboren und begleitete sie als Säugling auf ihrer Wanderschaft. Für mehrere Jahre blieb ich ihr einziges Kind. Wie sehr sie auch aneinander hingen, so schenkten sie mir doch nicht minder wahre Schätze an Liebe aus einer unerschöpflichen Fundgrube. Die zärtlichen Liebkosungen meiner Mutter und das Lächeln freundlichen Wohlwollens auf dem Gesicht meines Vaters sind meine ersten Erinnerungen. Ich war ihr Spielzeug, ihr Abgott, mit einem: ihr Kind, das unschuldige und hilflose Geschöpf, das ihnen der Himmel bescherte, damit sie es zum Guten erziehen konnten; sein zukünftiges Los – sei es Glück oder Unheil – lag in ihren Händen. Das Bewußtsein ihrer Schuldigkeiten gegenüber dem Wesen, dem sie Leben gegeben hatten, war mir, zusammen mit beider regem Gefühl für Zärtlichkeit, in jeder Stunde meiner Kindheit ein Beispiel der Geduld, der Nächstenliebe und der Selbstzucht. Ich wurde an einem seidenen Band von einer Freude zur nächsten geführt.
Lange Zeit galt nur mir ihre Sorge. Meine Mutter hatte sich zwar von Herzen eine Tochter gewünscht, aber ich blieb zunächst ihr einziger Sprößling. Als ich fünf Jahre alt war, brachten meine Eltern auf einem Ausflug über die Grenzen Italiens eine Woche am Ufer des Corner Sees zu. Ihr gütiges Wesen lenkte ihre Schritte oft in die Hütten der Armen. Für meine Mutter war das mehr als nur eine Pflicht, nämlich eine innere Notwendigkeit. Sie hatte nicht vergessen, wie ihr Leid gelindert worden war, und wollte nun der Schutzengel der Bedrängten sein. Auf einem Spaziergang erregte eine dürftige Hütte in einem Seitental ihre Aufmerksamkeit. Sie wirkte besonders trostlos, und eine Schar halbbekleideter Kinder, die herumsprang, zeugte von Armut schlimmsten Ausmaßes. Eines Tages – mein Vater war nach Mailand gefahren – besuchte meine Mutter in meiner Begleitung diese Hütte. Sie traf einen Bauern und sein Weib, beide von Sorge und Arbeit gebeugt, die gerade ein kärgliches Mahl an fünf hungrige Kinder austeilten. Eines befand sich darunter, das meiner Mutter besonders gefiel. Es schien einem anderen Geschlecht zu entstammen, denn vier waren dunkeläugige, kräftige, kleine Vagabunden, während diesem Mädchen eine zarte Schönheit eigen war. Ihr Haar strahlte wie lebendiges Gold; trotz ihrer ärmlichen Kleidung schwebte eine Krone der Auszeichnung über ihrem Köpfchen. Die klare und hohe Stirne, die Augen von schattenlosem Blau, die Lippen und überhaupt die Gesichtsform drückten ein solches Empfindungsvermögen, eine solche Anmut aus, daß sie jeder als etwas Besonderes erkennen mußte, als ein vom Himmel gesandtes Wesen, das in allem engelsgleiche Züge aufwies.
Die Bäuerin merkte, daß meine Mutter mit Erstaunen und Bewunderung auf dieses liebenswerte Mädchen blickte, und erzählte darum eifrig dessen Geschichte. Es war tatsächlich nicht ihr Kind, sondern die Tochter eines mailändischen Edelmannes. Die Mutter, eine Deutsche, war bei ihrer Geburt gestorben. Das Kind wurde diesen guten Leuten in Pflege gegeben, die dadurch ihre Lage verbesserten. Sie waren jung verheiratet, und ihr ältestes Kind war gerade geboren worden. Der Vater ihres Pflegekindes, ein Italiener, der in der Erinnerung an den antiken Ruhm Italiens aufgewachsen war, gehörte zu den »schiavi ognor frementi«, die sich um die Freiheit ihres Landes bemühten. Er wurde das Opfer seiner Neigung. Ob er gestorben war oder noch in den Gefängnissen Österreichs schmachtete, wußte niemand. Sein Eigentum wurde konfisziert, sein Kind blieb verwaist und bettelarm den Zieheltern überlassen. Es erblühte in ihrem dürftigen Heim schöner als eine Gartenrose unter dunkelblättrigen Brombeersträuchern.
Als mein Vater aus Mailand zurückkehrte, fand er in der Halle unseres Hauses ein Kind beim Spiel mit mir vor; es war schöner als ein gemalter Cherub, sein Blick schlug jeden in Bann; seine Gestalt, seine Bewegungen waren zierlicher als die der Gemsen auf den Bergen. Die Erscheinung war bald geklärt. Mit meines Vaters Erlaubnis bat meine Mutter das Bauernpaar um ihr Mündel. Die bisherigen Pflegeeltern mochten zwar das Waisenkind gern, da dessen Gegenwart ihnen als Segen galt, aber sie hielten es für ungerecht, es weiterhin an ein entbehrungsreiches Dasein zu fesseln, wenn die Vorsehung eine so günstige Wendung bot. Sie fragten ihren Dorfpfarrer; das Ergebnis war, daß Elisabeth Lavenza eine Mitbewohnerin des elterlichen Hauses wurde, meine Schwester und mehr als das: die schöne und bewunderte Gefährtin meiner Beschäftigungen und Freuden.
Jeder liebte Elisabeth. Die innige und fast ehrfürchtige Zuneigung, die ihr alle widmeten und die ich teilte, wurde mein größter Stolz. Am Abend vor ihrer Ankunft in unserm Hause sagte meine Mutter neckend zu mir: »Ich habe ein hübsches Geschenk für meinen Viktor; morgen soll er es bekommen.« Als sie mir am nächsten Tag Elisabeth als das versprochene Geschenk vorstellte, faßte ich in kindlichem Ernst ihre Worte buchstäblich auf und betrachtete Elisabeth so, als ob sie mir gehörte. Ich wollte sie beschützen, lieben und hegen. Alles Lob, das man auf sie häufte, nahm ich entgegen, als gelte es einem meiner persönlichen Schätze. Wenn wir auch als Anrede die Namen Vetter und Kusine gebrauchten, so konnte doch kein Wort, kein Ausdruck die Art der Beziehung, in der sie zu mir stand, verkörpern. Sie war mir stets mehr als Schwester und gehörte mir allein bis zum Tode.