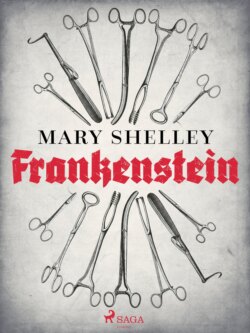Читать книгу Frankenstein - Mary Shelley - Страница 8
3. KAPITEL
ОглавлениеIch war siebzehn Jahre alt, da entschlossen sich meine Eltern, mich zum Studium auf die Universität Ingolstadt zu schicken. Mein Vater hielt es zur Vervollkommnung meiner Erziehung für nötig, daß ich auch mit anderen Sitten als nur mit denen meiner Heimat vertraut würde. Meine Abreise wurde schon für einen nahen Zeitpunkt festgelegt; aber ehe der vereinbarte Tag herankam, ereignete sich das erste Unglück meines Lebens, gleichsam ein Omen meines zukünftigen Elends.
Elisabeth war am Scharlachfieber erkrankt; sie schwebte in der größten Gefahr. Während ihrer Krankheit überredeten wir meine Mutter, sie nicht selbst zu pflegen. Zuerst hatte sie unseren Bitten nachgegeben; kaum hörte sie jedoch, das Leben ihres Lieblings sei bedroht, als sie ihre Angst, welche sie nicht länger zu beherrschen vermochte, zum Krankenbett trieb. Ihre wachsame Sorge besiegte die Tücken des Fiebers; Elisabeth genas. Um so teurer bezahlte ihre Retterin die Folgen der eigenen Unklugheit. Am dritten Tage erkrankte meine Mutter; sogleich zeigten sich alarmierende Symptome, und die Blicke ihrer medizinischen Betreuer prophezeiten den schlimmsten Ausgang. Noch auf dem Totenbett verlor diese würdigste Frau ihre Tapferkeit und Güte nicht. Sie legte Elisabeths Hände in die meinen. »Meine Kinder«, sagte sie, »meine stärksten Hoffnungen auf künftiges Glück barg die Aussicht auf eure Verbindung. Sie wird nun der Trost eures Vaters sein. Meine liebe Elisabeth, tritt du an meine Stelle in der Familie. Wie schmerzt es mich, daß ich euch verlassen muß! Wer so wie ich geliebt wird, dem fällt das Scheiden schwer. Doch diese Gedanken geziemen mir nicht. Ich will mich fröhlich dem Tod hingeben und der Hoffnung, euch in einer anderen Welt wiederzusehen.«
Sie starb ruhig; ihr Gesicht drückte noch im Tod Liebe aus. Es erübrigt sich, die Gefühle jener zu beschreiben, deren teuerste Bande durch diesen unersetzlichen Verlust zerrissen werden; die Öde breitet sich in den Seelen aus, und die Verzweiflung prägt die Gesichter. Lange währt es, ehe das Gemüt einsieht, daß sie (die wir täglich sahen und deren Dasein ein Teil unseres Selbst zu sein schien) für immer von uns gegangen ist, daß der Glanz geliebter Augen erlosch, der Klang einer vertrauten, dem Ohr so lieben Stimme verstummte, um nie mehr vernehmbar zu sein. Das sind die Empfindungen der ersten Tage; wenn der Lauf der Zeit die Wirklichkeit des Unglücks bestätigt, beginnt die wahre Bitterkeit des Leids. Doch wer hat noch nicht diese rauhe Hand verspürt? Warum soll ich einen Kummer beschreiben, den alle empfinden müssen? Allmählich kommt die Zeit, da der Schmerz eher wohltuend als quälend ist. Das Lächeln, das sich auf die Lippen drängt, wird nicht mehr für eine Entweihung der Trauer gehalten. Meine Mutter war tot, aber wir mußten weiterhin unsere Pflichten erfüllen und unseren Weg mit den uns Verbliebenen fortsetzen; wir mußten uns glücklich schätzen, daß der Schnitter nicht alle erfaßt hatte.
Meine Abreise nach Ingolstadt, die durch diese Ereignisse verschoben worden war, wurde von neuem geplant. Mein Vater räumte mir eine Frist von einigen Wochen ein. Es schien mir eine Entweihung zu sein, wenn ich so bald die dem Tod verwandte Ruhe des trauernden Hauses verließ und ins Dickicht des Lebens eilte. War der Kummer mir auch neu, so beunruhigte er mich darum nicht weniger. Ich wollte ungern den Anblick der mir Gebliebenen missen; vor allem wünschte ich meine holde Elisabeth getröstet zu sehen.
Sie verheimlichte übrigens ihren Schmerz und bemühte sich, die Trösterin für uns alle zu sein. Zuversichtlich blickte sie ins Leben, erfüllte ihre Aufgaben mit entschlossenem Eifer und widmete sich ihrem Oheim und ihren Vettern. Sie wirkte bezaubernder denn je und ließ uns den erlittenen Verlust fast vergessen.
Schließlich nahte der Tag meiner Abreise. Clerval verbrachte den letzten Abend bei uns. Er hatte seinen Vater um die Erlaubnis gebeten, mich begleiten und mein Studienkollege werden zu dürfen, aber ohne Erfolg. Sein Vater war nämlich ein engstirniger Händler, der in den Wünschen und Ambitionen seines Sohnes nur Faulheit und Verderbnis sah. Henry war zutiefst unglücklich, weil er von einer freizügigen Bildung ausgeschlossen werden sollte. Er sagte wenig; aber aus seinen entzündeten Augen und seinem lebhaften Blick sprach der unterdrückte, aber feste Entschluß, nicht an die Kümmerlichkeiten des Händlerdaseins gekettet zu bleiben.
Wir saßen lange beisammen, da wir nicht die Kraft zu einem Lebewohl fanden. Endlich schlug die Trennungsstunde. Wir zogen uns zur Nachtruhe zurück, wenn auch jeder diesen dürftigen Vorwand durchschaute. Als ich im Morgengrauen zur Kutsche ging, waren alle da: mein Vater, um mich nochmals zu segnen; Clerval, um meine Hand zu drücken; meine Elisabeth, die mich bat, ihr oft zu schreiben, und ihrem Spielkameraden und Jugendfreund die letzten weiblichen Gefälligkeiten erwies.
Ich warf mich in die Kutsche und überließ mich schwermütigem Sinnieren. Stets hatten mich liebenswerte Gefährten umgeben, die sich gegenseitig Freude bereiteten; nun war ich allein. Auf der Universität, wohin ich eben fuhr, würde nur ich selbst mir Freund und Beschützer sein. Mein Leben hatte sich bisher in einem bemerkenswert abgeschlossenen und häuslichen Rahmen abgespielt. Meine unbesiegbare Abneigung gegen neue Gesichter rührte davon her. Ich liebte meine Brüder, Elisabeth und Clerval, denn das waren »alte, vertraute Gesichter«. Für den Umgang mit Fremden hielt ich mich nicht begabt.
So sann ich, als meine Fahrt begann. Im weiteren Verlauf besserte sich meine Stimmung, und meine Hoffnungen wuchsen. Ein leidenschaftliches Verlangen nach Wissen brannte in mir. Es war mir zu Hause oft schwergefallen, während meiner Jugend an einen Platz gebunden zu sein; ich hatte mich danach gesehnt, in die Welt zu wandern und unter anderen Menschen zu weilen. Nun erfüllten sich meine Wünsche, und ich wäre töricht gewesen, darüber Bedauern zu empfinden.
Auf meiner Reise nach Ingolstadt verfügte ich über genug Muße für diese und viele andere Überlegungen; sie dauerte nämlich sehr lang. Endlich erblickte ich den hohen weißen Turm der Stadt. Nachdem ich ausgestiegen war, wurde ich sogleich zu meiner Behausung geleitet, wo ich den Abend nach meinen eigenen Absichten zubringen konnte.
Am nächsten Morgen gab ich meine Empfehlungsschreiben ab und besuchte einige der führenden Professoren. Der Zufall (oder eher eine ungünstige Fügung, ein zerstörerischer Zug, der seit dem Augenblick, da meine widerstrebenden Schritte sich aus dem väterlichen Hause entfernten, einen allmächtigen Einfluß auf mich gewann) führte mich zuerst zu Herrn Krempe, Professor der Naturphilosophie. Er war ein linkischer, aber mit den Geheimnissen seiner Wissenschaft vertrauter Mann. Er stellte mir mehrere Fragen, die meinen Stand in den Wissenszweigen der Naturphilosophie betrafen. Ich antwortete nachlässig und erwähnte auch, eigentlich aus Verachtung, meine Alchimisten als mir bekannte Gewährsleute.
Der Professor zeigte sich erstaunt. »Haben Sie«, sagte er, »tatsächlich Ihre Zeit damit verbrächt, solchen Unsinn zu studieren?« Ich bejahte. »Jede Minute«, fuhr Professor Krempe freundlich fort, »jeder Augenblick, den Sie an diese Bücher verschwendeten, ist völlig verloren. Sie haben Ihr Gedächtnis mit veralteten Systemen und nutzlosen Namen belastet. Großer Gott! In welch verlassenem Lande haben Sie denn gelebt? Hat kein Mensch Sie freundlicherweise darauf hingewiesen, daß diese von Ihnen gierig aufgesogenen Phantastereien an die tausend Jahre alt und unwiderruflich vermodert sind? Ich hätte nie erwartet, in diesem aufgeklärten und wissenschaftlichen Zeitalter einen Schüler von Albertus Magnus und Paracelsus zu finden. Mein lieber Herr, Sie müssen Ihre Studien neu beginnen.«
Während seiner Rede trat er beiseite und schrieb eine Liste über verschiedene Bücher, die naturwissenschaftliche Themen behandelten und die ich mir beschaffen sollte, zusammen. Er verabschiedete mich, nachdem er erwähnt hatte, daß er zu Anfang der nächsten Woche eine Vorlesungsreihe über allgemeine Naturphilosophie beginne und daß Herr Waldmann, ein Kollege, an den Tagen, an denen er nicht lese, Chemie lehren werde.
Ich erwähnte bereits, daß ich seit längerem jene Autoren, die der Professor verworfen hatte, als nutzlos betrachtete. Ich war also nicht enttäuscht und darum auch nicht geneigt, die alten Studien wieder aufzunehmen. Professor Krempe nahm mich zwar keineswegs im voraus für seine Ziele ein, denn er war ein kleiner gedrungener Mann mit barscher Stimme und abweisendem Gesicht. Ich habe auf fast allzu philosophische Manier die Ergebnisse meiner Jugendentwicklung dargestellt. Im Knabenalter war ich mit den von der modernen Naturwissenschaft eröffneten Aussichten nicht zufrieden gewesen. Meine konfusen Ideen, die man meiner Jugend und der Ermangelung eines geeigneten Lehrers zuschreiben muß, hatten mich die Stufen des Wissens zeitlich rückwärts geleitet. Die Entdeckungen der jüngsten Forscher hatte ich für die Träume vergessener Alchimisten eingetauscht. Außerdem verachtete ich die praktische Seite der modernen Naturwissenschaft. Wenn die Meister der Wissenschaft Unsterblichkeit und Macht suchten, schien mir dies trotz ihrer Wirkungslosigkeit großartig zu sein. Aber nun hatte sich das Bild verändert. Der Ehrgeiz des Forschers beschränkte sich darauf, jene Visionen, auf die sich mein Interesse hauptsächlich gründete, zu vernichten. Ich war gezwungen, Einbildungen von grenzenloser Bedeutsamkeit für Tatsachen von geringem Wert hinzugeben.
Derart waren meine Überlegungen an den ersten zwei oder drei Tagen meines Aufenthalts in Ingolstadt beschaffen. Ich lernte inzwischen die wichtigsten Örtlichkeiten meiner neuen Heimat kennen. Als die folgende Woche begann, erinnerte ich mich an die Auskunft Professor Krempes über die Vorlesungen. Zwar konnte ich mich nicht aufraffen, die Vorlesung dieses kleinen, eingebildeten Burschen zu besuchen, um ihn vom Katheder herab dozieren zu hören, aber statt dessen fiel mir das über Professor Waldmann Gesagte ein. Ich kannte ihn noch nicht, da er bisher nicht in der Stadt weilte.
Teils aus Neugierde, teils aus Müßigkeit ging ich in den Hörsaal, den Professor Waldmann kurz danach betrat. Er beeindruckte mich ganz anders als sein Kollege. Ungefähr fünfzig Jahre alt, mit grauen Schläfen und schwarzem Haupthaar, von kleiner, aber aufrechter Gestalt und mit einer angenehmen Stimme begabt, wirkte er wie die Güte selbst. Er begann seine Vorlesung mit einer Wiederholung der Geschichte der Chemie und ihrer vielfachen Fortschritte; er sprach dabei die Namen der vorzüglichsten Forscher mit Begeisterung aus. Dann gab er einen kursorischen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft und erklärte viele elementare Begriffe. Nachdem er noch einige vorbereitende Experimente gemacht hatte, schloß er mit einer Lobrede auf die moderne Chemie, die ich nie vergessen werde.
»Die alten Lehrer in dieser Wissenschaft«, sagte er, »versprachen Unmögliches und leisteten nichts. Die modernen Meister versprechen sehr wenig, denn sie wissen, daß Metalle nicht umgewandelt werden können und daß das Lebenselixier ein Hirngespinst ist. Aber diese Denker, deren Hände nur im Schmutz herumzuwühlen und deren Augen einzig über dem Mikroskop oder dem Schmelztiegel nachzugrübeln scheinen, haben echte Wunder vollbracht. Sie dringen in die Schlupfwinkel der Natur ein und beobachten ihr Werk an den verborgensten Plätzen. Sie erforschen die Himmel genauso wie den Kreislauf des Blutes und die Zusammensetzung der Luft. Neu und unbegrenzt sind ihre Leistungen: Sie können dem Donner des Himmels befehlen, das Erdbeben nachahmen und sogar die unsichtbare Welt mit ihren eigenen Schatten äffen.«
So klangen die Worte des Professors – oder lassen Sie mich besser sagen, die Worte des Schicksals, die mich vernichten sollten. Während er sprach, war es mir, als ob meine Seele mit einem greifbaren Feind ringe. Nach und nach wurden die Elemente, aus denen mein Wesen aufgebaut war, angerührt. Saite um Saite ertönte, und bald erfüllte mich nur mehr ein Gedanke, eine Vorstellung, ein Ziel. So viel ist geleistet worden, rief die Seele Frankensteins aus, noch mehr, viel mehr will ich erreichen, indem ich in die vorgegebenen Fußstapfen trete. Ich will einen neuen Weg bahnen, unbekannte Kräfte erforschen und der Welt die tiefsten Geheimnisse der Schöpfung offenbaren.
Ich schloß in dieser Nacht kein Auge. Mein Inneres befand sich in einem wilden Aufruhr. Zwar fühlte ich, daß daraus Ordnung entstehen könnte, aber ich besaß keine Kraft, sie zu verwirklichen. Erst allmählich, als schon die Morgendämmerung hereinbrach, kam der Schlaf. Nach dem Erwachen schien alles nur ein wirrer Traum gewesen zu sein. Es blieb einzig der Entschluß, meine alten Studien wieder aufzunehmen und mich einer Wissenschaft zu widmen, für die ich eine natürliche Begabung zu haben glaubte. Am selben Tage besuchte ich Professor Waldmann. Sein Benehmen in der privaten Sphäre war noch gewinnender als in der Öffentlichkeit. Während seiner Vorlesung hatte eine gewisse Würde seine Miene beherrscht, die in seinem eigenen Haus einer großen Leutseligkeit und Freundlichkeit Platz machte. Ich berichtete ihm genau dasselbe über meine früheren Ziele wie seinem Kollegen. Er hörte aufmerksam dem kurzen Bericht über meine Studien zu und lächelte bei den Namen von Cornelius Agrippa und Paracelsus, jedoch ohne die Verächtlichkeit, die Professor Krempe gezeigt hatte. Er meinte dann: »Das sind Männer, deren unermüdlichem Eifer die modernen Denker größtenteils die Grundlagen ihres Wissens verdanken. Sie waren in hohem Grade die Instrumente bei der Entdeckung von Fakten, die wir benennen und klassifizieren, was oftmals eine leichtere Aufgabe ist. Die Anstrengungen genialer Männer, auch wenn sie in die falsche Richtung zielen, werden letztlich fast immer zu einem dauerhaften Gewinn für die Menschheit.«
Auf diese Bemerkung hin, die ohne jede Anmaßung oder Heftigkeit war, erwähnte ich, daß seine Vorlesung meine Vorurteile gegen die moderne Chemie beseitigt habe. Ich drückte dies in maßvollen Redewendungen aus und befleißigte mich der Bescheidenheit und Ehrerbietung, die sich für einen jungen Menschen gegenüber seinem Lehrmeister gebührt. Allerdings ließ ich mir auch nicht die geringste Begeisterung über meine beabsichtigten Arbeiten anmerken, denn das Eingeständnis meiner mangelnden Lebenserfahrung hätte mich beschämt. Ich bat ihn um seinen Rat wegen der Bücher, die ich mir besorgen sollte.
»Ich freue mich«, entgegnete Professor Waldmann, »wieder einen Schüler gewonnen zu haben. Wenn Ihr Fleiß Ihren Fähigkeiten entspricht, zweifle ich nicht an Ihrem Erfolg. Die Chemie ist derjenige Zweig der Naturwissenschaft, der die größten Fortschritte aufweist und noch größere verspricht. Aus diesem Grunde habe ich sie für mein spezielles Studium gewählt, gleichzeitig aber die anderen Zweige der Wissenschaft nicht vernachlässigt. Wer nur diese Sparte des menschlichen Wissens pflegte, würde ein armseliger Chemiker sein. Wenn Sie wirklich ein echter Wissenschaftler werden wollen und nicht nur ein unbedeutender Experimentator, dann müssen Sie sich mit allen Zweigen der Naturwissenschaft, einschließlich der Mathematik, beschäftigen. Das ist mein Rat.«
Darauf führte er mich in sein Laboratorium und erklärte mir die Handhabung der verschiedenen Apparaturen. Er schlug mir auch einige Anschaffungen vor und versprach mir zuletzt, daß ich seine eigenen Instrumente benützen dürfe, sobald mein weitergediehenes Wissen ihren Mechanismus nicht mehr schädigen würde. Nachdem er mir die Liste der erbetenen Bücher überreicht hatte, verabschiedete ich mich.
So endete ein für mich denkwürdiger Tag; er bestimmte mein zukünftiges Schicksal.