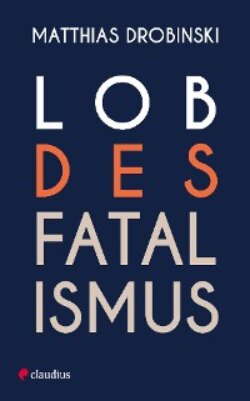Читать книгу Lob des Fatalismus - Matthias Drobinski - Страница 5
Machen sie sich denn gar keine Sorgen?
Eine Hommage an Rudolf Iwanowitsch Abel, den kleinen Sowjetspion
ОглавлениеRudolf Iwanowitsch Abel kam 1903 in Großbritannien auf die Welt und starb 1971 in Moskau, dazwischen war er Spion für die Sowjetunion in England und wäre fast ermordet worden in Stalins Säuberungsaktionen. Er ging, wieder als Agent, 1948 in die USA und spionierte dort das amerikanische Atomwaffen-Programm aus. 1957 wurde er enttarnt und kam ins Gefängnis; 1962 tauschte ihn die Sowjetunion gegen zwei abgestürzte Piloten des Spionageflugzeugs U2 aus – auf der Glienicker Brücke zwischen Berlin-West und dem damals ostdeutschen Potsdam. Der Regisseur Steven Spielberg hat den Stoff in seinem Film „Bridge of Spies“ verarbeitet, der vom Irrsinn des Kalten Krieges erzählt und vom tapferen Anwalt James B. Donovan, der ans Rechtssystem und die Werte der Vereinigten Staaten glaubt. Er bewahrt den gefangenen Spion vor der Hinrichtung und macht dann den Austausch mit den gefangenen US-Agenten möglich; nebenbei rettet er noch einen unbedarften amerikanischen Studenten, der in die Fänge der DDR-Staatssicherheit geraten ist.
Für einen Versuch über den Fatalismus aber ist nicht der tatkräftige Anwalt von Bedeutung, Steven Spielbergs Held also, sondern Rudolf Abel, der Spion; im Film spielt ihn der britisch-amerikanische Schauspieler Mark Rylance großartig lakonisch. Dieser Rudolf Abel fällt von einer aussichtslosen Lage in die nächste. Die Amerikaner enttarnen und verhaften ihn; Staatsanwaltschaft, Gericht und Politik wünschen einen kurzen, spektakulären Schauprozess, an dessen Ende der Tod Abels auf dem elektrischen Stuhl stehen soll. Gegen alle Wahrscheinlichkeit kann der Anwalt dieses Ende verhindern. Ein paar Jahre später soll dann der Russe gegen die in Moskau gefangen gehaltenen US-Piloten ausgetauscht werden. Ob das sein Glück ist oder sein Verderben, weiß Abel allerdings nicht. Der sowjetische Geheimdienst KGB könnte ihn, wie so viele gefangene Soldaten und Spione zuvor, für einen Verräter halten und ins Lager in Sibirien schicken, in den langsamen Tod auf dem Archipel Gulag.
Rudolf Abel weiß das alles genau. Doch er, das hin und her geworfene Menschlein im zynischen Spiel der verfeindeten Atommächte, erträgt dies alles in wortkargem Gleichmut. Er genießt die Zigaretten, die ihm sein Anwalt ins Gefängnis schmuggelt. Er freut sich über die Schostakowitsch-Symphonie, die er über ein kleines Transistorradio hören kann, auch wenn sie ziemlich blechern aus dem Lautsprecher klingt. „Machen Sie sich denn gar keine Sorgen?“ fragt sein Verteidiger Donovan, der mehr und mehr sein Verbündeter, am Ende gar Freund wird. Er fragt das immer, wenn die Lage wieder einmal völlig hoffnungslos zu sein scheint. Und jedes Mal verzieht Abel spöttisch den Mund und fragt zurück: „Würde es denn helfen?“
Würde es denn helfen? Der fatalistische Spion Rudolf Abel, dessen Leben keinen Pfifferling mehr wert zu sein scheint, bringt die Kraft des Schicksalsergebenen auf den Punkt. Was hilft es, Tag um Tag und Nacht um Nacht darüber zu grübeln, dass der eigene Lebensfaden im Grunde schon durchschnitten ist, wenn das Grübeln daran nichts ändert? Welchen Sinn hat es, Szenarien zu wälzen, die eintreten oder nicht, egal was man sich ausdenken mag? Komm her, Schicksal, sagt der kleine sowjetische Spion Rudolf Abel. Lass uns zusammen Schostakowitschs Geigen hören, sind sie nicht großartig? Lass uns eine rauchen, solange es noch Zigaretten gibt, was immer die Gesundheitsapostel davon halten mögen. Und dann sehen wir weiter, in einer Stunde, morgen, kommenden Monat, nächstes Jahr.
Der Fatalismus ist Rudolf Abels Überlebensstrategie. Er macht ihn unangreifbar im Angesicht der Übermacht der Verhältnisse: Ihr habt mein kleines Leben. Doch meine Angst und meine Unterwerfung bekommt ihr nicht. Denn auch ihr seid Ausgelieferte des Schicksals, das morgen genauso gut wie meinen Tod auch meine Rettung und euren Tod bringen kann. Es macht krank und verrückt, sich jeden Tag auszudenken, was passieren könnte – und es macht stark selbst im Aussichtlosen, dagegen ein beherztes: na und? zu setzen. Es garantiert nicht die Rettung gegen alle Wahrscheinlichkeit. Aber die Frage: Was würde es helfen? hat ihre eigene Macht, selbst dann, wenn das Wunder ausbleibt. Denn dieser Fatalismus ist subversiv. Er beugt sich dem Unausweichlichen und bewahrt doch das Eigene. Er richtet sich wieder auf, selbst wenn er weiß, dass er sich dem nächsten Unausweichlichen beugen muss. Er verzieht gewissermaßen den Mund zum Spott, wenn einer mit seiner quälenden Sorge kommt und seiner namenlosen Angst, mit brennendem Hass oder dunkler Verzweiflung: Und – was hilft das alles? Dieser Fatalismus schafft Abstand. Er verkleinert das Übermächtige, wie das auch der Humor tut. Humor und Fatalismus treten oft als Geschwister auf. Was soll man tun, wenn es regnet? Es regnen lassen. Und über den Regen lachen.
Und so steht der kleine Spion für die Schicksalsausgelieferten der Weltgeschichte. Er steht für die Eingesperrten, Deportierten und zum Tode Verurteilten, für jene, die ihrer Habe und ihres Gutes beraubt wurden, für die wozu auch immer Zwangsrekrutierten, für alle, denen der Ausweg zugesperrt ist – und die trotzdem sagen: Was hilft es, wenn ich mir ausgerechnet jetzt Sorgen machte? Er steht für alle, die sich, dem Unausweichlichen zum Trotz, ihre Würde und Menschlichkeit bewahrten, die im Angesicht des Unglücks die Augenblicke des flüchtigen Glücks genossen.
Man muss aber gar nicht ins Räderwerk der Weltkonflikte geraten, um zu sehen, worin der Wert dieser Haltung liegt: Nie hat man sein Leben tatsächlich ganz in der Hand. Jede noch so genau ausgearbeitete Planung hat ihre Grenzen. Jede noch so abgesicherte Existenz hat ihre Risse und Brüche, wie stark die Fundamente auch zu sein scheinen, auf denen diese Existenz ruht. Jeder scheinbar ruhig und in fester Bahn dahingehende Lebenslauf kann morgen seine Wendung nehmen. Wer gesund ist, kann krank werden, wer sich glücklich verheiratet wähnt alleinstehend, der Arbeitnehmer ein Arbeitsloser. Jeder Mensch wird einmal Gesundheit, Liebe, Freundschaft, Arbeit, Anerkennung drangeben müssen, die Fähigkeit zum Laufen wie zum Lesen, zum Kauen, Schlucken, Schmecken, auf die Toilette zu gehen. Altern, Sterben, Tod sind vorherbestimmt.
Man kann sich darüber nun jeden Tag den Kopf zerbrechen, sich grübelnd um den Schlaf bringen, ängstlich die Tage abschätzen, die noch bleiben dürften bis zum Altersheim. Man kann von Arzt zu Arzt hoppen, Pillen fressen und Gesundheitstränke saufen, die Partnerin, den Partner in den Käfig der Eifersucht sperren, im Job Tag und Nacht an der eigenen Unentbehrlichkeit arbeiten – dies alles wird nichts helfen. Das Leben gibt es nur auf Zeit; jede Faser dieses Lebens wird man irgendwann loslassen müssen. Den Zeitpunkt des Loslassens wiederum kann man nur dadurch frei bestimmen, indem man sich umbringt – am besten in dem Moment, da man glücklich verheiratet ist und viele Freunde hat, der Beruf Spaß macht und Erfolg bringt und kein Knie schmerzt am Morgen nach dem Sport. Oder man kann sich diesem Schicksal ergeben, dem Lächeln Spott beimischen und sagen: Was hilft es, sich Sorgen zu machen angesichts des Unausweichlichen? Was hilft es, vor Angst zu erstarren? Es nimmt dem Leben die Freude und die Würde, die Gelassenheit und die Großzügigkeit; es macht bitter, unsympathisch und humorlos. Man muss sich nur einmal im Bekanntenkreis umschauen, wie viel Unheilserwartung dort unterwegs ist, die Leute zu sich kasteienden Sklaven ihrer selbst macht und in ihrer ganzen Umgebung die Freude am Leben frisst. Der Fatalismus ist eine Gegenmacht, gegen alle, die die Welt im Griff haben wollen und jede Unsicherheit im Keim ersticken wollen, die eine gnadenlose Selbstoptimierungsindustrie befeuern, die in ihrer Dauerfröhlichkeit und ihrem falschen Optimismus gnadenlos ist. Ein Hoch also auf den Fatalismus!