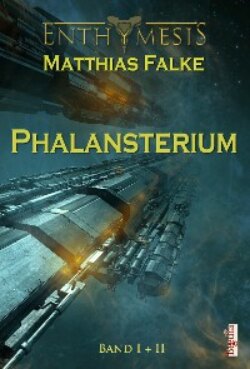Читать книгу Phalansterium - Matthias Falke - Страница 4
Kapitel 1: Katzenjammer
ОглавлениеAls ich aufwachte, war der Platz neben mir leer. Ich blieb noch eine Weile liegen und genoss es, aus den Träumen aufzutauchen und in die Realität zurückzukehren. Lange sah ich mir selbst beim Erwachen zu, und die Bilder flossen von mir ab wie das Wasser von einem Leviathan, der sich zum Sprung aus dem Ozean schält.
Wir waren zusammen gewesen. In einer Weise, die es so nur in Träumen gibt. Wir waren eins gewesen, ein Hermaphrodit mit vier Armen und vier Beinen, zwei Mündern, die sich passgerecht ineinander saugten, und zwei schreienden Lungen. Eine goldene Kugel aus Leben, die Lust verglitzernd den Hang namens Liebe hinunterrollte und in einer weiten baumlosen Ebene liegen blieb. Diese Ebene war ohne Ende, ohne Grenze, ohne Horizont. Eine weiße Sonne brannte auf ihre schwarzen Schlackeflächen herab, ein teilnahmsloser Stern, der nie untergehen und nie erlöschen würde. In der Ferne führte ein Bauer den Pflug über diesen uferlosen Acker des Seins.
Immer wieder sank ich schwer in die Fluten der Visionen zurück, die zäh und teigig waren und mich nicht freigeben wollten. Dann tauchte ich doch daraus empor und war wieder in dem kleinen Zelt. Der Platz neben mir war leer. Der Eingang stand offen. Kühler Wind bauschte die Plane aus intelligentem Material. Draußen schien die Sonne.
Wie herrlich man hier schlief! Wie anders alles war. Die Luft so unbeschreiblich leicht und klar und heiter. Alles war erfüllt von der trockenen Nüchternheit des Hochgebirges. Man fühlte sich frei.
Ich richtete mich auf. Es war kalt. Sowie ich mich aus dem Schlafsack schälte, der selbsttätig die ideale Temperatur gehalten hatte, spürte ich die tausend Kiefer und Zangen des Frostes, die nach meinen Wangen, Händen und Füßen bissen. Der Rest meines Körpers steckte in dem sensoriellen Unterzeug, das sich sofort erwärmte.
Nachts hatte es gefroren. Ich lugte aus dem halboffenen Zelteingang. Wo die Büsche und Sträucher im Schatten lagen, waren sie von knisterndem Reif bedeckt. Aber auf der Wiese, die den Vorplatz unseres kleinen Lagers bildete, webte warmer Sonnenschein.
Ich stand auf und ging hinaus. Das Gras war trocken und warm. Es war herrlich, darüber hinwegzuschreiten. Wann war ich zuletzt barfuss über eine Wiese gegangen? Insekten summten. Asternartige Blumen öffneten ihre Kelche und richteten sie schlaftrunken auf die Sonne aus. Viertausend Meter über mir brannten die Firne der gewaltigen Gebirge dieser Welt im ungefilterten Morgenlicht.
Ich überquerte die Wiese und setzte mich auf einen großen Felsblock, der einladend in dem Meer aus Halmen ausharrte. Aus einer Laune, aus einem Zuviel an guter Laune heraus, schlug ich die Beine unter und nahm Meditationshaltung ein, als sei ich ein großer Yogi. Im Lotossitz, die Augen geschlossen, ließ ich mich von der organischen Wärme bescheinen, die aus dem tiefen Blau des Himmels auf mich ausgegossen wurde. Dieses Licht, diese Wärme, dieses Wohlbefinden gab es nur auf einer Welt, auf der Oberfläche eines Planeten, im schützenden Zelt einer Atmosphäre. Man musste Jahre an Bord von Schiffen und Raumbasen verbrachten haben, sein halbes Leben, um zu begreifen was das war, ein Morgen im Gebirge. Nur hier konnte man Mensch sein. Nur hier konnte man genesen.
Sowie ich die Augen schloss, blitzten wieder Bilder auf. Die metallischen Kuppen der denkenden Inseln in den cyanblauen Ozeanen des Planeten G.R.O.M. Gefechte und Explosionen vor der dröhnenden Leere des Raumes. Schiffe, riesige Schiffe, die brannten, in den Orbits über so vielen Welten. Jennifer, die aus dem Wasser geschritten kam und sich neben mich in den Schatten einer fremdartigen Palme lagerte. Jennifer, die ausgemergelt auf einer kupferfarbenen Klippe ausharrte wie der Heilige Gregor vor seiner Erwählung. Jennifer, die mich zum ersten Mal küsste und dann, ohne den Blick von mir zu nehmen, die Kleider abstreifte, sich von mir losmachte und ins Meer hinauslief, das warm vor lauter Nacht und Begierde war.
Jennifer!
In den Jahrzehnten unseres gemeinsamen Lebens war es uns Gewohnheit geworden, dass sie vor mir aufstand. Sie brauchte weniger Schlaf als ich. Meist war sie morgens schon auf der Brücke oder im Labor oder wo wir eben gerade zu tun hatten, bis ich die Benommenheit abschüttelte und mich von einer Tasse Kaffee zur Vernehmungsfähigkeit anstacheln ließ.
Auch jetzt war sie verschwunden. Sie musste aufgestanden und aus dem Zelt gekrochen sein, als ich noch in der klebrigen Schwere der Morgenträume hing. Sie träumte ebenfalls viel. Nachts hörte ich sie keuchen, stöhnen und schreien. Sie warf sich herum, und die ausgeklügelte Sensorik des intelligenten Schlafsacks konnte nicht verhindern, dass sie schweißgebadet war. Was bei mir nur besonders plastische Träume bei Nacht und irritierend intensive Déjà-Vues am Tag waren, waren bei ihr tödliche seelische Verwundungen und Traumata. Diese Verletzungen gingen auf ihre Geiselhaft bei den Zthronmic zurück. Und die Monster, die sie in inneren Käfigen verschlossen hatte, hatten während ihres Zusammenbruchs auf der spektakulären Hochzeit der kuLau laut und vernehmlich an ihren Gitterstäben gerüttelt .
***
Der Repräsentant Ang’Laq stand im Vorzimmer wie ein übermannshoher Ficus. Seine langen Extremitäten, die an Schlingpflanzen erinnerten, gestikulierten sachte, wie von einem zärtlichen Lufthauch bewegt. Noch nie war ich einem dieser Wesen so nahe gekommen, und jetzt stand ich in seiner Aura wie in der Duftglocke eines tropischen Gewächses. Die Zweige und Blätter verströmten den intensiven erdigen Geruch eines Tomatenstrauchs, dessen Laub man in der prallen Sonne mit den bloßen Händen brach. Es war aber auch ein süßeres Arom hinein vermischt, Blütenstaub und schwerer Pollen. Der kuLau war trächtig. An seinen Zweigen hingen überall halbreife birnenförmige Früchte. Bald würden sie abfallen und zu Sekundärwesen heranwachsen. Der Hochzeit und Paarung hatten wir beigewohnt. Wir hatten miterlebt, wie hochwohlgeborene Brautleute und Fürstenkinder ineinander gewachsen waren. Sie hatten ihre Blütenschirme einander zugewandt, und in diesem Moment begriff man, dass es Halbsphären waren. Sie ergänzten einander zu bunten, oszillierenden, farbensprühenden Kugeln. Ihre pflanzenartigen Körper, die einander während des Tanzes umwunden hatten, rankten sich ineinander, wucherten durcheinander, verflochten und verstrickten sich miteinander, bis sie zu einem hochragenden Strauch verschmolzen, der astreicher und buschiger war als zuvor.
Dieses Wesen stand nun vor mir und ließ seine lianengrünen Zweige im Wind eines unhörbaren Gespräches wehen.
Der Translator übersetzte. Den kuLau war der Vorfall unangenehm. Ihre Hochzeit hatte der festliche Höhepunkt der Neugründung der Union sein sollen. Die Wirkung auf die Zuschauer hatten sie so nicht vorhergesehen. Dass ausgerechnet Jennifer einen lebensbedrohlichen Zusammenbruch erlitten hatte, erfüllte sie mit Bestürzung. Der Repräsentant Ang’Laq, der aus der zeremoniellen Vereinigung hervorgegangen war, drückte seine Besorgnis und Anteilnahme aus. Ich dankte ihm und nahm das Geschenk entgegen. Eine Art Honig, der von seinem Heimatplaneten stammte und dessen Genuss heilkräftige Wirkung zugeschrieben wurde. Angesichts der Erschütterungen, die der bloße Anblick ihrer Hochzeit im Publikum hervorgerufen hatte, verspürte ich wenig Lust, das Zeug zu mir zu nehmen oder damit an Jennifer zu experimentieren. Aber das sagte ich natürlich nicht. Ich dankte dem Repräsentanten für seine Anteilnahme und versicherte ihm, dass ich ihn über das Stabslog auf dem Laufenden halten werde, was Jennifers Genesung anging. Dann komplimentierte ich ihn hinaus. Noch lange hing der üppige Geruch im Raum, wie von einem blühenden Gehölz nach einem Monsunregen auf einer fruchtbaren Tropenwelt.
Laertes kam herein. Er war Ang’Laq noch im Durchgang begegnet, der zum Unionsmodul führte, und hatte ein wenig Konversation mit ihm gemacht. Jetzt reichte er mir die Hand.
»Beneidenswert«, sagte er nachdenklich.
»Was meinst du?«
»Man sagt, Geliebte würden im Himmel zu einem Engel. Diesen Kreaturen ist das schon im Diesseits vergönnt.« Er lächelte melancholisch.
»Würdest du das wollen?«, fragte ich.
»Man wäre nie mehr allein.« Er hob die Schultern und sah mich an. Dann wurde er ernst. »Wie geht es ihr?«
Ich beschrieb eine ausweichende Geste. »Ihr Zustand ist stabil.«
Der alte Philosoph las in meiner Miene wie in einem Buch. »Kann ich sie sehen?«
»Sie lassen niemanden hinein.«
Er nickte.
Ich trat an die Tür zum Krankenzimmer und öffnete sie einen Spalt. Laertes lugte hindurch. Wir blickten auf das Bett und die abgemagerte Jennifer, die seit achtundvierzig Stunden im Koma lag. Sofort sprang die Krankenschwester auf, die zu ihrer Bewachung abgestellt war.
»Bitte, meine Herren«, fauchte sie. »Die Patientin benötigt absolute Ruhe!«
Laertes zog sich zurück. Ich schloss die Tür wieder. Er kaute auf den Lippen. Ich sah, dass der Anblick ihm nahegegangen war.
»Wird sie ...« Er brachte den Satz nicht zuende.
»Sie wird zurückgeholt«, sagte ich. »Voraussichtlich morgen.«
Er stieß gequält die Luft aus. »Warst du die ganze Zeit bei ihr?«
Ich nickte.
***
Nach ihrem Kollaps hatte ich sie auf die Krankenstation gebracht, die die Union auf dem Torus unterhielt. Man hatte sie an die Überwachung angeschlossen und in einen künstlichen Heilschlaf überführt. Zwei Tage und zwei Nächte wachte ich an ihrem Bett. Ihre Werte normalisierten sich allmählich. Am Kopfende hingen die Apparate, die ihren Kreislauf überwachten. Medikamente und Nährlösungen tröpfelten aus durchscheinenden Schläuchen in ihre Armvene. An Brust und Schläfen hafteten Sensoren, die jeden Herzschlag, jeden Atemzug, jede Veränderung des Muskeltonus oder der Hautelektrizität registrierten.
Und am Fußende baumelten die Beutel, die ihre Ausscheidungen auffingen. Die Schwester wollte mich hinausschicken, wenn sie sie erneuerte. Aber ich weigerte mich. Da gab es nichts, weswegen man sich hätte schämen müssen. Ich trat beiseite, um ihr Platz zu machen, und sah dann zu, wie sie sie wusch und ihre Hilfsmittel auswechselte. Jennifer lag da, zum Skelett abgemagert. Von oben führten Schläuche zu ihrer Nase und ihren Armen. Aus ihrem Unterleib kamen andere Schläuche hervor. Der menschliche Organismus war nur ein Durchlauferhitzer für unterschiedliche Säfte. Eine Maschine, die Zucker in Harn verwandelte, und nichts außerdem? Die Apparate registrierten ihre Hirnströme. Es gab Phasen der Ruhe und Phasen starker Aktivität.
»Sie träumt«, sagte der behandelnde Arzt, wenn wir auf die fiebrigen Ausschläge der Diagramme starrten.
Ich wusste, dass es keine normalen Träume waren. Es waren Traumata, Urängste, nicht wiedergutzumachende Verstörungen und mentale Verletzungen. Ein seelischer Krebs fraß an ihr.
Ihr Haar wurde immer ungebärdiger. Ich half der Schwester, es zu kämmen und in einem Netz zu verstauen, wie Jennifer es auch verwandte, wenn sie einen Helm trug. Wir würden es abschneiden müssen, wenn sie noch länger im Koma blieb. Aber der Arzt beruhigte mich. Mehr als ein oder zwei Tage waren nicht nötig.
Es gab auf dem Torus weder Tag noch Nacht. Die gigantische Raumstation trieb frei auf ihrer Bahn um das Doppelsystem, dessen rotes und blaues Licht seinem eigenen Rhythmus folgte. Ich programmierte das Krankenzimmer auf einen Vierundzwanzigstunden-Modus, so dass die Außenfenster selbsttätig die Polarisation vertieften, wenn es »Abend« wurde. Dann hatte auch die Schwester Schichtende. Ich saß in dem gravimetrischen Stuhl, den ich an das Bett herangefahren hatte, und döste, Jennifers Hand in der meinen. Ab und zu zuckten ihre Finger, als wolle sie mir im geheimen Zeichen-Alphabet der Prana Bindu etwas mitteilen. Aber es waren nur Reflexe, die durch ihre Nervenstränge liefen. Es war dunkel. Lediglich die Anzeigen der Apparate glimmten grün und blau durch die künstliche Finsternis. Im Grunde war es wie auf der Brücke eines Schiffes, wenn man die Nachtwache übernommen hatte. Nur Dunkelheit und das leise Rauschen der Lüftung und der sonstigen Instrumente. Gedanken kamen und gingen. Der eigene Atem wurde aufdringlich. Manchmal war es so still, dass man den Puls hören konnte, der einem in der Brust schmetterte, als müsse das einfach so sein. Ich schlief ein und schrak wieder hoch. Eine Stunde war eine gelinde Ewigkeit, eine uferlose Ebene aus Zeit. Aber wenn die Nacht vorbei war und die Panoramascheiben ganz von selber wieder transparent wurden, hatte ich das Gefühl, dass ich mich gerade erst hingesetzt hatte. Die Zeit war verdunstet, in dem Moment, da sie vergangen war. Sie hinterließ nicht die geringste Spur in meinem Bewusstsein.
Morgens half ich der Schwester, Jennifer zu waschen und ihre Anschlüsse zu erneuern. Ich ging duschen und holte mir einen Kaffee. Und dann saß ich wieder da und sah sie an, die immer noch schöner wurde.
Immer wieder musste ich die Freunde abwimmeln, die im Vorraum herumlungerten oder über Stabslog anfragten. Es tat ungeheuer gut, ihre Anteilnahme zu spüren. Aber solange es nichts zu berichten gab, hatten die Erkundigungen auch etwas Quälendes. Sie sahen das in der Regel ein und verabschiedeten sich wieder. Ein ums andere Mal sagte ich den Satz, dass ich sie auf dem Laufenden halten werde. Aber es geschah nichts. Jennifer war wie eine Pflanze. Organisches Gewebe, in dem Flüssigkeiten zirkulierten. Ich konnte nur mutmaßen, was in ihr vorging, und hoffen, dass das künstliche Koma, in das man sie gesperrt hatte, für ihren Geist nicht zu einem Verlies wurde, in dem sie den Ungeheuern hilflos ausgeliefert war. Was, wenn die Monster, die sie in sich trug, sich losgerissen hatten und ihre Seele zerfleischten, und die Flucht ins Bewusstsein ihr einziger Ausweg war, aber diesen Ausweg hatte man ihr verlegt?
Ich versuchte Hoffnung aus der routinierten Teilnahmslosigkeit des Arztes und der Schwester zu saugen. Sie gingen ihren Aufgaben nach, als handele es sich um die Bedienung einer robusten und gefühllosen Maschine. Ab und zu notierte der Mediziner etwas in seinem Log oder er gab der Schwester halblaute Anweisungen. Dann fummelte diese an der Steuerung der Überwachung. Vielleicht wurde das Dopamin erhöht oder der Blutzucker abgesenkt? Mir teilte man davon nichts mit, obwohl ich anwesend und der nächste Angehörige war. Ich ließ es auf sich beruhen und tröstete mich mit der Überlegung, die Leute würden schon alles richtig machen.
***
Nachdem Laertes gegangen war, drückte ich mich wieder ins Zimmer, um meinen Platz einzunehmen. Aber die Schwester, die Jennifer unterdessen für die Nacht fertig gemacht hatte, schickte mich weg.
»Sie müssen sich ausruhen«, sagte sie.
Ich erwiderte, dass ich am Morgen geduscht und frische Sachen angezogen hatte. Über den Tag verteilt hatte ich mich mit Kaffee und den trockenen Keksen aufrecht gehalten, die ich auch auf der Brücke der Enthymesis immer zur Hand hatte, und so würde ich auch die kommende Nacht überstehen.
»Sie sollten sich einmal sehen, Commander!« Sie lachte. Im Gegensatz zu dem barschen Ton, mit dem sie Laertes und andere Besucher fortschickte, war sie erstaunlich freundlich, wenn wir unter uns waren.
»Ich komme zurecht«, sagte ich. »Danke für Ihre Aufmerksamkeit.«
»Gehen Sie auf Ihre Kabine und legen Sie sich hin«, wiederholte sie, jetzt schon wieder ein Spur strenger. »Morgen beginnen wir mit der Rückholung, da braucht Ihre Frau Sie mehr als jetzt.«
Ich ließ einen letzten Blick über die madonnenhaft schöne Jennifer schweifen, die wie aufgebahrt in ihrem Bett ruhte, und sah es dann ein. Mit der Schwester war nicht zu spaßen, und die Aussicht, wenigstens ein paar Stunden in einem richtigen Bett zu schlafen, wurde in diesem Moment zu einer übermächtigen Verlockung.
»Ist gut«, sagte ich matt. »Aber jemand ist hier?«
»Eine Kollegin kommt«, sagte die Krankenschwester. »Im übrigen haben wir hier eine vollautomatische Überwachung. Wenn etwas passiert, ist der Arzt in dreißig Sekunden da.«
Ich nickte resigniert.
»Aber es wird nichts passieren«, sagte sie noch. »Ihr Zustand ist vollkommen stabil.«
Da riss ich mich los und ging hinaus.
Das Unionsmodul war nicht sehr groß und zu dieser Zeit nur spärlich besetzt. Ich schaffte es, in den Bereich der Offiziersunterkünfte zu kommen, ohne jemandem zu begegnen. Aus irgendeinem Grund wollte ich jetzt niemanden sehen und mit niemandem reden. Einige junge Piloten und Adjutanten vom Stab kamen mir entgegen, die unpersönlich grüßten, aber mich zum Glück nicht behelligten. Ich ging in die Lounge und bestellte bei der Ordonnanz ein Abendessen. Immerhin die erste warme Mahlzeit seit achtundvierzig Stunden. Dann begab ich mich auf meine Kabine.
Ich setzte mich aufs Bett. Die Ordonnanz kam und brachte das Tablett. Ich wartete, bis sie wieder gegangen war, und widmete mich dann schweigend dem Hühnchen, dem Curryreis und dem frischen Gemüse, das weder frisch war noch Gemüse, das aber doch erstaunlich gut schmeckte. Nach dem Essen holte ich mir ein Bier aus der kleinen Bar, die wir im Zimmer hatten. Dann saß ich wieder da. Laertes’ Worte gingen mir im Kopf herum. Solange ich an Jennifers Bett gewacht hatte, war ich nicht allein gewesen. Sie war ja da, wenn auch nur in Gestalt einer zum Skelett abgemagerten, von wächserner Haut bespannten Mumie, von der man nur rätseln konnte, ob noch genügend Leben in ihr war, um jemals wieder zu erwachen.
Erst jetzt, auf der standardisierten Kabine, die unsere Unterkunft während unserer Aufenthalte auf dem Torus war, spürte ich die drückende Last der Einsamkeit, die schwerer und schwerer wurde. Sie türmte sich über mir wie ein Berg, der mir die Brust zusammendrückte. Wie würde es sein, wenn Jennifer nie wieder zu sich kam? Ich begriff, dass ich das nicht ertragen würde, und versuchte, den Gedanken beiseite zu schieben. Aber es gelang nicht. Eine Leere tat sich auf, die ich in meinem ganzen Leben nicht gekannt hatte. Ein Abgrund, dessen andere Seite im Nebel lag, so dass man nicht wissen konnte, wie weit sie entfernt war und ob es sie überhaupt gab.
»Man wäre nie wieder allein.«
Aber uns war das nicht vergönnt.
Irgendwann kamen der Schlafmangel und der Alkohol mir zuhilfe und entführten mich in gnädige Bewusstlosigkeit.
Am nächsten Morgen fand ich mich um acht Uhr Bordzeit im Krankenzimmer ein. Der Arzt und die Schwester waren schon da. Die »Kollegin«, die angeblich die Nacht auf der Station verbracht hatte, war natürlich eine Lüge gewesen, um mich loszuwerden. Ich zuckte dazu die Achseln. Es war alles gut gegangen. Jennifer hatte auch ihre dritte Nacht im Koma überstanden.
Der Arzt nickte mir zu. Für seine Verhältnisse wirkte er heute geradezu unternehmungslustig. Die Schwester trat an das Steuermodul der Überwachungseinheit und nahm ein paar Eingaben vor. Im Grunde war es nicht anders als auf der Brücke eines Schiffes. Der Kommandant befahl eine Kursänderung, die Piloten gab an der Konsole die Koordinaten ein. Der Vektor, der jetzt anlag, lautete Bewusstsein.
Die Nanopumpen begannen zu arbeiten. Andere Hormone und Medikamente strömten in den Organismus, der irgendwie das tragende Substrat einer Entität namens »Jennifer« war. Das alles wurde mir immer rätselhafter und unheimlicher, je länger ich es mir ansah. Nicht, dass ich nicht jeden Zentimeter dieses Körpers kannte und, von den Zehen bis zum Scheitel, tausendmal geküsst hatte, aber letztlich war es doch nur eine sterbliche Hülle. Was hatte sie damit zu tun?
Am späten Vormittag schlug sie die Augen auf. Sie war blass, und ihr Blick war voller Staunen. Ein Neugeborenes, das ein voll entwickeltes Bewusstsein hatte und doch alles zum ersten Mal sah, würde so in die Welt schauen, sprachlos vor Schwachheit und Überwältigung. Sie konnte nichts sagen. Sie war zu erschöpft, um Worte zu formen. Aber das war auch nicht nötig. Ich legte den Finger an die Lippen, um es ihr zu bedeuten. Wir sahen uns einfach nur an. Sie lächelte. Alles war gut.
Sie war intubiert gewesen. Das Einzige, was sie hervorbrachte, war ein heiseres Krächzen. Es schien ihr Schmerzen zu bereiten. Ich gestikulierte eine Weile, um auszudrücken, dass sie sich Zeit lassen und sich schonen solle, bis mir einfiel, dass sie stumm, aber nicht taub war.
»Ruh dich aus«, sagte ich, unwillkürlich flüsternd.
Sie legte den Kopf schief und betrachtete mich auf diese warme Art, bei der ich mich immer wie ein kleiner Junge fühlte.
Die Schwester flößte ihr ein paar Tropfen süßen Tees ein. Dann schien ihr zumindest das Schlucken nicht mehr so schwer zu fallen.
Ihre Kabel, Schläuche und Katheter wurden entfernt. Ich half ihr aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen, um ihren Kreislauf in Schwung zu bringen. Dann begleitete ich sie auf die Toilette. Das Wasserlassen musste eine Qual sein. Ich sah, wie sie ihre ganze Selbstbeherrschung aufbot. Der Urin war dunkel und voller Blut. Trotz der intravenösen Versorgung war sie dehydriert. Es kostete sie Überwindung, wieder aufzustehen. Mit einem angespannten Lächeln, als beobachte sie einen Vorgang, der sie im Grunde nichts anging, ließ sie all diese Verrichtungen über sich ergehen. Ich hielt sie an der Hand und geleitete sie die paar Schritte bis zur Dusche. Dort wusch ich sie mit warmem Wasser. Es waren Augenblicke einer nicht mehr zu überbietenden Intimität. Nicht anders, als wenn ich mich selbst eingeseift und abgespült hätte. Wir waren eins!
Anschließend bekam sie ein Nachthemd übergestreift und wurde wieder ins Bett gelegt. Die Schwester löffelte ihr eine Suppe ein. Und ganz langsam kam sie wieder zu Kräften. Ihr Gesicht, das gelb und wie ausgeleert gewesen war, bekam wieder Farbe. Ihr Blick wurde präziser, wacher, klarer. Zwei Stunden, nachdem sie die Augen aufgeschlagen hatte, hatte ich das Gefühl, dass es wieder Jennifer war, die mich aus den Kissen heraus anblickte.
Ich brachte sie auf den letzten Stand. Die Gründung der Neuen Union. Den Rückzug der Tloxi von dem Planeten G.R.O.M. Die Einsetzung einer paritätisch von allen raumfahrenden Völkern kontrollierten Kommission, die die Zthrontat-Vorkommen in der Galaxis verwaltete. Sie hörte sich das an. Ob es sie interessierte, war nicht zu erkennen. Anschließend streckte sie sich aus und schlief mehrere Stunden.
***
Jennifer blieb verschwunden. Daran war nichts Besorgniserregendes. Sie war schon immer eine Herumtreiberin gewesen, eine Ausreißerin. Morgens stand sie auf und tigerte irgendwo herum. Auf der ENTHYMESIS fand man sie im Labor, auf der MARQUIS DE LAPLACE ging sie gerne aufs Drohnendeck. Schon früher war sie eine gewesen, die sich nicht festlegen ließ und schon gar nicht einsperren. Auf der Akademie galt es als aussichtslos, dass jemand sie heimführen könne. Ihr Wille nach Freiheit und Unabhängigkeit war größer als alles andere. Mit dem einen oder anderen ging sie aus, aber nie länger als für eine Nacht. Sie würde sich niemals binden, hieß es, und es wurden Wetten abgeschlossen, wer sich als nächstes an ihr die Zähne ausbeißen würde. Eine Zeitlang sah es so aus, als würde Wiszewsky das Rennen machen. Er war die mit Abstand beste Partie in der gesamten Union. Gutaussehend, charmant, und nach Persephone wurde er Oberkommandierender der neuen MARQUIS DE LAPLACE.
Aber dann hat sie doch einen gewissen Frank Norton erwählt und ist den Rest ihres Lebens mit ihm zusammengeblieben.
Ich saß auf dem Felsblock mitten in der Wiese, ließ mich von Insekten umsummen und saugte die Sonne in mich auf.
Jennifer.
Je älter ich wurde, umso unwahrscheinlicher kam mir alles vor. Nicht, dass wir das Universum umrundet und das Sinesische Imperium in den Staub getreten hatten, sondern die scheinbar ganz alltäglichen und selbstverständlichen Dinge. Dass ich Kommandant eines Schiffes war. Dass wir die Akademie abgeschlossen hatten. Manchmal vergaß ich das und war dann wieder der neunzehnjährigen College-Absolvent, der sich voller Angst und Abenteuerlust zu einer Karriere bei der Union entschlossen hatte. Staunend betraten wir am ersten Tag den Campus und standen lange vor dem originalgetreuen Nachbau eines ENTHYMESIS-Explorers, der fünfzig Meter hoch und zweihundert Meter breit den Zugang zu den Instituten und Hörsälen versperrte. Hier war es ein Modell im Massstab eins zu eins, in dem die Verwaltung untergebracht war. Aber solche Schiffe gab es wirklich. Wir würden mit ihnen fliegen.
Und dass ich eine Jennifer Ash mein eigen nannte.
Mein Sitz auf dem sonnenwarmen Stein war wie ein Horst auf einer Bergspitze, von der ich über eine weite Landschaft hinaussah. Die Jahrzehnte wurden zu einer Ebene, die ich überblickte und auf der ich in Gedanken hin und her wandern konnte. Schlachten tobten darauf und Passagen düsterster Einsamkeit. An Aufregung hatte es nicht gemangelt. Aber eine war immer neben mir gegangen.
Auch wenn sie gerade einmal nicht zu sehen war. Vielleicht streifte sie am Fluss entlang oder sie kraxelte in einem Seitental herum. Oder sie hatte sich einen Platz wie diesen gesucht, um darauf zu meditieren. Nachts hatte sie gestöhnt und geschrien. Ich hatte immer wieder versucht, sie zu beruhigen. Obwohl das sensorielle Gewebe ihre Körperfunktionen überwachte, war sie schweißgebadet gewesen. Sie hatte den Schlafsack abgeschüttelt und lag ungeschützt im Zelt, dessen äußere Planen von Raureif knisterten. Sie knirschte mit den Zähnen wie damals, bei der Hochzeit der kuLau, und sie trat mit den Beinen aus, als erwehre sie sich einer imaginären Meute, die nach ihren Knöcheln schnappte.
Irgendwann war ich eingeschlafen. Ich hatte nicht mitbekommen, wie sie das Zelt verlassen hatte. Jetzt war sie fort. Ich konnte sie anpingen. Dann fiel mir ein, dass sie ihr Handkom fortgeworfen hatte. Sie wollte offline sein auf dieser Wanderung. Und ganz langsam fing ich an, mir Sorgen zu machen.
***
Am Nachmittag wachte sie wieder auf. Das unternehmungslustige Funkeln in ihren Augen drückte aus, dass sie vollständig wiederhergestellt war. Sie schwang die Beine aus dem Bett und sah sich suchend im Zimmer um. Ihre Gala-Uniform, in der sie zu der Hochzeit gegangen war, hatte ich auf unsere Kabine gebracht.
»Würdest du mir bitte etwas zum Anziehen bringen?« Ihre Stimme war noch immer heiser, aber ihrem Elan tat das keinen Abbruch.
»In dem Nachhemd siehst du entzückend aus!«
Tatsächlich kleidete der knielange Kittel, der aus sensoriellen Gewebe bestand und mit Elektronik vollgestopft war, sie vorzüglich.
»Idiot. Soll ich so über die Plaza laufen?«
»Warum nicht.«
Sie feixte.
»Ich habe dich über die Plaza getragen«, sagte ich. »Und der Schaum ist dir vor dem Mund gestanden.«
Sie zog die Brauen hoch.
»Ganz zu schweigen davon, wie du ausgesehen hast, als wir dich von G.R.O.M. geholt haben.«
»Frank Norton. Würdest du bitte das Geschwätz abstellen und mir etwas Vorzeigbares zum Anziehen organisieren? Vielleicht reichen deine Befugnisse als ranghöchster Offizier der Union noch weit genug, an eine Uniform oder einen Freizeitanzug zu kommen!«
»Reg dich nicht auf«, lachte ich. »Wir müssen erstmal sehen, was der Doc dazu sagt.«
Ihr Blick durchbohrte mich und nahm einen »Da hast du es!«-Ausdruck an. Natürlich war die Krankenschwester, die in einem Nebenraum gewartet hatte, auf uns aufmerksam geworden. Sie kam herüber und scheuchte Jennifer ins Bett zurück.
»Nicht so hastig, junge Frau!«
Sie starrte mich strafend an. Ich hob entschuldigend die Hände. Offenbar wusste sie nicht, mit wem sie es zu tun hatte, wenn sie mir zutraute, einer Jennifer Ash einen fremden Willen aufzuzwingen.
»Sie müssen noch mindestens vierundzwanzig Stunden zur Beobachtung hier bleiben.«
Jennifer schnaufte angewidert. Einige Sekunden lang schossen ihre Augen zwischen mir und der Schwester hin und her. Dann schien sie es einzusehen. Sie zog die Beine wieder unter die Decke, fuhr das Kopfteil des Bettes ganz nach oben und hockte sich mit schmollender Miene hin.
»So ist brav!« Die Schwester tauschte einen verschwörerischen Seitenblick mit mir. »Sie müssen erst einmal wieder vernünftig essen und trinken, Kind. Ein bisschen zu Kräften kommen. Morgen früh ist Visite, und dann sehen wir weiter.«
Sie verschwand in ihrem Kabuff und kam mit einem Tablett wieder, auf dem ein frugales Mahl aus Tee, Zwieback und Suppe prangte.
Jennifer stieß noch ein paar Mal ein genervtes Keuchen aus, aber die Schwester pflanzte sich neben dem Bett auf und blieb dort stehen wie ein Wachtposten bei einer Inhaftierten. Das Namensschild an ihrem Matronenbusen wies sie als »Olga« aus. Ihr Akzent war osteuropäisch, polnisch oder ukrainisch. Ich hatte in den letzten Tagen vermieden, mich mit ihr anzulegen, und selbst Jennifer kam jetzt zu dem Schluss, dass es das Beste sei, ihre Anweisungen zu befolgen.
»Gut«, knurrte Olga drohend, als sie sich davon überzeugt hatte, dass mit Flucht für den Moment nicht zu rechnen war. »Ruhen Sie sich aus, sie haben alle Zeit der Welt.«
Jennifer reagierte nicht. Mit leeren Blicken kaute sie einen Zwieback.
Die Schwester ging hinaus, nicht ohne mich noch einmal ins Gebet zu nehmen.
»Passen Sie auf sie auf, Commander. Sie fühlt sich jetzt stark, aber sie ist noch sehr schwach. Noch ein solcher Zusammenbruch, und wir können sie nicht wieder zurückholen!«
Dann ließ sie uns allein.
»Du hast es gehört«, sagte ich.
Jennifer erwiderte nichts. Aber die fünfminütige Quälerei, die es sie kostete, einen halben Zwieback zu essen und mit ein paar Schlucken Tee nachzuspülen, sprach eine deutliche Sprache.
»Es geht mir wunderbar!«, maulte sie. Ihre Stimme war noch immer rau und belegt.
»Wir verpassen nichts«, erklärte ich. »Im Moment bist du sowieso krankgeschrieben, und wir haben noch mehrere Monate Urlaub. Ich habe nachgesehen.«
»Darum geht es nicht.«
»Wenn es mit deinen – Verletzungen zu tun hat.«
Sie sagte nichts. Stur vor sich hinstarrend, schlürfte sie ihre Suppe.
»Wir können jemandem vom psychologischen Dienst kommen lassen. Du brauchst professionelle Betreuung.«
Ihre Schweigen wurde einige Nuancen eisiger. Ich wartete ab. Dann sagte sie:
»Lass mich mit diesen Trotteln in Ruh'. Von denen kann mir niemand helfen.«
»Was willst du tun?«
»Ich weiß schon, was ich mache und wo ich Hilfe finde. Aber dazu muss ich hier raus.«
»Alles, was du willst, Jennifer. Aber nicht heute und nicht morgen. Du bist einfach noch zu schwach.«
Sie seufzte theatralisch. Dabei war sie so erschöpft, dass sie kaum den Löffel halten konnte. Er zitterte in ihrer Hand, und bei jedem Versuch, ein paar Tropfen Suppe zu essen, verkleckerte sie die Hälfte. Endlich ließ sie es zu, dass ich sie fütterte.
»Gott, ist das peinlich«, stöhnte sie.
»Nicht peinlicher, als was wir sonst miteinander erlebt haben.«
»Ich bin doch keine alte Frau!«
»Man ist so alt, wie man sich fühlt.«
»Demnach bin ich mindestens hundertfünfzig.« Sie trotzte sich ein tapferes Lächeln ab. Und im übrigen war sie biologisch gesehen natürlich eine knackige Fünfzigerin.
»Du musst Geduld haben, Geduld mit dir selber.«
Sie stieß die Luft durch ihre schöne schmale Nase aus.
»Alle sind hier, um dir zu helfen. Du bist in Sicherheit. Es kann nichts mehr passieren.«
Wir schafften es, die Suppe zu leeren und zwei Tassen Tee zu trinken. Dann biss sie wieder auf dem trockenen Zwieback herum.
»Mein Gott, Frank!« Sie schüttelte den Kopf. »Wir sind ausgezogen, die Galaxis zu erobern, und jetzt sitze ich hier wie ein kleines Kind, dem man sein Njamnjam einlöffeln muss!«
»Was soll ich dazu sagen?«
»Das darf doch alles nicht wahr sein!«
»Ich habe dir sogar die Windeln gewechselt!«
»Ich ertrage das nicht mehr.« Sie machte wieder Anstalten, sich unter dem Tablett hervorzuwinden und die Beine aus dem Bett zu strecken.
»Bleib, wo du bist«, sagte ich. »Oder ich hole Schwester Olga.«
»Du Schuft!« Sie funkelte mich böse an. »Man könnte meinen, das ganze macht dir Spaß!«
»Sagen wir so: Sehr viele Dinge in letzter Zeit haben mir keinen Spaß gemacht, und ich habe keine Lust, dass sie sich wiederholen.«
Sie ließ es geschehen, dass ich ihre Beine packte und sie wieder unter der Decke verstaute. Ich nahm das Tablett und stellte es auf einen der Instrumentenschränke, die im Moment nicht benötigt wurden. Die Standardüberwachung, die in ihre Nachthemd eingearbeitet war, lief im geschützten Bereich des Stabslogs auf, wie das mit den medizinischen Protokollen unserer ganz normalen sensoriellen Anzüge auch nicht anders war.
In ihren Augen glitzerte der Widerspruchsgeist, aber selbst der kurze Wortwechsel hatte sie so angestrengt, dass sie sich kaum noch aufrecht halten konnte. Sie ließ sich wieder in die Kissen sinken und schlief wenig später ein. Ich schob meinen Sessel erneut an das Bett heran, nahm ihre Hand und sah über ihren Oberkörper hinweg zum Fenster. Die rote Sonne des Doppelsystems schien warm zu der nur leicht polarisierten Front herein. Ihr Licht lag golden auf Jennifers ruhigen Zügen, wie an einem Nachmittag im Oktober irgendwo in Oberitalien. Sie atmete leise und gleichmäßig. Ich saß nur da und sah sie an. In den Jahrzehnten unseres gemeinsamen Lebens war ich ihr noch nie so nahe gewesen.
Wenig später schob sich die Schwester ins Zimmer und schickte mich fort.
Als ich am Morgen in Jennifers Krankenzimmer zurückkehrte, saß sie hoch aufgerichtet da, trank ihren Tee und plauderte angeregt mit dem Arzt. Äußerlich war sie wieder hergestellt. Sie würde sich schonen und eine ausgesuchte Diät einhalten müssen, um wieder zu Kräften zu kommen. Aber körperlich war sie ganz gesund.
Ich half Jennifer, sich zu waschen, während die Schwester die Überreste des Frühstücks entsorgte. Der Arzt saß solange an einer kleinen Konsole und übertrug sämtliche Daten und seinen Bericht in den geschützten Teil des Stabslogs. Dann stand er wieder auf, um sich von uns zu verabschieden.
»Ich kann nichts mehr für sie tun«, sagte er zu mir. »Aber das heißt nicht, dass sie geheilt ist!«
Ich nickte. Das war mir alles klar. Aber was wir nun tun sollten, konnte er mir auch nicht sagen.
»Sie bleibt noch einmal vierundzwanzig Stunden hier. Danach sind Sie beide frei, zu gehen wohin Sie wollen.«
Mein Blick zuckte erschrocken zu Jennifer, aber sie reagierte nicht. Offenbar hatte der Arzt ihr das schon zuvor gesagt.
Er ging hinaus.
»Sie können Besuch empfangen, wenn Sie wollen«, sagte Schwester Olga. »Aber bitte, bleiben Sie vernünftig und übertreiben es nicht gleich.«
Ich verabschiedete mich von ihr, die sich mit einer Miene zurückzog, als würden wir jeden Augenblick einen groben Unfug anstellen. Offenbar war sie nicht der Meinung, es mit verantwortungsbewussten erwachsenen Leuten zu tun zu haben. Was Jennifer anging, war ich da selbst nicht so sicher. Aber für den Moment verhielt sie sich erstaunlich friedlich. Sie schien sich mit der Situation abgefunden zu haben, und eine Frist von einem Tag und einer Nacht, das war selbst für sie überschaubar.
Die ersten, die zaghaft an der Tür klopften, nachdem ich ihnen via Stabslog das Okay gegeben hatte, waren Jill und Taylor.
»Oh mein Gott, Jennifer!« Lambert stürmte ans Bett und schloss ihre frühere Pilotenkollegin in die Arme.
Taylor begrüßte mich mit einem kantigen Händedruck und ging dann zu Jennifer, um ihr ebenfalls guten Tag zu sagen.
»Wie geht es dir?«, fragte Jill.
»Wunderbar.« Jennifer sah sie an und strich ihr eine Strähne ihres ewig wirren Haars aus der Stirn. Für sie war die kleine Copilotin immer so etwas wie eine jüngere Schwester gewesen. Taylor begrüßte sie kühl, wenn auch nicht mehr ganz so herablassend wie zu früheren Zeiten.
»Sie kann Bäume ausreißen«, sagte ich sarkastisch. »Nur die blöden Ärzte sehen das nicht ein und verdonnern sie zu Bettruhe.«
Jill ließ einen Blick zwischen Jennifer und mir hin und hergehen.
»Die Wahrheit ist«, sagte Jennifer, noch immer krächzend, »es geht mir ziemlich beschissen.«
»Wir haben gesehen, wie Frank dich rausgetragen hat«, plapperte Jill. »Da sind wir natürlich erschrocken. Um ehrlich zu sein, du sahst schon vorher ziemlich bescheiden aus.« Sie grinste. »Jetzt können wir’s ja sagen.«
Wir waren uns im Menschengewühl vor der Hochzeit der kuLau nur kurz begegnet. Es hatte kaum für ein »Hallo« gereicht, das wir uns in dem Geschiebe zuriefen.
»Ich war vorher schon sehr k.o.« Jennifer sah mich anklagend an. »Die Hochzeit war nur noch der berühmte Tropfen, der das Fass überlaufen ließ.«
»Diese Sache mit den Tloxi.« Jills Augen drohten wieder einmal aus den Höhlen zu quellen. »Wir haben es im Stabslog nachgelesen.«
»Ja, das war ziemlich heftig«, sagte ich.
Jennifer senkte einen Blick in mich, als wolle sie sagen »Wer war die Geisel, ich oder du?« Aber sie behielt es für sich. Sie hatte Jills Hände in die ihren genommen.
»Wie geht es euch?«, fragte sie leise.
»Ihr seid mit Rogers aneinander geraten«, sagte Taylor gleichzeitig zu mir.
Ich nickte nur. »Das meinte ich mit heftig. Er hat mit Annihilatoren auf uns geschossen. Die Details erzählen wir euch ein andermal. Hier haben die Wände Ohren.«
Jetzt riss Jill Lambert die wasserblauen Augen auf. »Annihilatoren? Ist der denn völlig meschugge?«
Dann fiel ihr ein, was ich gesagt hatte.
»Es ist ja alles gutgegangen«, brummte ich. »Mehr oder weniger.«
»Naja.« Jill ließ einen Blick über die bettlägerige Jennifer gehen. Dann besann sie sich. »Was uns angeht, so – wissen wir noch nicht so recht.«
Mit der freien Hand suchte sie Lucio, dessen Rechte sie verliebt drückte. Von ihrer sitzenden Position an Jennifers Bettrand sah sie mit warmem Lächeln zu ihm auf. So waren junge Paare, wenn sie einem mitteilten, dass sie sich verlobt hatten. Aber die beiden waren seit Jahren verheiratet, nach dem etwas speziellen Ritus der Amish, denen sie sich nach Sina angeschlossen hatten.
»Kriegt ihr ein Kind?«, entfuhr es mir.
»Das nun gerade nicht.« Jill bekam einen roten Kopf. Offenbar hatte ich ein heikles Thema angeschnitten.
Taylor räusperte sich.
Es entstand ein peinlicher Moment der Stille.
»Dass ihr jetzt hier seid«, versuchte Jennifer, die Situation zu retten, »auf dem Torus, heißt das, dass ihr euch wieder der Union anschließen wollt?«
Jill griff dankbar zu. »Um ehrlich zu sein, wir hängen noch etwas in der Luft.«
An der Art, wie sie beide herumdrucksten, war zu erkennen, dass sie sich mit einem bestimmten Plan trugen.
»Was habt ihr vor?«, fragte ich Taylor.
Er hob die muskulösen Schultern. Aus der linken drang dabei das leise Surren der Tloxi-Servos. Es erinnerte einen stets daran, dass er eine Prothese trug.
»Die Amish sind dabei, neue Gebiete zu erschließen«, sagte er.
»Nachdem sich die ganze Lage ja nun beruhigt hat«, fiel Lambert ein, »hat die Union uns ihre Karten zur Verfügung gestellt.«
Jennifer und ich sahen uns an. »Uns«, das waren offenbar die Amish. Also hatten sie nicht vor, in den regulären Dienst zurückzukehren.
»Es sind einige tausend Welten im Randgebiet der ehemaligen sinesischen Einflusszone, die jetzt in den Blick kommen. Die eine oder andere davon sieht ganz interessant aus.«
»Rohstoffwelten.« Ich hatte im Stabslog ein paar Notizen dazu aufgeschnappt. Nachdem sie sich mit den Tloxi zusammengerauft hatte, holte die Union zu einer weiteren, ungeheuren Expansion aus. Ihre automatischen Sonden durchkämmten die Galaxis. Prospektorenteams und militärische Vorauskommandos nahmen im Akkord neue Systeme in Besitz. Im Rückblick würde diese Zeit einmal als Goldene Ära erscheinen. Und die Amish in ihrem alten Selbstverständnis als Pioniere und Kolonisatoren bildeten die erste Welle dieser interstellaren Landnahme.
»Da draußen sind unzählige Planeten«, sagte Taylor, »die nur darauf warten, von uns in Besitz genommen zu werden.«
Der Junge gefiel mir. Seit wir ihn in Pensacola aufgelesen hatten, hatte er nichts von seiner Unternehmungslust verloren.
»Habt ihr schon etwas Bestimmtes in Aussicht?«, fragte Jennifer.
Jill wand sich. »Es sind tausende von Sonnensystemen. Derzeit laufen noch die Auswertungen.«
Jennifer legte den Kopf schief. Bei mir schrillten alle Alarmanlagen, dabei war es diesmal gar nicht ich, der im Fokus stand.
»Ihr tut so, als sei das alles noch nicht spruchreif«, lachte sie mit vorwurfsvollem Unterton. »Aber ich sehe euch beiden an der Nasenspitze an, dass ihr schon etwas ausheckt, etwas ganz Konkretes!«
Jill musste kichern, und auch in Taylors Miene stahl sich ein Schmunzeln.
»Dir kann man wirklich nichts vormachen«, sagte Lambert. »Aber du hast recht. Es gibt da eine Welt, die wir – in die engere Auswahl genommen haben.«
Jennifer lächelte zufrieden.
»Hat sie einen Namen?«, fragte ich.
»Hyperborea«, sagte Taylor.
Jennifer sah mich fragend an. Aber ich konnte nur die Achseln zucken.
»Kann sein, dass der Namen auf einer der Listen stand, die ich einmal herunter gescrollt habe. Aber ich verbinde im Moment nichts Bestimmtes damit.«
»Ein vielversprechender Planet«, sagte Taylor. »Vielleicht der lohnendste von allen, die jetzt zur Vergabe anstehen.«
Er klang wie ein Grundstücksmakler. Aber es war so: unsere Querelen mit Zthronmic und Tloxi hatten verstellt, was uns mit der Zerschlagung Sinas in den Schoss gefallen war. Eine ganze Galaxie! Unter dem Strich barg sie Milliarden Welten. Aber in der jetzigen Phase waren einige tausend zur Erschließung freigegeben worden. Die Werften stampften in Rekordzeit Großraumschiffe aus dem Boden. Millionen potentielle Siedler ließen sich erfassen und in Wartelisten eintragen. Jetzt erst konnte man davon reden, dass die Menschheit in den Weltraum aufbrach, nicht mehr nur einzelne Teams, die hier und da einen Asteroiden anschürften. Es war der Startschuss zu einer der gewaltigsten Bewegungen der menschlichen Geschichte, und während wir uns noch die Wunden leckten und uns nach Urlaub sehnten, standen Jill und Taylor in der ersten Reihe, um sich ihren Platz an der Sonne zu ergattern.
Ich spürte Jennifers Blick auf mir liegen.
»Tut es dir leid, dass du nicht dabei sein kannst?«
»Es ist nicht aller Tage Abend«, sagte ich ausweichend. Dann fiel mir noch etwas ein. »Auf Zthronmia wolltet ihr nicht bleiben?«
Jill war aufgestanden und hatte sich an Taylors Seite geschmiegt. Wie immer hielt sie sich an seine Rechte, so dass er den gesunden Arm um sie legen konnte.
»Dorthin hatte man uns nur gerufen«, sagte Lucio, »um unseren Freunden gegen die Zthronmic beizustehen.«
»Wie sieht es jetzt dort aus?«, fragte Jennifer.
Vor meinem inneren Auge brannten die Bilder dieser gottverlassenen Welt auf. Zinkoxidfarbene Ebenen, über denen schwarzen Rauchsäulen standen. Scyther durchschnitten die glühende Luft und belegten die Palisadenstädte mit Aerosolbomben.
»S’Deró ist wieder aufgebaut«, berichtete Taylor. »Die Toten sind begraben, die Minen werden wieder angefahren. Die Zthronmic stehen unter Kuratel. Sie mussten alle Waffen abgeben. Das Zthrontat wird von einem Konsortium verwaltet.« Er beschrieb eine Geste mit der Linken, dass man die Motoren darin surren hörte. »Keine Ahnung, wovon sie jetzt leben.«
»Die Union hat mehrere starke Garnisonen auf Zthronmia eingerichtet«, fuhr Jill fort.
Ich nickte. Die Orbitalstation war zerstört. Sie war, was die Präsenz anging, ohnehin nur wenig wert gewesen. Jetzt errichtete man Kasernen am Boden und stationierte einige tausend Soldaten dort. Und irgendwo in den zinnoberroten Staubwüsten dieses elenden Planeten ragte noch das ausgebrannte Skelett der ENTHYMESIS in den erbarmungslosen Himmel. Ich wischte die Bilder fort.
»Dorthin zieht es uns nicht zurück«, schloss Taylor.
»Das kann ich gut verstehen.« Auch ich war froh gewesen, als wir dieses mörderische Sandloch für immer verlassen hatten.
»Hyperborea«, nahm Jennifer den alten Faden wieder auf. Sie sah forschend von einem zum anderen. »Irgendwas ist da noch im Busch. Ihr sagt uns immer noch nicht die ganze Wahrheit!«
Die beiden schubsten sich gegenseitig an.
»Es ist ein bisschen schwierig«, brachte Taylor endlich hervor. »Der Planet ist noch nicht endgültig gesichert.«
»Was heißt gesichert«, fragte ich. »Ist er denn besiedelt?«
»Das weiß man eben noch nicht ganz genau.« Jill machte eine ihrer komisch sein sollenden Grimassen.
»Und was heißt das?«, hakte Jennifer ein.
»Ein Kommando der Union ist unterwegs, die Sache zu klären«, sagte Taylor. »Die Fernerkundungen durch Lambda-Sonden haben nur ergeben, dass es dort gewisse – Aktivitäten gibt.«
»Aktivitäten?«, entfuhr es Jennifer.
»Die Daten der Drohnen sind zu spärlich«, fuhr Taylor fort. »Man muss vor Ort nachsehen, was da wirklich ist.« Unsere skeptischen Mienen veranlassten ihn dazu, sich noch ein paar Sätze abzuringen. »Auf alle Fälle haben die Spektralanalysen und die Tiefraumscans ergeben, dass der Planet äußerst vielversprechend ist. Das Klima ist gemäßigt, die Atmosphäre atembar, wenn es auch kaum Wasser gibt. Und die Kruste scheint nur so von Rohstoffen zu strotzen.«
»Seltene Erden«, schwärmte Jill. »Edelmetalle, Aluminium, Titan, einfach alles.«
Ich fasste sie in den Blick.
»Zthrontat?«
»Vermutlich auch Zthrontat«, kam Taylor ihr zu Hilfe. »Wie viel, das kann man aufgrund der Fernerkundung natürlich noch nicht sagen.«
»Natürlich«, brummte ich.
»Wer ist mit der Erkundungsmission betraut«, fragte Jennifer.
Die beiden sahen sich an.
»Dr. Rogers«, sagte Taylor schließlich.
Daher also wehte der Wind.
»Er ist Planetologe und Militär!« Lucio hob die Stimme im Ton einer Rechtfertigung. Dabei hatte ich gar nichts gesagt. »Was immer sie dort antreffen, er wird der richtige Mann dafür sein.«
»Daran zweifelt niemand«, sagte Jennifer düster.
»Was erwartet man denn, dort anzutreffen?«, fragte ich.
»Das wissen wir, wenn sie dort sind«, versetzte Lambert bockig.
Taylor beeilte sich, sie aus der Schusslinie zu holen. »Rogers und sein Team sind gestern morgen aufgebrochen. Inzwischen dürften sie vor Ort sein. Es sind ja nur ein paar tausend Parsek.«
Ich dachte nach. Das erklärte immerhin, warum er auf meine Nachricht, Jennifers Genesung betreffend, nicht geantwortet hatte. Unser Verhältnis war zerrüttet, um es vorsichtig auszudrücken, aber eine kurze Botschaft hätte er doch geschickt, vielleicht sogar auf einen Händedruck vorbeigeschaut. So gut glaubte ich ihn zu kennen.
Nun war er also schon wieder unterwegs.
»Was für ein Team«?, fragte ich.
»Scouts«, sagte Taylor auffallend schnell. »Prospektoren, Planetologen, das übliche eben.«
Alle beide logen sie wie gedruckt. Nur schade, dass sie es nicht überzeugender taten.
»Kein Militär«?, fragte Jennifer scheinheilig.
»Er wird auch ein oder zwei Hundertschaften an Bord haben«, maulte Jill, die sich für die Unternehmung verantwortlich zu fühlen schien. Dabei war ihr und Taylor kein Vorwurf zu machen. Oder vielleicht doch? Das würde davon abhängen, was möglicherweise schon in dieser Stunde auf Hyperborea stattfand.
»Schon wieder Krieg?« Jennifer hatte den gleichen Gedankengang absolviert.
»Jetzt malt nicht gleich den Teufel an die Wand«, knurrte Taylor übellaunig. »Es ist doch ganz normal, dass man gewisse Vorkehrungen trifft, wenn man eine neue Welt in Besitz nimmt.«
»Wenn sie schon jemandem gehört, auf alle Fälle.« Jennifer hatte sich in ihren sensoriellen Kissen aufgerichtet und funkelte ihn drohend an.
Ich überlegte, die beiden fortzuschicken. Jennifer durfte sich auf keinen Fall aufregen. Allerdings war es, was das anging, sowieso schon zu spät.
»Vermutlich sind es vulkanische oder tektonische Aktivitäten«, erwiderte Lucio gereizt. »Oder irgendwelche Alien-Termiten!«
»Oder doch eine Zivilisation«, sagte Jennifer knapp. »Was würde man dann tun?«
»Das kommt darauf an, wie sie sich verhält«, sagte Taylor.
»Wenn sie sich zur Wehr setzt, wird sie natürlich ausradiert!« Jennifers Augen hatten einen fiebrigen Glanz angenommen.
»Das geht nun wirklich zu weit«, fauchte Jill. Sie ließ Jennifer für gewöhnlich alles durchgehen. Zu Enthymesis-Zeiten hatte sie sie regelrecht verehrt. Aber jetzt, da es ihre gemeinsame Zukunft mit dem hübschen Lucio betraf, verstand sie keinen Spaß mehr. »Wir warten ab, was Rogers findet, und dann wird zu entscheiden sein, wie man weiter vorgeht und ob die Welt überhaupt in Frage kommt. Natürlich wollen wir niemandem etwas wegnehmen, wenn dort schon eine intelligente Spezies leben sollte!«
»Ihr nicht«, sagte Jennifer kalt. »Aber ihr habt das auch nicht zu entscheiden.«
»So lange sitzen wir jedenfalls hier fest.« Taylor versuchte, in den freundschaftlichen Ton vom Beginn der Unterhaltung zurückzufinden. »Für die Mission sind vier Wochen angesetzt.«
»Und dann wird Rogers euch sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt.« Jennifer lächelte ihn böse an. »Falls dort noch ein Stein auf dem anderen steht!«
»War schön, dich wieder mal gesehen zu haben.« Jill beugte sich zu einem sterilen Wangenkuss über ihre ehemalige Kollegin. »Wie ich sehe, bist du schon wieder ganz die Alte.«
»Unkraut vergeht nicht«, knurrte Jennifer.
Ich brachte die beiden an die Tür.
»Haltet uns auf dem laufenden«, sagte Taylor im Vorraum, in dem auch schon Ang’Laq, der Repräsentant der kuLau, seine Aufwartung gemacht hatte.
»Ihr uns auch«, versetzte ich. »Diese Sache interessiert mich.«
»Ich kann verstehen, dass eure Beziehung zu Rogers ein bisschen – angespannt ist«, sagte er noch.
»Ich habe mich mit ihm wieder vertragen«, sagte ich. »Was Jennifer angeht, so ist sie empfindlich und überreizt. Wir werden jetzt erst einmal Urlaub einreichen und uns irgendwo erholen.« Ich versuchte, ein zuversichtliches Grinsen hervorzubringen. »Und dann wird man eben weitersehen.«
»Tut mit leid, dass sie sich so aufgeregt hat.« Auch Jill klang plötzlich kleinlaut.
»Es geht schon.«
Ich wartete, bis die beiden gegangen waren. Wie sie Hand in Hand zum Fahrstuhl schritten, eng beieinander wie ein jungverliebtes Paar, überlegte ich, ob sie uns nicht doch etwas ganz anderes verheimlicht hatten.
Ich ging ins Zimmer zurück, wo Schwester Olga um Jennifer bemüht war. Die Sensoren im Nachthemd der Patienten hatten eine Warnung abgesetzt. Jetzt lief ich in den tadelnden Blick der Matrone hinein.
»Ich habe doch gesagt, keine Aufregung!«
»Alte Freunde«, sagte ich. »Da weiß man nie, womit man konfrontiert wird.«
»Das ist nicht witzig, Commander.« Die Krankenschwester verstand keinen Spaß. »Ihre Frau braucht Ruhe!«
»Ist gut, ist gut.« Irgendwie schaffte ich es, sie hinaus zu komplimentieren.
Doch kaum hatte ich mich an den gravimetrischen Sessel fallen lassen und ihn an das Bett herangefahren, als eine Meldung einging.
»Wer ist es?« Jennifer hatte sich zurückgelehnt und die Augen geschlossen. Erschöpft döste sie im Halbschlaf vor sich hin.
»John«, sagte ich. Im selben Moment hätte ich mir am liebsten die Zunge abgebissen.
Natürlich war sie sofort hellwach.
»Was will er?«
»Nichts«, log ich unbeholfen. »Er lässt nur fragen, wie es dir geht.«
»Frank.« Es war nicht nötig, auch nur ein Wort mehr zu sagen.
»Jennifer«, startete ich einen zum Scheitern verurteilten Versuch. »Du hast gehört, was Schwester Olga gesagt hat!«
»Gib mir das Kom!«
»Du sollst jetzt schlafen.«
»Ich bin eine erwachsene Frau. Wenn du mir nicht dein Kom gibst oder ihn selber herbittest, werde ich aufstehen und ihn holen, und wenn ich in diesem albernen Kittel den ganzen Torus nach ihm absuchen muss!«
»Bitte, du sollst dich nicht aufregen.«
»Ich rege mich schon auf!«
Ich seufzte. Dann willigte ich ein, John zu uns kommen zu lassen. Er stand auch sofort da, offenbar hatte er nur darauf gewartet und sich bereit gehalten. In seinen Augen glitzerte die Begeisterung. Er hatte wieder einmal etwas herausgefunden!
Die Schwester brachte ihm und mir einen Kaffee. Sie erneuerte Jennifers Tee und zog sich dann zurück. Von mir aus hätte sie auch bleiben können. Es stand nicht zu befürchten, dass sie mit dem, was jetzt kommen würde, etwas anfangen konnte.
»Also, was hast du?«, fragte Jennifer, als wir unter uns waren. Auch jetzt hatte sie das Kopfende hochgeklappt und saß aufgerichtet da, den Becher in der Hand, der Blick neugierig und unternehmungslustig.
»Diese Hochzeit«, sagte John. »Es war ja klar, dass da etwas kommen würde. Ich hatte einiges im Stabslog darüber gelesen und war entsprechend vorbereitet.«
»So vorausschauend waren wir leider nicht«, erklärte ich.
»Außer dass ich zu Protokoll gegeben habe, dass ich da nicht hin will«, maulte Jennifer.
»Ich habe dir gesagt, warum es sein musste. Aus Rücksicht auf eben dieses Protokoll.«
»Ich wäre dort fast gestorben, Frank!«
»Ich weiß. Aber das konnte ja niemand ahnen.«
»Das nächste Mal, wenn ich sage, dass es mir nicht gut geht, nimmst du es bitte ernst.«
Ich schwieg. Jennifer starrte verbittert vor sich hin. Nach einer Weile machte ich John ein Zeichen, er möge in seinen Ausführungen fortfahren.
Er räusperte sich und kratzte sich am Bart.
»Ahm, jedenfalls. Ich war präpariert!« Er klopfte auf sein Handkom, das er an seiner Brusttasche befestigt hatte.
»Hast du etwas – registriert?«, fragte Jennifer.
»Sagen wir so«, sagte er selbstverliebt, »wenn ich nicht schon so intimen Umgang mit den Tloxi gehabt hätte, würde ich mit den Daten nichts anfangen können. Aber so ...«
»Mach es bitte nicht so spannend«, brummte ich.
»Es war ein Feld«, erklärte er schlicht.
»Ein Kontinuum?«, fragte Jennifer. »Wie bei den Tloxi.«
»Nein. Es ist wesentlich – subtiler.«
»Sie haben ein telepathisches Feld erzeugt?«, fragte ich ungläubig. »Wie kommt es, dass wir darauf reagiert haben? Mit den Tloxi können wir doch auch nicht kommunizieren.«
»Ich sage doch, es ist anders. Es ist filigraner, anschmiegsamer.« Er grinste. »Sozusagen vegetativer.«
»Verstehe.«
»Ich verstehe es nicht«, sagte Jennifer. »Wenn wir mit diesen Wesen nicht unmittelbar kommunizieren können, wie vermögen sie uns dann so zu – beeinflussen?!«
»Die Details muss ich erst noch herausfinden«, versetzte John. »Es war keine Kommunikation im strengen Sinn.«
»Sondern?«, fragte ich.
»Eher eine Anregung?«
»Sie haben uns angeregt?«
»Überleg doch mal, was du erlebt hast«, sagte er.
»Darüber will ich lieber nicht so viel nachdenken.«
»War es so – persönlich?« Er schmunzelte wissend.
Ich wollte schon aufbrausen und ihn fragen, was ihn das angehe. Aber Jennifers Blick hielt mich zurück.
»Nein wirklich, das wäre interessant!«
Ich berichtete in groben Zügen, was ich während der Darbietung empfunden hatte.
»Farben, Formen, Gerüche, Klänge. Es scheint, dass sie alle Sinne ansprechen.«
»Und sonst war da nichts?«, fragte John.
Ich wand mich.
»Vor uns braucht dir nichts peinlich sein.« Jennifer nippte an ihrem Tee und sah mich über den Rand des Bechers hinweg an. Vor achtundvierzig Stunden hatte ich ihr noch den Katheter gewechselt. Zwischen uns gab es nichts, weswegen man sich hätte genieren müssen.
»Wenn es wegen mir ist, kann ich auch so lange rausgehen«, sagte John.
»Nein, es ist ja gut.« Ich besann mich einen Moment. »Diese ganzen Erscheinungen gingen irgendwann in eine Vision über. Eine Halluzination. Ich war in Pensacola. Es war wieder der Abend, nachdem wir unseren Abschluss hatten. Ihr wart ja alle dabei. Die Bühne, die Musik. Wir haben getrunken ...«
»Irgendwann haben sich zwei von der Truppe entfernt.« John Reynolds kräuselte süffisant die Lippen.
»Hast du das gesehen?« Jennifers Blick wurde ganz warm.
»Ich habe es erlebt«, stammelte ich. Noch immer versetzte mich das ganze in Verlegenheit. Dann gab ich mir einen Ruck. »Ja, wir sind an den Strand hinuntergegangen. Wir sind im Meer geschwommen. Wir haben uns zum ersten Mal geküsst.« Ich sah die beiden an. »Aber es war keine Erinnerung. Ich war dort. Ich habe es noch einmal erlebt!«
John nickte. Offenbar hatte er nichts anderes erwartet, wobei ich mich fragte, woher er so intim über Jennifer und mich bescheid wusste.
Jennifer lächelte mich an. Ihre Hand suchte die meine und drückte sie.
»Offenbar«, sagte John Reynolds in seiner gedehnten Art. »Offenbar regt das Feld bei jedem ganz bestimmte Bereiche an. Jeder erlebt das, was für ihn das Wichtigste war. Das einschneidendste Erlebnis. Die Erfüllung. Das höchste Glück.« Er sah zwischen uns hin und her. »Das war für dich anscheinend jene Nacht von Pensacola, Frank.«
Ich hob die Schultern. »Kann schon sein«, brummte ich. Dann fiel mir etwas ein. »Bist du auch dort gewesen«, fragte ich Jennifer.
»Nein«, sagte sie nur.
»Wie kann das sein?« Ich starrte John fragend an.
Er schmunzelte wieder vor sich hin. »Offenbar ist diese Nacht für Jennifer nicht so erfüllend gewesen wie für dich!«
»Ist das so?«, fragte ich in ihre Richtung.
»Alles, was ich jetzt sage, wird sowieso gegen mich verwendet«, sagte sie trocken. »Im übrigen schaffe ich mir meine Halluzinationen nicht an.«
John hatte die Hand gehoben, um eine weitere Auseinandersetzung unter alten Eheleuten im Keim zu ersticken.
»Das Feld muss nicht zwangsläufig Glücksmomente freisetzen. Bei Jennifer war es das Trauma, das in ihr zum Ausbruch kam.«
Ich nickte. Eine solche Erklärung konnte Sinn ergeben.
»Also erlebt jeder, was das intensivste Geschehnis seines Lebens war, im guten wie im bösen?«
»Was die tiefsten seelischen Spuren hinterlassen hat«, sagte John. »Wie gesagt, meine Analysen sind noch nicht abgeschlossen. Um wissenschaftlich sauber vorzugehen, müsste man das ganze wiederholen und die Probanden dabei an ein EEG anschließen.«
»Wer würde so wahnsinnig sein, sich dem noch einmal auszusetzen?«
»Ganz abgesehen davon, dass die kuLau diese heilige Zeremonie, die bei ihnen im höchsten Ansehen steht, wohl kaum unter Laborbedingungen wiederholten würden. Zumal es so etwas wie eine Kopulation darstellt.«
Ich überlegte mir unwillkürlich, wie es wäre, vor einem Team von Wissenschaftlern Sex zu haben.
Laut sagte ich: »Dann sind wir auf die Daten angewiesen, die du auf gut Glück gesammelt hast?«
»Ja, und auf die Interviews.«
»Du hast Interviews geführt?« Jennifer war beeindruckt.
»Ich habe einige der Anwesenden im Nachhinein befragt«, sagte John. Wieder eroberte ein jungenhaftes Grinsen sein bärtiges Gesicht. »Die meisten haben sich ziemlich gewunden, so wie du Frank. Ich musste ihnen zusichern, dass ich mit den Protokollen vertraulich umgehe.«
»Also kannst du uns doch nichts sagen.« Jennifer wirkte enttäuscht.
»Etwas schon. Sinngemäß.« Er lachte. »So hat Laertes zum Beispiel philosophische Sätze und Axiome vor sich gesehen. Nicht die Wörter und Buchstaben, sondern die dahinter stehenden Erkenntnisse.«
»Nicht seine ...« Jennifer stockte. »Seine Jugendgeschichte? Ich hätte gedacht, das wäre sein einschneidendstes Erlebnis gewesen.«
Johns Blick hatte einen lauernden Ausdruck angenommen.
»Wir sind hier nur beim offiziellen Teil«, rief ich ihr ins Erinnerung. »Was er wirklich gesehen hat, was er davon John anvertraut hat und was der uns anvertraut, das steht auf einem völlig anderen Blatt.«
»So ist es«, sagte unser ehemaliger WO schlicht. »Aber ich kann das aus meinen eigenen Visionen ergänzen und bestätigen. Das ganze hatte mehrere Phasen. Es durchlief eine Steigerung. Da waren verschiedene Eskalationsstufen.«
»Das ist richtig«, sagte ich.
»Ich will euch nicht mit meinen intimen Gesichten langweilen« –
»Das fände ich gar nicht langweilig!«, platzte Jennifer dazwischen.
»... aber in einer dieser Phasen war es auch mir so, als sähe ich bestimmte mathematische Formeln. Ich sah nicht die Kürzel und Zeichen, wie man sie an eine Tafel schreiben kann, ich sah die Funktionen unmittelbar.« Er strich sich durch den Bart. »Besser kann ich es nicht erklären.«
Ich nickte zum Zeichen, dass er es damit gut sein lassen konnte. »Noch jemand?«
John musste wieder lachen. »Rogers hat Angriffsbefehle gegeben. Einmal habe ich es sogar selbst gehört, wie er durch den ganzen Tumult geschrien hat: Attacke! Wollt ihr denn ewig leben?!«
»Da ist eben er in seinem Element.« Ich konnte dazu nur die Achseln zucken. »Davon konnten wir uns ja nun alle ein Bild machen.«
Eine Weile schwiegen wir und dachten darüber nach.
»Das heißt«, begann Jennifer endlich, »die kuLau haben uns dahingehend manipuliert, dass jeder seine ureigensten Erlebnisse rekapituliert.«
John wiegte zustimmend den Kopf, sagte aber nichts.
»Aber woher können sie das wissen,« fragte ich. »Ich meine, woher wissen die kuLau, oder weiß das Feld, was in jedem vorgeht? Welche Leichen einer im Keller hat, oder welche heiligen Erinnerungen? Oder was seine kostbarsten Träume sind oder was auch immer?«
»Das Feld weiß gar nichts«, sagte John. »Es regt nur an.«
»Dann bringt jeder seine Visionen selbst hervor.«
»Es ist eine telepathische Induktion«, erklärte er. »Jeder wird in einen bestimmten Zustand versetzt, eine Art mentaler Schwingung. Aber es ist kein Übertragung. Für das, was er in diesem Zustand erlebt, ist jeder selbst verantwortlich.«
Ich kaute auf dieser Erkenntnis herum wie auf einem Steak, das zu lange in der Pfanne gewesen war.
»Bist du in der Lage, über Zthronmia zu reden?«, wandte sich John an Jennifer.
»Kommt darauf an.«
»Diese Box, in die du deine Hand stecken musstest.«
»Ja.«
»Auch sie hat Schmerz nur induziert. Nur natürlich in Anführungszeichen. Ist das richtig?«
»Ich habe keine physische Verletzung erlitten«, sagte Jennifer mechanisch. Es war ihr anzumerken, dass sie Auskunft gab, ohne die Erinnerungen selbst in sich Gestalt annehmen zu lassen. Es war eine Gratwanderung. Und das wenige Tage nach dem Kollaps. Sie war noch in der Rekonvaleszenz! Ich überlegte, ob ich John das Thema verbieten sollte.
»Es geht schon«, sagte Jennifer, als habe sie meine Gedanken mitgelesen. »Ich glaube ich weiß, was du meinst.«
»Es wurden Impulse in die Nerven induziert. Die Empfindung Schmerz hat dein Organismus selbst hervorgebracht. In letzter Instanz dein Gehirn.«
»Und das passiert bei den kuLau«, sagte ich, um Jennifer aus der Schusslinie zu holen. »Sie setzen uns einem Feld aus, in dem wir selbst anfangen zu halluzinieren?«
»Ich denke, dass es auf der rein physischen Ebene so abläuft, ja.«
»Aber das ist gefährlich«, rief ich in verspäteter Empörung. »Jennifer hätte es fast das Leben gekostet! Sie hätten uns vorher warnen müssen.«
»Offenbar war ihnen selbst das Risiko der Auswirkungen nicht bekannt. Vielleicht ist unsere Spezies in besonderer Weise empfänglich dafür.«
»Hast du auch G.R.O.M. interviewt«, fragte ich. »Oder Micromegas? Oder die Tloxi?«
»Noch nicht«, sagte er. »Aber ich gebe zu, dass das jeweils sehr interessant wäre.«
»Das kannst du ja noch nachholen.« Jennifer ließ sich in die Kissen zurückfallen.
»Ich denke, es ist gut für heute«, sagte ich rasch.
»Entschuldigt«, nickte John. »Ich wollte euch nicht strapazieren.« Er stand auf. »Allerdings werdet ihr zugeben, dass das ganze faszinierende Perspektiven ermöglicht.«
»Im Guten wie im Bösen«, murmelte Jennifer.
***
Die Sonne wurde mir zu stark. Ich drehte mich um und wies ihr den Rücken. Die Nordseite des kleinen Talkessels, in dem wir unser Lager aufgeschlagen hatten, wurde von einer mächtigen Felswand bestimmt. Zwei Wasserfälle sprühten davor herab. Am Fuß der Wand breitete sich ein flacher Hügel aus, sattgrün in der senkrechten Bewässerung. Darauf erhob sich ein kleines Tempelchen. Auf der anderen Seite kam der Fluss durch eine Bresche in den steilen Felsfluchten und beschrieb einen weitausholenden Mäander, der den ebenmäßigen, fast kreisrunden Talboden aufspannte. Eine Moräne, die unterhalb davon aus einem Seitental in die Schlucht vorgetrieben worden war, riegelte das Ensemble nach Süden ab. Eine Landschaft von vollkommenen Proportionen, wie geschaffen, um darin zu meditieren.
Die Einheimischen hatten den Platz Dal genannt, das hieß Jennifer zufolge so viel wie »heilige Stätte«.
Ich dachte an das Dorf, in dem wir noch ein paar Lebensmittel eingekauft und uns nach dem weiteren Weg erkundigt hatten. Auch dort hatte es nicht an Warnungen gefehlt, wie sie uns während des Anmarschs ständig entgegen geklungen waren. Wir hatten sie in den Wind geschlagen. Was sollte schon geschehen! Doch jetzt tönten sie grell vor meinen geistigen Ohren wider. Ich unterdrückte den Impuls, nach Jennifer zu rufen. Am Ende saß sie irgendwo hinter einem Felsblock und wartete genau darauf. Aber es fiel mir von Minute zu Minute schwerer, meine innere Unruhe zu bezähmen. Es war fast Mittag, die Sonne strebte dem höchsten Punkt ihrer spätsommerlichen Bahn zu. Die Firne der Berggiganten, die sich ringsum in den stahlblauen Himmel erhoben, brannten in schmerzhaftem Weiß. Aus dem Augenwinkel fing ich eine Bewegung auf. Ich fuhr herum und versuchte, den Eindruck zu fixieren. Dann sah ich es: viele tausend Meter über mir hatte sich an einem der Hängegletscher ein Eisbalkon gelöst und brandete als wolkenförmige Staublawine zu Tal. Es war zu weit entfernt, um mir gefährlich werden zu können. Der stumpfe Donner, den die Explosion auslöste, drang mit beeindruckender Verspätung an mein Ohr. Lange saß ich da und sah zu, wie die Kissen aus pulverisiertem Eis sich ausbreiteten, immer noch eine Steilwand und noch eine überfluteten und endlich hinter bewaldeten Vorbergen verschwanden. Eine glitzernde Staubfahne hing noch lange in der Luft und zeichnete die Strudel und Wirbel des Höhenwindes nach, der sich vor jenen Urgesteinsriesen staute und brach. Auch der mahlende Donner rollte noch lange in der engen Talschaft wider. Dann war es wieder ganz still.
Ich dachte an die Freunde. Wo mochten sie sein? Wir hatten uns in alle Winde zerstreut. Wir waren wie ein Kometenkern, der beim Durchgang durch den sonnennächsten Punkt zerbrochen war. Die Trümmer blieben zunächst beieinander. Sie formten eine Wolke, denn noch immer gehorchten sie den gleichen Kräften, folgten derselben Bahn. Doch nach und nach trieb es sie auseinander, die Drift begann sie zu zerstreuen. Die Wolke dehnte und zerdehnte sich. Einzelne Brocken blieben übrig, die weit voneinander durch die Leere zogen. Einst waren sie eins gewesen. Jetzt erinnerten nur noch die Parameter des Radars daran, dass sie einmal ein und demselben Impuls gefolgt waren.
Der Kontakt war abgebrochen. Jennifer legte Wert darauf, während der Wanderung und während unseres gesamten Aufenthaltes auf diesem Planeten offline zu sein. Ich war zwar glücklicher Besitzer einer Kommunikationsvorrichtung, aber wesentlich weiter brachte mich das auch nicht. Sowie wir in die tief eingesägte Schlucht des Masyan vorgedrungen waren, war der lokale Funkkontakt zum Raumhafen abgebrochen. Dort war das einzige Relais gewesen, dass uns mit dem Rest der Welt verband. Der Planet besaß kein Satellitennetz. Wir waren abgeschnitten.
Ab und zu drang eine komprimierte Nachricht durch, die irgendwie ihren Weg über Dutzende Verteilerstationen gefunden hatte und die sich erst einmal umständlich entpacken musste. So blieb ich einigermaßen auf dem laufenden. Jennifer trug demonstratives Desinteresse an diesen Meldungen zur Schau. Ich rief sie heimlich ab. Ohnehin wurden die Funksprüche immer spärlicher, im Stil lakonischer. Nach und nach meldeten sie sich alle ab. Sie zerstreuten sich über die Galaxis. Reynolds war der einzige, von dem noch halbwegs konsistente Bulletins eintrafen. Rogers, Jill und Taylor, Laertes – sie alle verschwanden in einem Raum des Schweigens, der tiefer und finsterer zu sein schien als selbst eine ganze Galaxie. Es war, als hätten sie aufgehört zu existieren. Mit unserem Entschluss, den Dienst bei der Union zu quittieren, waren wir unter einen Ereignishorizont hinabgetaucht, den nichts durchdringen konnte. Es wurde finster und ganz still.
***
Am nächsten Morgen holte ich Jennifer ab. Sie wurde entlassen, und zwar im doppelten Sinn. Zum einen aus der Krankenstation, wobei der behandelnde Arzt mir noch einmal einschärfte, sie sei alles andere als geheilt, zum anderen aus der Union, der sie dreißig ihrer Jahre als Pilotin und Wissenschaftsoffizierin gedient hatte. Ich hatte sie bis zuletzt angefleht, diesen Schritt zurückzustellen und die Wirkung des Urlaubs abzuwarten. Aber das wies sie scharf von sich. Ihre Entscheidung war gefallen. Sie wollte einen freien Horizont.
Natürlich war es schade. Die Union war ihr Leben gewesen. Sie war die beste Pilotin und eine der brillantesten Wissenschaftlerinnen gewesen, die diese große Institution je in ihren Reihen gehabt hatte. Aber jetzt war es zuende. Das musste man akzeptieren. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie ernst es ihr damit war, ihr Zusammenbruch auf der Hochzeit de kuLau hatte ihn erbracht.
Wir gingen auf unsere Kabine und richteten die Sachen, die ich für die Exkursion vorbereitet hatte.
»Tut es dir leid«, sagte sie, als wir mit allem fertig waren und ratlos auf unseren Betten saßen.
»Es ist nicht aller Tage Abend.« Was hätte ich sagen sollen? Die Freunde brachen zu neuen Horizonten auf. Die Union erlebte die spektakulärste Expansion ihrer wechselvollen Geschichte. Durch die Kooperation mit den Tloxi war das Wort »unmöglich« aus unserem Vokabular gestrichen worden. Aber da war nun einmal nichts zu machen. Wir hatten unseren Teil zu dieser Geschichte beigetragen. Jetzt waren wir Geschichte. Andere würden nach uns kommen und das große Werk in unserem Namen fortführen.
»Sei nicht traurig.« Ihre Hand suchte die meine und drückte sie. »Vielleicht gibt es auch ein Zurück, zumindest für dich!«
»Ich werde dich auf keinen Fall allein lassen!«
»Dann lass uns einfach abwarten, was die Zukunft bringt.«
Ich nickte. Trotz allem hatte ich einen Kloß im Hals. Wir hatten unser Leben daran gesetzt, ein Haus zu bauen, und nun, da es bezugsfertig war, packten wir unsere Koffer und gingen. Wohin?
»Ich kann das«, sagte sie, »was jetzt vor mir liegt, nur angehen, wenn ich freie Sicht habe. Wenn ich nicht auf den Kalender schauen muss. Vielleicht brauche ich tatsächlich nur drei Monate. Aber wenn ich weiß: In drei Monaten muss ich wieder zum Dienst erscheinen, geht es trotzdem nicht.« Sie sah mich schmerzlich an. »Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst.«
»Ich verstehe es ja«, brummte ich in mich hinein. »Aber hätte man sich nicht trotzdem die Option offen halten können, irgendwann zurückzukehren?!«
»Es gibt kein irgendwann. So etwas ginge nur auf Krankenschein, und dann müsste ich alle paar Wochen wieder vorsprechen und mich untersuchen lassen und um eine Verlängerung betteln.«
»Ist gut.«
»Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, Frank, oder mit falschem Stolz. Es geht ganz einfach nicht. Ich brauche einhundertprozentige Freiheit und die uneingeschränkte Konzentration auf meine Aufgabe. Es tut mir leid, dass ich dich da mit reinziehe, dass du zur Geisel meiner Traumata geworden bist. Aber so ist es nun einmal.«
»Ich bin keine Geisel«, sagte ich. »Ich gehe mit dir, wohin immer es nötig ist.«
Wir schwiegen. Dabei sahen wir auf unsere Hände, die friedlich ineinander lagen und sich mechanisch weiter streichelten, als hätten sie nichts mit uns zu tun.
»Dann lass uns gehen«, sagte Jennifer.
Wir standen auf und nahmen unser Gepäck. Zwei kleine Taschen. Das waren all unsere Habseligkeiten. Wir verließen das spartanische Zimmer, das sich in nichts von den Kabinen unterschied, die wir auf zahllosen Schiffen und Basen bewohnt hatten. Als die Tür hinter uns ins Schloss fiel, decodierte sie sich selbsttätig. Wir würden nicht wieder hineinkommen. Wir waren heimatlos, und unser materieller Besitz erschöpfte sich in dem, was wir in einer Reisetasche trugen. Wir hatten natürlich keine Geldsorgen, aber unsere Existenz im Dienste der Union hatte trotzdem etwas Klösterliches gehabt, wir waren Ordensbrüder und –schwestern gewesen, die Genügsamkeit und Gehorsam geschworen hatten. Die Gemeinschaft hatte uns ernährt, gekleidet und uns ein Lager für die Nacht gegeben. Wir hatten ihr dafür unser Leben geopfert. Jetzt waren wir entlassen.
In einer Ruhe und Selbstverständlichkeit, die mich selbst überraschte, nahm ich es zur Kenntnis. Seit unserer Jugend, seit dem Eintritt in die Akademie, waren wir nicht mehr frei gewesen.
Jetzt waren wir es.
Wir hatten noch eine Stunde. In der Lobby des Abflugterminals wartete Laertes. Er war der einzige, der hier bleiben würde, auf dem Torus. Sein Weg endete hier.
Wir setzten uns zu ihm. Die Ordonnanz brachte Jennifer eine Apfel-Kiwi-Milch und mir einen Scotch. Dann sahen wir uns an. Keiner wusste, was er sagen sollte. Der alte Philosoph lächelte in sich hinein und strich seinen weißen Bart. Seine blauen Augen funkelten listig, aber er schwieg beharrlich. Vielleicht war das in einer solchen Situation das weiseste.
Wenig später kamen auch Jill und Taylor. Die beiden waren aufgekratzt und aus dem Häuschen. Sie konnten kaum stillsitzen.
»Stellt euch vor«, sprudelte der menschliche Wasserfall namens Jill Lambert, »die Sache ist genehmigt!«
»War sie das nicht sowieso?« Ich versuchte mir, unser letztes Gespräch in Erinnerung zu rufen.
»Noch nicht ganz.« Auch Lucio war für seine Verhältnisse extrem zappelig. »Noch nicht offiziell.«
»Verstehe.«
»Und jetzt ist es durch?«, fragte Jennifer.
»Wir standen auf der Warteliste«, plapperte Jill. »Und heute Morgen kam das endgültige Okay über das Stabslog.«
»Hyperborea?« Ich wechselte einen Blick mit Laertes, der aufmerksam zuhörte, aber auch jetzt nichts sagte. Lambert quasselt für uns alle genug, schien er sich zu sagen.
»Ja.« Lucio strahlte. »Wir gehören zur ersten Welle, sowie der Planet für die Besiedelung freigegeben wird.«
»Das heißt, es klemmt noch.«
»Das haben wir ja gesagt.« Jill war beleidigt.
»Die Erkundungsmission.«
»Rogers hat vier Wochen veranschlagt«, nickte sie. »Aber so genau kann man das vorher natürlich nie wissen.«
»Dann habt ihr ja genügend Zeit zu packen.« Ich ließ einen ironischen Blick über unser bescheidenes Gepäck gehen.
Taylor lachte. »Viel mehr wird es bei uns auch nicht sein. Die Amish fühlen sich dem Gelübde der Besitzlosigkeit verpflichtet.«
»Und das schwere Gerät stellt die Union«, riet Jennifer.
»So ist es«, sagte Jill. »Von daher stimmt es auch nicht ganz, wenn man uns als erste Welle bezeichnet.«
»Die Appartements stehen vermutlich schon, wenn ihr ankommt.« Ich grinste. Irgendwie, dachte ich, würden mir die Frotzeleien mit der kleinen Lambert doch fehlen.
»Das nun gerade nicht. Aber es wird ein Bau- und Pioniertrupp vor uns da sein.«
»Appartements.« Ich zwinkerte Taylor zu. Ihre Aufbruchstimmung war ansteckend. Andererseits musste ich mir sagen, dass wir es waren, die in der Abflughalle saßen, während sie noch mindestens vier Wochen auf dem Torus herumhocken mussten.
Er hatte es geschafft, eine der Ordonnanzen herzuwedeln. Wenig später kam diese mit einer Flasche Champagner und fünf Kelchen. Taylor schenkte ein und reichte uns die Gläser.
»Das muss doch gefeiert werden!«
Wir stießen an und tranken.
»Wo ist John?«, fragte Lambert nach einer Weile.
»Bestimmt hat er wieder eine geniale Entdeckung gemacht«, meinte Taylor.
Jennifers Miene spiegelte Missbilligung, aber sie sagte nichts.
Dann trat einer dieser Momente ein, wo jeder da saß und seinen eigenen Gedanken nachhing.
»Sag doch auch mal was!« Jennifer stieß Laertes sanft in die Seite. Der Philosoph hatte seine Champagnerflöte abgestellt und die Fingerspitzen aneinander gelegt. Aus seinen hellen Augen musterte er uns aufmerksam.
»Ich freue mich, dass es euch so gut geht«, sagte er. »Ich hoffe, dass all eure Erwartungen sich erfüllen. Dass Jennifer Heilung und Frank Ruhe findet. Und dass ihr beiden eine neue Heimat findet, wo ihr euch ein neues friedliches Leben aufbauen könnt.«
»Amen!« Jill stieß ihr Glas in die Luft. Von den paar Tropfen Alkohol hatte sie roten Backen bekommen.
Laertes ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen.
»Ich wünsche euch, dass ihr alle glücklich werdet. Jeder auf seine Weise!«
»So wie du das sagst, macht es mir Gänsehaut.«
Jennifer setzte ihren Kelch behutsam auf das kleine Tischchen, das zwischen unseren Sesseln stand.
Der Alte lächelte auf seine melancholische Art, sagte aber nichts mehr. Sein Vorrat an Wörtern war für diesen Tag verbraucht.
Von Lambert konnte man das leider nicht behaupten.
»Ihr müsst uns unbedingt besuchen, wenn ihr mit eurer Sache fertig seid!«
Sie unterdrückte ein Rülpsen und legte schuldbewusst die Hand auf den Mund.
»Auf alle Fälle.« Jennifer legte den Kopf schief und betrachtete sie mit einem warmen Schmunzeln. Jedem anderen hätte sie die laxe Redewendung verboten, aber Jill genoss bei ihr Narrenfreiheit.
Wieder breitete sich ein beklommenes Schweigen aus. Wir sahen zu, wie die Planetenfähre draußen andockte und betankt wurde. Die ersten Passagiere erhoben sich und begannen vor der Schleuse eine Schlange zu bilden.
»Also dann.« Ich stemmte die Fäuste auf die Knie und drückte mich hoch.
Alle standen auf und wir umarmten einander noch einmal.
»Pass auf die Kleine auf«, sagte Laertes leise, als er mir die Hand drückte.
»Viel Glück dort draußen«, sagte ich zu Taylor, während wir uns an den Schultern fassten.
»Nicht heulen!« Jennifer schloss Lambert in die Arme und strich ihr das verstrubelte Haar.
Dann rissen wir uns los.
Die Freunde gingen hinter die Absperrung zurück. Die Ordonnanzen räumten die Gläser und Flaschen weg. Die Lobby leerte sich zusehends.
In diesem Moment kam John Reynolds in die Wartehalle gestürmt. Er schloss Jennifer in die Arme und reichte mir die Rechte zu einem harten Händedruck. Vorne zischte der Druckausgleich. Die Leute begannen mit der Kontrolle und dem Einsteigen.
Als wir uns losmachen wollten, hielt er uns zurück und senkte verschwörerisch die Stimme.
»Die Tloxi haben mir ein Angebot gemacht!«
»Glückwunsch«, sagte ich zerstreut. »Was heißt das konkret?«
»Sie haben mir eine weitreichende Zusammenarbeit in Aussicht gestellt.«
»Wow«, machte Jennifer.
Wir saßen beide auf Kohlen. Vorne gingen die ersten Passagiere durch die Schleuse. Es waren nur noch wenige Leute vor uns.
»Ja!« Er schwitzte vor Begeisterung.
»Darfst du?«, fragte ich. »Darfst du einen von ihnen autopsieren?«
Es war immer sein sehnlichster Wunsch gewesen, ein Tloxi-Gehirn sezieren zu dürfen. Den demolierten Gefangenen, den wir bei G.R.O.M. an Bord gehabt hatten, hatten wir ihnen wieder ausgehändigt. Das war die Bedingung dafür, dass wir Jennifer von dem Planeten abholen durften. Aber anscheinend hatte seine Weigerung, das Wesen auf eigene Faust und gegen ihren Willen zu untersuchen, bei ihnen einen positiven Eindruck hinterlassen.
»Sie haben es sehr vage formuliert«, erklärte er. »Aber offenbar habe ich ihr Vertrauen gewonnen.«
»Das hast du ganz bestimmt«, strahlte Jennifer. »Dein Verhalten war ja auch völlig untadelig.«
Seine Weigerung, die zu unserem Zerwürfnis mit Rogers geführt hatte, hatte ihr vermutlich das Leben gerettet. Aber nicht nur deshalb war sie so begeistert.
»Was immer es ist«, sagte ich. »Du kannst dabei sicherlich nur profitieren.«
Die Tloxi waren uns technisch in einem Maße überlegen, der jeden Kontakt und jede Zusammenarbeit mit ihnen zu einer Lehrstunde machte. Das galt in erhöhtem Maße für unseren ehemaligen WO, den genialsten Wissenschaftler, den die Union je hervorgebracht hatte.
»Auf alle Fälle.« Er sinnierte zufrieden vor sich hin.
»Wir müssen dann«, sagte ich.
Die letzten Reisenden vor uns waren bereits im Verbindungstunnel, der sie an Bord der Fähre brachte. Der Offizier, der das Einsteigen überwachte, sah geduldig, aber unmissverständlich zu uns her.
»Wir bleiben in Kontakt«, fiel mir noch ein. »Halte uns auf alle Fälle auf dem Laufenden!«
»Habt ihr ein Kom dabei?«, fragte er.
»Ja«, sagte ich, obwohl ich wusste, dass Jennifer während des Urlaubs offline bleiben wollte.
»Ich werde ab und zu Berichte ins Stabslog stellen«, versprach er.
Immer noch stand er da, die Hand auf meinem Arm. Wir kannten ihn lange genug, um zu wissen, dass er noch nicht fertig war.
»Die Sache hat einen kleinen Haken«, brachte er schließlich heraus.
»Was denn?« Jennifer nahm die Tasche, in dem sie ihre wenigen persönlichen Habseligkeiten transportierte. Ihr Blick nahm diese eindringliche Färbung an, die ich nur zu gut kannte.
Reynolds nickte zum Zeichen, dass er unsere Eile zur Kenntnis nahm.
»Sie wollen mich mit sich nehmen«, sagte er schnell. »Auf eine andere Station, die sie irgendwo weiter draußen unterhalten.«
»Das ist doch großartig«, sagte ich.
»Vermutlich wollen sie mich so unter Kontrolle haben«, meinte er.
»Auf alle Fälle wirst du faszinierende Einsichten bekommen.«
»Diese Station scheint sehr weit weg zu sein.«
»Im Zeitalter von Quantenboxen und oszillierendem Warp dürfte das keinen Unterschied machen.«
Der Offizier machte ein paar Schritte auf uns zu und wedelte mit der Zeitanzeige seines Handkoms.
»Es ist deine Entscheidung«, sagte ich, schon halb im Gehen. »Ich denke, es wird sich auf alle Fälle lohnen.«
»Ich werde es mir auch nicht entgehen lassen!« Wenn er grinste, sah er aus wie ein großer Junge. »Ich wollte euch nur bescheid sagen.«
»Danke, dass du persönlich vorbei gekommen bist.« Jennifer drückte ihm einen Kuss auf die bärtige Wange. »Hat diese Station einen Namen?«
»Ich wurde nicht ganz schlau daraus«, versetzte John Reynolds. »Da ist eine Tloxi-Hieroglyphe in den Protokollen, die ich nicht entziffern kann!«
»Du schaffst das schon!«
Wir gingen durch die Schranke.
Mit hässlichem Pfeifen schloss sich die Schleuse.
***
Die Planetenfähre war nicht allzu groß. Einhundert Passagiere. Der Aufenthaltsbereich sah aus wie eine Lounge in einem Club. Offiziere, Ingenieure und Geschäftsleute waren unsere Mitreisenden. Der Flug erfolgte bei oszillierendem Warp. Allerdings war es ein ziemlich altertümliches Aggregat, so dass die Reise mehrere Stunden dauerte. So etwas waren wir gar nicht mehr gewohnt! Wir genossen es allerdings in vollen Zügen. Hostessen gingen herum und brachten einem, was immer man wünschte. Es gab eine kleine Bar. Jennifer hatte ihren gravimetrischen Sessel ganz nach hinten gefahren und die Beine hochgelegt. Ich unterhielt mich mit einem Mann vom Stab, der zu den Besatzungstruppen nach Sin Pur kommandiert war. Später auch mit einem Spezialisten für Wasseraufbereitung, der die einschlägigen Anlagen in Pura City wieder in Betrieb nehmen sollte.
Als wir den Warp drosselten und das Doppelsystem anflogen, weckte ich Jennifer, die sich in ihrer Liege aufrichtete. Schweigend sahen wir aus dem Fenster, während die Fähre über der zerstörten Stadt in Sinkflug ging. Pura City war in seiner Entwicklung um Jahrzehnte zurückgeworfen. Die Innenstadt war völlig ausgebombt. Immerhin waren Pioniertrupps dabei, die schwersten Schäden zu beheben. Überall ragten gravimetrische Kräne in den Himmel. Ganze Viertel wurden niedergelegt und neu aus dem Boden gestampft. Die Infrastruktur würde nach der Instandsetzung in einem besseren Zustand sein als vor unserer Invasion. Materiell würde es den Leuten bald wieder mindestens so gut gehen wie vor dem Krieg. Wie man hörte, kam sogar der Tourismus langsam wieder in Gang. Wenn es auch vor allem Techniker und Geschäftemacher waren, die den Planeten anflogen.
Etwas anderes war der Hass, der der Union dort noch auf Generationen entgegenstehen würde. Wir bekamen einen Eindruck davon, als wir im Transitbereich des Raumhafens der Hauptstadt abgefertigt wurden. Er war die einzige Einrichtung dieser Art auf Sin Pur, wie Pura City die einzige größere Stadt der Wasserwelt war. Beizeiten würde man damit beginnen, ein Terminal im Orbit zu errichten. Aber dieser war noch immer voller Schrott und Trümmer, den Hinterlassenschaften der gewaltigen Schlacht, die dort getobt hatte. Es würde noch eine Weile dauern, bis man die Bahnen, die für eine solche Einrichtung in Frage kamen, so weit gesäubert hatte, dass man mit dem Bau beginnen konnte. Einstweilen mussten auch Transitpassagiere die Einrichtung am Boden anfliegen, um dort umzusteigen.
Der Laya, der unsere Papiere prüfte, war ein Beamter des alten Regimes. Er legte unsere IDs auf seinen Schirm und studierte die Daten, als müsse er eine Expertise darüber verfassen.
»Jennifer Ash und Frank Norton«, knurrte er. Sein Dialekt war fast nicht zu verstehen.
»So ist es«, sagte ich munter.
»Offiziere der Union?«
»Die ranghöchsten ihrer Art.«
Er grunzte etwas.
»Sie können sich ruhig erkundigen.« Ich nickte in Richtung der großen Fensterfront. Über das Flugfeld der provinziellen Anlage hinweg sah man die Hangars und Kasernen der Union. Rogers hatte eine starke Garnison errichtet.
Jennifer stieß mich hinter der Schranke an, aber der Laya ging mit keiner Regung darauf ein.
»Was wollen Sie hier?«, fragte er, als er unsere Viten ausgiebig studiert hatte.
»Gar nichts«, sagte ich freundlich. »Um ehrlich zu sein, wir wollen so schnell wie möglich wieder von hier weg.«
Jennifer trat mir auf den Fuß.
»Das wird auch das beste sein«, zischte der Beamte. »Auf Leute wie Sie haben wir hier gerade gewartet.«
»Alles, was es hier zu sehen gibt, haben wir bereits gesehen.«
»Sie waren schon einmal hier?«
»Vor vielen Jahren.« Ich blinzelte ihn an. »Wir haben unsere Flitterwochen hier verbracht.«
Jetzt wurde er doch neugierig. Er fing von vorne damit an, sich durch unsere Daten zu scrollen.
Jennifer stöhnte genervt.
»Und dann noch einmal vor nicht allzu langer Zeit. Aber davon wird nichts in den Papieren stehen.« Ich zwinkerte.
»Sie waren bei dem verbrecherischen Kommando, das uns besetzt hat!«
»Sagen wir so: wir haben uns damals über die Einreisebestimmungen hinweggesetzt.«
»Das war ein völkerrechtswidriger Akt«, knirschte er mit tödlicher Verachtung in der Stimme.
»Es dauert einfach alles zu lange hier«, sagte ich noch.
Er spuckte aus und zog unsere ID aus seinem vorsintflutlichen Lesegerät.
»Dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten.« Er drückte uns die Chips in die Hand. »Wo soll es hingehen?«, fragte er mit ätzender Freundlichkeit.
»Das können Sie unseren Papieren entnehmen«, antwortete ich.
»Es ist gefährlich.« Er bohrte seinen gelben Blick in mich.
»Nichts, womit wir nicht fertig werden würden.«
»Ihr denkt, Ihr habt uns unter Kontrolle. Aber das habt Ihr nicht. Ebenso wenig wie diese Welt.«
»Wir wollen uns einfach nur ein bisschen erholen. Die letzten Wochen waren sehr anstrengend, wissen Sie!«
»Fahrt zur Hölle!«
»Ich hoffe doch, so schlimm wird es nicht werden.«
»Hat das sein müssen«, zischte Jennifer, als wir in die Wartehalle gingen.
»Mir hat es Spaß gemacht.«
»Ich wollte mich hier eigentlich entspannen.«
»Ich bin total relaxed.«
»Frank Norton, du bist ein Idiot.«
»Jennifer Ash, du bist die hinreißendste Frau, die mir je begegnet ist.«
Sie schüttelte den Kopf und ging an die Theke des kleinen Bistros, um sich einen Tee zu holen. Dann saßen wir in der Halle und warteten auf den Weiterflug. Es war ein gemächliches Reisen, wie zu Zeiten der ersten Passagierflüge. Aber wir genossen es. Man hatte so viel Zeit!
Schließlich wurden wir aufgerufen. Ein kleiner Pendler mit acht Sitzplätzen brachte uns in einer guten Stunde bei konventionellem Antrieb zu Sin Purs Zwillingsplaneten. Auch dort gab es nur einen einzigen Raumhafen. Wir kannten ihn von früher. Er war noch winziger und provinzieller als sein Pendant in Pura City. Immerhin schlug uns hier nicht die gereizte Feindseligkeit der Laya entgegen.
Musan war die Welt der Prana Bindu. Man kannte diese Leute nicht anders als heiter und lachend. Dabei war ihr Leben vermutlich das entbehrungsreichste, das heutzutage noch im Einflussbereich der Union möglich war. Musan war ein Gebirgsplanet. Es gab kaum ebene Flächen. Die landwirtschaftlich nutzbaren Gebiete waren verschwindend gering, bezogen auf die Welt als ganze. Industrie gab es nicht. Früher hatte Musan von den Pilgern gelebt, die anlässlich der verschiedenen Feste des Ordens zu den Bergklöstern kamen. Durch die Besatzung war das Aufkommen an Reisenden völlig zusammengebrochen. Sin Pur hatte die Nachbarwelt in einem kurzen Feldzug ohne nennenswerte Gegenwehr oder Verluste erobert. Dann war die Union gelandet und hatte die Laya wieder hinausgeworfen. Jetzt ruhten alle Hoffnungen auf dem Wiederaufleben der Pilgerströme. Aber der lokale Winter stand vor der Tür. Eine Saison hatte man in jedem Fall verloren. Die Einnahmen eines Jahres. Das war für eine bettelarme Gesellschaft schlimm genug.
Auch hier lag eine Einheit von einigen tausend Mann unweit des Raumhafens in Garnison. Die Union zeigte Präsenz. Für die Bewohner der nahe gelegenen Stadt Feba City mochte das sogar gut sein. Die Truppe brachte Geld ins Land. So kam man über die kalte Jahreszeit. Und im Frühjahr würde sich die Lage hoffentlich normalisiert haben.
Wir hatten Wert darauf gelegt, dass kein großer Bahnhof stattfand. Die lokale Kaserne schickte einen jungen Stabsoffizier, der uns gelangweilt in Empfang nahm. Er geleitete uns durch die Kontrollen und brachte uns nach draußen. Dort reichte er uns an einen einheimischen Zivilangestellten weiter. Es war ein junger Bursche von achtzehn oder neunzehn Jahren. Sein Name war Tashi. Er steuerte einen viersitzigen Scooter, in dem wir mit unserem bescheidenen Gepäck bequem Platz fanden. Dann brausten wir auch schon nach Norden.
»Ich weiß nicht, was Sie vorhaben«, rief er, als wir die letzten Einrichtungen des Raumhafens hinter uns gelassen hatten. »Aber Sie müssen auf alle Fälle vorsichtig sein.«
Es war ein diesiger Tag. Der Himmel war grau und verhangen. Von den mächtigen Bergen, für die Musan berühmt war, war nichts zu erkennen.
»Wir wollen nur ein bisschen wandern«, sagte ich nach vorne.
Eine mittelalterliche Kraftfeldkuppel hielt den Fahrtwind ab. Dafür knatterte der Feldgenerator ohrenbetäubend.
»Nach ...«
Jennifer verpasste mir einen Boxhieb. Ich biss mir auf die Zunge.
»Wir waren schon öfter hier«, sagte ich ausweichend. »Wir kennen uns hier aus.«
Ich sah keinen Grund, weshalb ich dem Jungen nicht trauen sollte. Aber es waren schwierige Zeiten. Manch einer verkaufte seine Seele, um seiner Familie zu einem warmen Abendessen zu verhelfen.
»Seien Sie vorsichtig«, wiederholte er. »Die Union hat nicht alle Laya vertrieben!«
»Was heißt das?«
»Einige der Besatzungssoldaten, die Sin Pur auf unsere Welt gebracht hat, haben sich in die Berge geschlagen, ehe Ihre Leute kamen.«
Er nahm den Blick für einen Moment von der unbefestigten Piste, auf der wir mit viel Getöse und unter Aufwirbelung enormer Staubmassen dahinrumpelten, und sah über die Schulter.
»Diese Leute haben ihre Computer zerstört, damit niemand mehr die Daten abgleichen kann, und ihre Uniformen ausgezogen. Aber sie sind noch da.«
»Wie viele können das sein?«, dachte ich laut nach. Die ganze Besatzungsmacht hatte ja höchstens einige hundert Mann betragen.
»Wenn es fünf sind, ist es vielleicht schon genug.« Er senkte einen drohenden Blick in mich und widmete sich dann wieder der Schotterpiste.
»Wollen Sie mir Angst machen?«
»Ich glaube, dazu bin ich nicht der Mann.« Er lachte das helle kindliche Lachen, für das die Menschen dieser friedlichen Welt berühmt waren.
»Es ist ein ganzer Planet«, sagte ich noch. »Wir entfernen uns nicht weiter als ein paar Tagesmärsche von der Stadt.«
»Mögen die Götter Sie beschützen!«
Wenig später erreichten wir den letzten kleinen Ort am Rand der Ebene. Es war wirklich schade, dass der Dunst vor den Bergen hing. Wir hatten sie nur während des Landeanfluges kurz gesehen. Dann war die Fähre in die Glocke aus Smog und Nebel eingetaucht, die über dem Talkessel hing. Die Stadt und der nahe gelegene Feba See erzeugten einen eigentümlichen Qualm aus Ruß und Feuchtigkeit, der den Himmel beschlug wie warmer Atem eine kalte Glasscheibe. Am nächsten Morgen würden wir das Panorama umso prachtvoller erleben!
Wir verabschiedeten uns von dem Fahrer, der knatternd zur Kaserne zurück raste. Dann standen wir in dem sich langsam absetzenden Staub. Ich begann mich nach einer Dusche zu sehnen. Dabei hatten wir die Wanderung noch gar nicht angetreten. Es lohnte auch nicht mehr, an diesem Tag noch etwas zu unternehmen. In dem Dorf, in dem Tashi uns abgesetzt hatte, gab es eine kleine Pension, ein Rasthaus für Pilger. Es wurde von Ran Darjen betrieben, einem ehemaligen einfachen Lama der Prana Bindu. Er war aus dem Orden ausgeschieden und hatte stattdessen dieses Gasthaus an einer der wichtigsten Pilgerrouten aufgemacht.
Wir ließen uns ein Zimmer geben. Im Speiseraum waren wir die einzigen Gäste. Es war gemütlich. Alles war mit Teppichen aus dicker Naturwolle ausgelegt. Die Tische und Stühle bestanden aus echtem Holz, das mit Schnitzereien verziert war. Als das letzte Tageslicht vor den Fenstern verschwunden war, entzündete Ran ein Feuer aus getrockneten Torfsoden und Dung. Er bewirtete uns zuvorkommend mit Suppe, Reis und Gemüse. Dazu gab es ein dünnes heimisches Bier, das ebenfalls aus Reis gebraut wurde. Und allmählich fingen wir an, es zu glauben.
Wir hatten Urlaub!
Als ich aufwachte, war der Platz neben mir leer. Ich streckte mich und sah mich um. Das Zimmer enthielt nur zwei Betten und eine Kommode. Die Vorhänge waren zugezogen. Ich erinnerte mich dunkel, in der Nacht noch an den widerspenstigen Kordeln genestelt zu haben. Aber draußen schien es schon hell zu sein. Der karierte Stoff teilte dem Licht eine rötliche Farbe mit.
Ich stand auf und zog mich an. Jennifers Bett war leer, aber ungemacht. Sie musste sich, wie es ihre Art war, in aller Frühe aus dem Raum gestohlen haben.
Ich ging aus dem Zimmer. Im Treppenhaus war es kühl und roch nach Kalk. Bis zu unserer Etage bestanden die Treppenstufen aus kaltem, abgewetzten Stein. Eine hölzerne Stiege führte weiter hinauf. Einer spontanen Eingebung folgend, ging ich nicht nach unten, Richtung Gastraum, sondern nach oben. Es folgte noch eine Etage, dann noch eine, dann eine noch schmalere Treppe, schon mehr eine Leiter. Sie endete vor einer waagerechten Klappe, die in die Decke eingelassen war. Ich öffnete sie, zwängte mich hindurch und stand im Freien.
Mein Instinkt hatte nicht getrogen. Jennifer saß in Meditationshaltung auf dem flachen Dach. Ein wenig Feuerholz, das hier zum Trocknen gestapelt war, bildete eine Art Geländer; auf einer Seite bestand es auch aus säuberlich aufgeschichteten Dungfladen.
»Störe ich dich?«
Ich schloss behutsam die Klappe hinter mir. Jennifer hatte die Augen geöffnet. Ich sah an ihrem Blick, dass sie die Trance abgeschüttelt hatte.
»Gar nicht.«
Sie schaute mich lauernd an. Die Sonne kam eben im Osten durch den Morgendunst und beschien ihr hageres Gesicht.
»Was?«, fragte ich.
»Nichts.« Sie schmunzelte in sich hinein.
Ich spürte, dass da etwas hinter mir war. Langsam drehte ich mich um. Dann war mir, als habe jemand auf einen Knopf gedrückt und die künstliche Schwerkraft abgestellt. Ich fiel. Ich schwebte!
Vor uns stand die Hauptkette des Ilaya-Gebirges in ihrer ganzen Pracht, von der Morgensonne in safranfarbenes Licht getaucht.
»Wow!«
»Guten Morgen!«
Jennifer stand auf und kam an meine Seite. Arm in Arm nahmen wir das Panorama in uns auf. Felswände, Bergfluchten, Eismassen türmten sich viele Kilometer hoch vor uns auf und reichten von Westen nach Osten einmal quer über den Horizont. Die Kette zog sich einmal rund um den Planeten herum, aber was vor uns stand, war der zentrale Teil in einer Breite von zweihundert Kilometern.
»Hier wuchs ein Gebirge aus der Erde«, sagte Jennifer.
Ich nickte. Wussten wir noch, was das war? Wir hatten Planeten, Sonnen, ganze Galaxien aus dem Raum gesehen, aber wann zuletzt ein Gebirge so wahrgenommen?
»Gewaltig.«
Der Wind frischte auf. Wir fröstelten, obwohl die Sonne rasch höher stieg. Aber wir konnten uns nicht von dem mächtigen Anblick losreißen.
»Hast du keinen Hunger?«, fragte Jennifer irgendwann.
»Und wie!«
»Dann lass uns runter gehen!«
Aber wir standen immer noch da und schauten und schauten.
Sowie die Sonne sich durch die Morgennebel gekämpft hatte, begannen sich Wolken um die höchsten Gipfel zu bilden, und schnell entzogen sie sich unseren Blicken. Das machte uns den Abschied leichter. Wir kletterten ins Treppenhaus zurück und gingen frühstücken.
»Wie hast du geschlafen?« Jennifer schlürfte den dünnen Kaffee, den Ran Darjen gekocht hatte, und bestrich eines der omelette-artigen Fladenbrote mit gelber Butter.
»Wie ein Bär. Und du?«
»So gut wie lange nicht mehr!«
Sie zwinkerte mir gutgelaunt zu. Dann biss sie in den Teigfladen, dass die dicke geschmolzene Butter über ihr Handgelenk lief.
»Hoppla!«
Sie leckte sich die Finger.
»Hier kann man es aushalten, was?« Ich probierte den heimischen Tee, der in einem ganz ordentlichen Ruf stand und der auch wirklich genießbar war.
Wir waren auch jetzt die einzigen Gäste in der kleinen Stube. Zwar hatten auch andere Leute in Rans Rasthaus übernachtet, einheimische Pilger hauptsächlich. Aber sie waren längst unterwegs, da sie vor dem Morgengrauen aufbrachen und traditionell das Frühstück verschmähten.
Ich sah mich in dem Raum mit seiner niedrigen Balkendecke und seinen abgewetzten Teppichen um. Alles trug die Zeichen des höchsten Alters. Wie lange mochte diese Welt von Menschen besiedelt sein? Das Doppelsystem von Sin Pur und Musan war von der ersten Welle von Sprungschiffen kolonisiert worden. Seitdem waren hier einige Jahrhunderte vergangen.
Zur seltsamen Tragik der Goldenen Generation um Rogers und Laertes gehörte es ja, dass die erste MARQUIS DE LAPLACE sich immer noch bei Unterlichtgeschwindigkeit von ihrem Jungfernflug zurückkämpfte, während längst bessere Aggregate entwickelt worden waren, die ein Vielfaches der Reichweite hatten. Laertes war einer der letzten lebenden Veteranen jener Pioniertat. Die alte MARQUIS DE LAPLACE war das erste und einzige Schiff, das je mit Unterlichtantrieb zu einem anderen Stern aufgebrochen war. Immer wenn es wieder zurück kam, war es trotz der Updates ein Oldtimer, der der neuen Generation von Prospektoren und Admiralen vorsintflutlich erschien. Mit der Verbesserung der Sprungtechnik verringerte sich auch der Dilatationseffekt. Trotzdem umspannte Laertes’ Leben ein halbes Jahrtausend irdischer Zeit, und er war nach jeder Reise von der Entwicklung überrollt worden. Er und Rogers waren lebende Fossilien aus einem unbegreiflich fernen Äon. Und so entstand das Paradox, dass wir die Helden des interstellaren Aufbruchs noch persönlich kannten, die jetzt in ihren Siebzigern standen, während wir auf Welten wandelten, die vor drei oder vier Jahrhunderten von der menschlichen Rasse in Besitz genommen worden waren.
Nach dem Frühstück unternahmen wir einen kleinen Gang durch das Dorf, wenn man die lockere Zusammenballung einer Handvoll halbverfallener Gehöfte so nennen wollte. Es war ein Weiler, der nur deshalb zu einer gewissen Bedeutung gekommen war, weil er einen der Ausgangspunkte der klassischen Pilgerrouten darstellte. Hier heuerten die Pilger Führer, Träger oder Lasttiere an. Hier versorgten sie sich mit Lebensmitteln und festem Schuhwerk. Es gab eine Art Hauptplatz, eine natürliche Halle unter einem breitschattenden Bodhibaum, wo ein paar Männer herumlungerten und ihre Dienste anboten. Es gab auch einen Verkaufstand, wo die Pilger und die Einheimischen sich mit Obst, Gemüse, Reis und Gerstenmehl versorgen konnten. Wir verschafften uns einen Überblick über das Angebot an Waren und Dienstleistungen, kamen aber noch nicht zu einem Abschluss. Wir mussten uns erst darüber klar werden, was wir nun hier anfangen wollten. Das eine aber wussten wir: Wir wollten allein bleiben. Den ortskundigen Guides, die sich uns unterwürfig präsentierten, mussten wir daher eine Absage nach der anderen verpassen, obwohl sie uns in den schaurigsten Tönen die immergleiche Mär von den versprengten Laya-Soldaten erzählten, die angeblich noch das Hinterland unsicher machten. Nachdem wir zum zehnten Mal auf unsere Offizierspistolen gedeutet hatten, änderten sie ihre Strategie und berichteten mit aufgerissenen Augen und verzerrten Mündern von wilden Tieren, giftigen Pflanzen, Lawinen, Erdrutschen und anderen Gefahren, die das Gebirge für uns bereithalte. Irgendwann wurde es uns zu dumm. Wir kehrten zu unserer Unterkunft zurück.
Wir blieben mehrere Tage in dem beschaulichen Weiler. Allmählich begannen wir uns in der bescheidenen, aber liebenswürdigen Pension einzuleben. Wir mussten unsere Körper an diese Welt akklimatisieren. Die Schwerkraft war geringer, die Luft wesentlich dünner als der Standard, den wir gewohnt waren. Und auch unsere Seelen bedurften einiger Zeit der Anpassung. Wie es war, in einem Bett zu schlafen! Unter normalen atmosphärischen Bedingungen zu leben. Keine Entscheidungen treffen zu müssen und nicht permanent in Lebensgefahr zu sein! Mit Beginn der zweiten Woche stellte ich eine tiefe Entspannung bei mir fest.
Auch mit Jennifer ging eine Wandlung vor. Sie wurde ruhiger. Sie konnte eine Viertelstunde lang da sitzen, ohne mit dem Fuß zu wippen und Pläne zu schmieden, einfach nur so.
»Was denkst du?«, fragte ich dann manchmal
»Es ist seltsam«, sagte sie, ohne mich anzusehen, »aber ich will mit dir zusammen sein.«
»Ich bin da.«
»Wir waren so lange getrennt.«
»Spielst du auf alte Geschichten an?«
»Nicht, was du meinst. Ich habe einfach nur Sehnsucht nach dir.«
»Ich bin da«, wiederholte ich.
»Lass uns nach vorne schauen, lass uns den Augenblick leben, lass uns diese paar Jahre genießen, die uns vielleicht noch bleiben.«
»So kenne ich dich gar nicht.«
»Du weißt, worum es geht.«
»Ich weiß es.«
»Es ist keine Sache der Zeit, nichts von Tagen oder Wochen oder Monaten.«
»Du hast alle Zeit der Welt.«
»Kommst du mit mir?«
»Wohin du willst. Aber ich glaube, ich weiß schon, wohin es dich zieht.«
»Ich würde gerne eine Pilgerfahrt unternehmen.«
»Du hast die Warnungen gehört!«
»Es ist eine ganze Welt, und ich kenne die Seitentäler und Klöster.«
»Wie du meinst. Du willst nach Loma Ntang?«
»Auch. Aber ich will zu Fuß dorthin gehen.«
»Durch diese schreckliche Schlucht?«
»Nicht durchs Kali Gan. Es gibt auch andere Wege, längere, aber sanftere Wege, einsame Täler, abgelegene Dörfer, menschenleere Landschaften.«
»Klingt verlockend.« Ich dachte an die kilometerhohe Mauer aus Fels und Eis, die scheinbar unüberwindlich hinter dem Dorf aufragte. Aber ich wusste, dass es Schleichwege gab, uralte heilige und geheime Pfade. Das gewundene, tief eingesägte Tal des Masyan! »Was immer du willst!«
»Halt mich fest, Frank!«
Sie wurde immer weicher. Etwas in ihr war zerbrochen. Ich ertappte sie dabei, wie sie leer vor sich hinstarrte. Die Geiselhaft bei den Zthronmic hatte etwas in ihr angerichtet, dem sie sich bis jetzt nicht hatte stellen können. Die unsichtbare innere Wunde zehrte und fraß an ihr, sie vergiftete ihre Seele, wenn sie sie nicht dem hellen Licht ihres Bewusstseins aussetzte und ein für allemal verödete. Aber es hatte keine Gelegenheit dazu gegeben. Keine vierundzwanzig Stunden nach ihrer Rettung hatten wir die nächste Schlacht schlagen müssen. Die Zthronmic mussten besiegt werden. Die Laya hatten sich erhoben. Die Tloxi hatten gemeutert. Jetzt, endlich, so schien es, jetzt war die Zeit gekommen, dem Schrecklichen, das noch immer in ihr war, die Stirn zu bieten, ihm ins Angesicht zu schauen, und ich wusste, dass sie diesen Gang nur wagen würde, wenn ich ihr dabei zur Seite stand.
Also nach Loma Ntang.