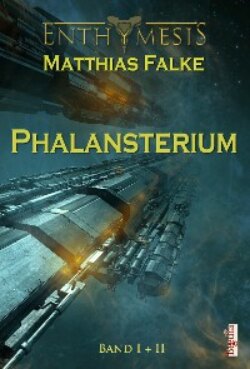Читать книгу Phalansterium - Matthias Falke - Страница 5
Kapitel 2: Aufbruch nach Loma Ntang
ОглавлениеUnd eines Morgens brachen wir tatsächlich auf. Wir hatten uns auf dem kleinen Markt mit Vorräten versehen. Und mit Bargeld! In den Tornistern trugen wir das Zelt und die Schlafsäcke, sowie ein paar Kilo Kartoffeln, Zwiebeln und Mehl, Reis, Nudeln und Gewürze. Auch unterwegs, so hatte man uns versichert, würden wir uns mit Lebensmitteln versorgen können. Es war das Ende des Sommers, überall wurden die Felder abgeerntet. Das Wetter war stabil. Einer langen Wanderung auf die andere Seite des Ilaya und das lange Tal des Masyan hinauf zum uralten Hauptkloster des Prana-Bindu-Ordens stand nichts im Wege. Trotz flehender Appelle der Einheimischen, die einen einträglichen Job suchten, gingen wir ohne Führer. Wir wollten für uns sein. Die hysterisch ausgeschmückten Warnungen schlugen wir in den Wind.
Ich dachte darüber nach, ob das nicht doch vielleicht zu leichtsinnig gewesen sein mochte, als Jennifer stehen blieb. Wir überquerten gerade eine kleine Brücke. Unter uns rauschte der Masyan, der hier aus dem Gebirge hervortrat und in die Ebene von Feba einbog. Es war ein stattlicher Wildfluss. Er hatte schon einiges hinter sich, wenn er hier um die Biegung kam. Ihn ohne Brücke oder technische Hilfsmittel zu überwinden wäre unmöglich. Wir standen an dem wackligen Geländer aus notdürftig ineinander verflochtenen Bambusstangen und sahen in die lehmgrauen Fluten, in denen man das Knacken und Krachen mitgewälzter Felsblöcke hörte. Wer dort hineinfiel, würde in Augenblicken zu Hackfleisch zermahlen.
Jennifer zog etwas aus der Tasche und ließ es in die brodelnden Wassermassen fallen. Ich brauchte einen Moment, bis ich begriff, dass es ihr HandKom gewesen war.
Ich unterdrückte den Schrei so schnell, wie er sich aus mir losringen wollte. Dennoch entging ihr nicht das verständnislose Grunzen, das ich ausstieß. Sie lächelte milde.
»Hätte es nicht gereicht, das Ding auszuschalten?«, fragte ich.
»Das ist nicht dasselbe!«
»Nein, ist es nicht!« Ich starrte fassungslos in das Mahlwerk aus tosendem Wasser und kollernden Steinen.
»Wir haben ja noch deinen«, sagte sie.
»Willst du ihn auch wegschmeißen?«
»Von mir aus!« Sie lächelte mir in ihrer aufreizenden Art zu.
»Das lass gefälligst bleiben!«
»Fühlt es sich nicht viel besser an so?«
»Solange nichts passiert.«
»Was soll denn passieren?«
Noch immer hätte man meinen können, sie provoziere nur, aber ihre Tat sprach für sich.
»Meiner hat keine Qbox«, sagte ich. Nur ihr Gerät war von Reynolds auf Quantenkommunikation aufgerüstet worden. Das meine musste mit konventioneller Technik auskommen. Unter den hier waltenden Bedingungen – keine Satelliten, kein weltumspannendes Netz – konnte ein Funkspruch ins nächste Dorf zu einer technischen Herausforderung werden.
»Bis vor ein paar Jahren hatte das niemand.«
»Das waren andere Zeiten!«
»Als wir damals nach Loma Ntang gegangen sind, hatten wir auch keine Koms dabei.«
»Das war vor dem Krieg«, sagte ich.
»Und jetzt ist nach dem Krieg.« Sie zuckte mit den Achseln, stieß sich von dem wenig vertrauenerweckenden Geländer ab, das ein unangenehmes Quietschen hören ließ, und ging weiter. Ich folgte ihr seufzend. Vermutlich hatte sie recht. Es gab nichts zu befürchten. Die Leute hatten uns nur verrückt gemacht, weil sie ihre Dienste anpreisen wollten. Versuchten wir, das Hier und Jetzt zu leben!
Aber dann prüfte ich doch den Ladezustand meines Koms und vergewisserte mich, dass ich eine Verbindung zum Raumhafen hatte.
Es wurde heiß. Die Automatik meines Anzugs begann selbsttätig zu kühlen. Wenig später musste ich sie anweisen, ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken. Dennoch konnte ich nicht verhindern, dass ich weit zurückfiel. Jennifer wanderte munter voran.
Dann überholte ich sie wieder. Sie kauerte am Rand des Weges im Unterholz und musterte eine kleine unscheinbare Pflanze, als habe sie in ihrem Leben noch keine Blume gesehen. Ihr Gesichtsausdruck war entrückt. Sie war ganz in den Anblick dieses unauffälligen Gewächses versunken. Ich ging vorbei, ohne etwas zu sagen.
Später schloss sie ihrerseits zu mir auf. Ich hörte ihre raschen leichten Schritte. Dann war sie neben mir. Schulter an Schulter wanderten wir dahin. Es war ein nicht allzu breiter Weg, der tiefer und tiefer in einen dichten Wald eindrang. Die Luft war dunkel und feucht, es roch nach Moder und verfaulten Früchten und exotischen Blüten. Insekten schwirrten unter dem Laubdach. Ab und zu tschilpte ein unsichtbarer Vogel.
»Ein Seidelbast«, sagte sie.
Ich dachte zuerst, sie meine den Vogel, bis mir einfiel, dass das der Name einer Pflanze war.
»Wirklich?«
»Ja!« Sie klang, als wäre es eine großartige Entdeckung. »Ich hätte nicht damit gerechnet, hier so etwas zu finden.«
»Wohl sehr selten?«
»Extrem! Selbst bei uns sind sie scheu wie junge Rehe. Die Siedler müssen sie mit eingeschleppt haben, als sie Nutzpflanzen importierten. Aber offenbar vertragen sie das Klima und haben sich mit den endemischen Flora arrangiert. Trotzdem wundert es mich, dass sie unmittelbar am Wegesrand wachsen!«
Ich brummte eine Art Zustimmung.
Wenig später wurde ich ihr wieder zu langsam. Sie schaltete einen Gang nach oben und ließ mich einfach stehen. Gemessenen Schrittes weiterwandernd, sah ich zu, wie sie den Abstand zwischen uns vergrößerte und bald ganz im schwarzgrünen Dämmer dieses Bergwaldes verschwand. Ich stapfte vor mich hin, in meine Gedanken eingesponnen, aber wenn mich unvermittelt jemand gefragt hätte, hätte ich nicht sagen können, woran ich gerade dachte.
Es wurde immer noch dunkler. Schließlich donnerte es, lang nachrollend und krachend, und es begann zu regnen. Schon während der letzten Tage hatten wir beobachten können, wie sich jeden Tag um die Mittagszeit die Wolken um die Berge ballten, um sich später in schweren Gewittern zu entladen. Bis zum Abend kam in der Regel die Sonne wieder heraus, um dann in melancholischen Untergängen hinter den Westbergen zu verscheiden.
Die Blitze hatten sich in irgendwelchen Felsklüften versteckt. Man hörte nur das Donnergrollen, satt und berstend, als rissen Fabelwesen die Bergzinnen aus, um mit ihnen zu kegeln. Minutenlang hallte es in der engen Schlucht des Masyan nach, dem wir nun flussaufwärts folgten und der sich hier seinen Weg durch die kilometerhohe Masse des Gebirges gebrochen hatte. Der Regen kam irregulär und versprengt, wie eine in Auflösung geratene feindliche Truppe durch das ölige Blätterdach, das unter seinen Attacken schwankte und taumelte. Aber die Reihe der Laubkronen hielten stand, wie sehr der Gegner auch auf sie einschlug und sie mit seiner nassen Artillerie beharkte.
Gewaltige Wasserfälle stürzten von den Felswänden herab und überfluteten teilweise den Weg. Ich musste von Stein zu Stein springen und aufpassen, nicht auf zerfetztem Laub auszurutschen. Einmal musste ich durch einen Sturzbach waten, der den Pfad auf einer Länge von zwanzig Metern überschwemmt hatte. Der Regen fiel ohne Unterlass, wie ein Vorhang, und der Wald gebärdete sich wie eine Armee von Trollen, die wütend tobte und gestikulierte, aber nicht einen Schritt dabei gewann. Es wurde immer noch finsterer. Das Wasser war allgegenwärtig und klebrig wie die Nacht. Ohne den Anzug wäre mir der Mut gesunken. So kämpfte ich mich weiter, mit einem Gefühl, als rudere ich unterhalb des Meeresspiegels einen Steilhang hinauf, der von widerspenstigen Wesen bestanden war.
Der Weg endete an einer Brücke, die von den Wassermassen mitgerissen worden war. Ich unterdrückte den Impuls, die Navigationsfunktion meines Koms zurate zu ziehen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätte sie sowieso nicht funktioniert, es gab ja auf dieser Welt keine planetare Netzabdeckung. Außerdem wollte ich Jennifer zuliebe die Herausforderung annehmen und ohne diese Hilfsmittel zurecht kommen. In meinem Kopf entstand der Kalauer, dass ich auf vorsintflutliche Weise in der Sintflut unterwegs war. Ich entdeckte einen schmalen Pfad, der neu ausgetreten zu sein schien und der rechts ab den Hang hinunter führte. Mit einem albernen Grinsen im Gesicht, über das mir der Regen schoss wie über eine defekte Windschutzscheibe, arbeitete ich mich den kaum zu erkennenden Trampelpfad entlang, der dem Wildbach folgte. Weglos, im immer noch undurchdringlicher werdenden Wald, während die steil eingeschnittene Schlucht die Abenddämmerung um mehrere Stunden vorwegzunehmen drohte. Der Gewitterbach war die einzige Orientierung. Irgendwo musste er in den Masyan münden, der dann wiederum die Hauptrichtung vorgab.
Ein umgetretenes Pflänzchen hier, ein paar abgerissene Blätter dort – das waren die einzigen Hinweise darauf, dass schon einmal Menschen hier gewesen waren. Ab und zu eine Fußspur im knöcheltiefen Morast. Meist waren es die profillosen Sandalen der Eingeborenen, die diese Löcher in den Schlamm getreten hatten. Manchmal erkannte ich aber auch Jennifers charakteristischen Stiefelabdruck und war dann jedesmal wieder erleichtert.
Der Pfad knickte ein und schickte sich an, den Sturzbach zu überqueren, ehe dieser in einem hohen Katarakt in den Masyan hinunter schoss. Der Waldboden bildete eine Art Canyon, der den Wildfluss fasste, und an einer Stelle ergab sich eine Furt, wo große Felsblöcke es möglich machten, trockenen Fußes auf die andere Seite zu gelangen. Nicht, dass noch ein trockener Faden an mir gewesen wäre!
Ich kletterte hinunter, und dort, an der tiefsten Stelle, in dieser Schlucht-in-der-Schlucht, auf einem Felsbrocken, der mitten im Bachbett lag und auf allen Seiten von strudelnden Wassermassen umbrandet wurde, dort saß Jennifer.
Ich stakte, von Stein zu Stein springend, an ihr vorbei, konnte ihren erhabenen Sitz aber nicht erreichen. Der fragende Blick, den ich ihr zuwarf wie ein Lasso einem Ertrinkenden, prallte an ihr ab. Sie saß in Meditationshaltung auf diesem klatschnassen Block. Dabei war sie ganz still. Kein Schluchzen, kein Jammern, keine Bewegung. Wie eine Statue war sie in diese Landschaft aus Wasser und Dämmerung gepflanzt und ließ die Tränen strömen. Die Natur weinte, schien sie sich zu sagen, warum nicht ein bisschen mittun.
»Geh weiter«, sagte sie, als ich unschlüssig stehen blieb.
Ihre Stimme klang mechanisch, wenn sie auch nicht aus der Trance zu kommen schien. Inzwischen konnte ich Dutzende Schattierungen und Abstufungen ihrer Versenkung unterscheiden.
»Ich bin da«, sagte ich.
Dann ging ich weiter.
Jennifer hockte im Regen und heulte.
Auf der anderen Seite ging es steil und pfadlos wieder hinauf. Mehr als einmal steckte ich bis zur Brust im nassen Laub, mit den Armen rudernd wie ein Verunglückter im Treibsand. Endlich gewann ich wieder den Hauptweg. Langsam wanderte ich weiter. Das Gewitter verzog sich. Die Abendsonne kämpfte sich durch die Wolken. Hoch über dem Blätterdach leuchtete eine Felswand im strahlenden Licht, immer noch höher und glühender. Darüber war reiner Himmel. Hier und da tropfte es noch, jeder Schritt schmatzte, alles, wirklich alles war nass. Aber das Wissen, dass es dieses andere gab, reichte aus, die Stimmung wieder zu heben, nachdem die Versuchung schon sehr groß geworden war, die ganze Unternehmung zu verfluchen.
Irgendwann war Jennifer wieder da. Schweigend holte sie mich ein und ging dann neben mir. Ich sagte nichts. Wir sprachen beide immer weniger.
Der Weg wurde schmaler und führte auf einem handbreiten Sims dahin, das an der mauerglatten Architektur der Felswände entlang schnürte. Tief unten brodelte der Fluss. Ein totes Muli lag im Masyan, ein Packtier, das zu einer Karawane gehört hatte und weiter oben abgestürzt war. Der Kadaver war an einer Stelle hängen geblieben, wo der Fluss noch einmal breiter, flacher, steiniger wurde und vernehmlich Atem schöpfte, ehe er das Katarakt hinunterbrach. Zwei Langhals-Geier waren bereits zur Stelle und taten sich an dem Muli gütlich. Ein schwarzer Königsgeier hockte drohend auf den Uferfelsen. Der rotbraune Kadaver war an der Flanke geöffnet. Einer der beiden großen Geier, die später gelandet waren, ihren Konkurrenten aber sofort vertrieben hatten, räumte die Innereien aus. Der tote Körper verschmolz fast mit dem rötlichen Gestein der ausholenden Geröllstufe, an der er angelandet war und die vom Fluss in schaumgrauer Furt durchströmt wurde. Der helle Schädel des Tiers sah aus wie einer der Felsbrocken, die aus dem seichten Wasser ragten.
Wir standen lange da und betrachteten dieses Bild, das von starker meditativer Kraft war, ließen uns selbst von ihm durchströmen.
»Tod und Vergänglichkeit«, sagte ich leise.
»Ja.« Jennifer nickte. »Aber eingebettet und durchströmt vom Fluss, vom Ewigen Werden.«
Ich sah sie an.
»Der Einzelne«, sagte sie, »ist nur ein Teil des großen Plans, aus dem er hervorgeht und in den er wieder eingeschmolzen wird.«
Wenig später trat der Wald auseinander. Wir kamen auf eine künstliche Lichtung. Ein winziges Dorf, nur zwei oder drei ärmliche Höfe, und rings herum terrassenförmig dem Gelände abgerungene Felder. Obwohl die Berge hoch über uns noch leuchteten, dämmerte es hier unten schon . Die Felder mussten dieser Tage abgeerntet worden sein. Man verbrannte Laub und Stroh in qualmenden Feuern. Die Rauchschwaden krochen zäh und lauernd am Rand der Siedlung herum. Es schien niemand auf den Wegen zu sein, aber als wir uns näherten, kamen einige Erwachsene und eine unübersehbare Schar von Kindern aus den armseligen Hütten. Sie musterten uns scheu. Wir waren fremd hier. Unsere weißen Anzüge, die Uniformen der Fliegenden Crew für Außeneinsätze, machten uns auffälliger als Aliens. Eigentlich hätten wir sie gegen einheimische Kleidung tauschen sollen, aber dann hätten wir auf die vielen Annehmlichkeiten der integrierten Funktionen verzichten müssen, die ich gerade in diesem Augenblick genoss, die automatische Heizung etwa, die gegen die einsickernde Feuchtigkeit ankämpfte.
Die Alten beäugten uns misstrauisch, wobei mir auffiel, dass die Männer noch feindseliger wirkten als die Frauen. Diese betrachteten uns schweigend, aber mit offenen, abwartenden Gesichtern, während die bärtigen Männer eine Phalanx der Abweisung bildeten. Lediglich die Kleinen kamen auf uns zu. Sie stellten sich am Rand des Weges auf, wo dieser zwischen den Häusern hindurch führte, und bildeten ein Spalier des Lachens und der Fröhlichkeit. Wie sie es sich bei durchkommenden Pilgerzügen angewöhnt hatten, streckten sie die Hände vor. Es war mehr ein Spiel als echte Bettelei. Sie standen da, kicherten und stießen sich gegenseitig mit den Schultern. Dabei starrten sie vor Schmutz und Ungeziefer. Ihre schwarzen Haare waren steif vor Dreck. Wenn nicht eine natürliche, ungezwungene Fröhlichkeit wie ein bunter Vogelschwarm um sie geflattert wäre, hätte der Anblick niederschmetternd sein müssen.
So versuchten wir uns auf den spielerischen Charakter des Ganzen einzulassen. Wir kramten alles aus den Tornistern, was wir an Obst und Süßigkeiten mit uns führten. Jennifer veranstaltete ein Quiz und drehte es so, dass jeder einmal der Sieger war, der dann eine Banane oder einen Schokoriegel zugesteckt bekam. Dabei brachte sie noch Einiges aus den Kleinen heraus. Wie das Dorf hieß, wie weit es auf dieser Route zu den Klöstern war und anderes mehr. Als sie, eine Tafel Energienahrung in der Rechten, fragte, ob auch schon andere »Astronauten« durchgekommen waren, schritt einer der Väter ein und ermahnte uns, die Kinder in Ruhe zu lassen. Wir steckten auch ihm noch etwas zu und gingen weiter. Den Gedanken, hier um Obdach zu bitten, verwarf ich angesichts des schreienden Elends dieser Behausungen aus Bambusmatten und Bast, der mit Lehm und Dung beworfen war. Wir fragten, ob wir am Rande der kleinen Lichtung, auf einem der abgeernteten Felder, unser Zelt aufschlagen konnten. Das wurde uns bewilligt. Wir bezahlten dem Eigentümer des Platzes einen Obolus und verabschiedeten uns von den Kleinen, die vom finsteren Auftritt des Dorfältesten nicht im geringsten eingeschüchtert waren.
Einen Steinwurf unterhalb der Häuser fanden wir eine ebene Fläche auf einer der Terrassen. Das selbstaufblasende Zelt stellte sich in wenigen Augenblicken auf. Ich warf die Schlafsäcke hinein, die sich ebenfalls automatisch entrollten. Unsere Anzüge, die mit selbstreinigenden Nanomeren beschichtet waren, hatten sich inzwischen getrocknet und gesäubert. Im Vorzelt streiften wir die Stiefel ab, die als einzige Ausrüstungsgegenstände noch die Spuren dieses Marsches trugen. Ansonsten war alles wieder wie aus dem Ei gepellt. Es gab mir einen Stich, als ich zum offenstehenden Zelteingang hinaussah: oben standen die Kinder, aufgereiht auf einem Mäuerchen, und schauten zu uns herab. Sie lebten hier, während wir, von hermetischen Imprägnierungen geschützt, nur vorbeigingen. Wir gingen durch den Regen, ohne nass zu werden, und wir betrachteten die Armut, ohne ihr ausgesetzt zu sein. Wir blieben Astronauten, die von einer Welt zur anderen schritten wie ein Wanderer über die Trittsteine einer Furt. Auch wenn wir so taten, als ob wir stehen blieben, machten wir uns nicht schmutzig.
Es war zu spät geworden, um noch richtig zu kochen. Wir verzehrten eine der selbsterhitzenden Fertigmahlzeiten, die zur Grundausstattung der interstellaren Exploration gehörten. Dann streckten wir uns auf den Schlafsäcken aus, ohne hineinzukriechen. Die Anzüge hatten wir abgelegt. Das sensorielle Unterzeug war angenehm warm und trocken.
»Das war schön heute«, sagte Jennifer.
»Was meinst du?«
»Alles, der ganze Tag. Die Wanderung.«
»Mhm.«
»Hat es dir nicht gefallen?«
»Doch.«
»Du magst keinen Regen!«
»Es geht schon.« Ich sah zu ihr hinüber. »Wenn es dich entspannt.«
»Es geht mir gut.« Sie lächelte.
Wir schwiegen und sahen zum Zelteingang hinaus, der immer noch offen stand. Der Wind blätterte die Plane hin und her wie ein Leser die Seiten eines Buchs, in dem es einfach nicht voran ging. Draußen war es dunkel. Die Nacht war plötzlich von den Bergen herabgestürzt wie ein schwarzer Block und hatte sich polternd über dem Tal verklemmt. Wir sahen die fahlen gelben Lichter der Hütten, vermutlich Öl- oder Butterlampen. Hier oben gab es nichts mehr. Keine Elektrizität, kein fließendes Wasser, keine medizinische Versorgung. Ein vereiterter Zahn oder ein verstauchter Knöchel konnte über ein Leben entscheiden, und kaum eines der Kinder, die wir gesehen und mit denen wir gespielt hatten, würde je Lesen und Schreiben lernen.
Dass es so etwas noch gab!
»Du bist schwermütig«, sagte Jennifer.
Immer mehr gelangte ich zu der Auffassung, dass sie Gedanken lesen konnte, zumindest meine Gedanken. Manchmal war es unheimlich, wie gut wir uns kannten, wie sehr wir aufeinander eingespielt waren. Ob es die Hantierungen beim Zeltaufbau oder die Absprachen während einer stundenlangen Wanderung waren, wir verstanden uns blind, jeder wusste immer schon vorher, was der andere tun oder sagen würde. Ihre Hände gehorchten meinem Willen genauso wie meine eigenen und umgekehrt. Wir waren ein Wesen, das nur zufällig auf zwei verschiedene Körper verteilt war und das auf zwei verschiedene Namen hörte. Im Grunde waren wir eins.
Laertes fiel mir wieder ein und seine Äußerung angesichts der kuLau.
»Es geht mir gut«, sagte ich. Das war der Satz, den sie während der letzten Tage am häufigsten gebraucht hatte. Aber hatte sie deswegen ein Anrecht darauf? »Verrätst du mir, was du vorhin hattest?«
Sie tat, als höre sie nicht.
»Am Bach?«
Immer noch schwieg sie. Nach einer Weile schlüpfte sie in den Schlafsack, der sich daraufhin bis zur Taille um sie schloss.
»Eingang schließen«, sagte sie. Das Zelt versiegelte sich.
Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, als sie sich doch noch zu einer Antwort aufraffte.
»Mir war einfach danach. Ich wollte weinen. Vielleicht wäre es gut, wenn man den Rest des Lebens weinen könnte.« Sie räusperte sich im Dunkeln. Es kam nicht oft vor, dass Jennifer Ash verlegen war. »Es ist ein Druck in mir, da ist so viel angestaut. Ich muss es einfach irgendwie herauslassen.«
»Es war ja auch kein Vorwurf. Ich will es nur verstehen.«
»Ich weiß.«
»Wenn ich dir irgendwie helfen kann ...«
»Es ist gut. Du warst wunderbar!«
Ich sah ihr Lächeln vor mir. Der Klang ihrer Stimme projizierte es an die Leinwand der Zeltplane, die eine Armlänge über mir in der Finsternis hing und leise im Nachtwind flappte.
»Du warst wunderbar!«, sagte ich.
»Was meinst du?«
»Wie du mit den Kids gespielt hast! Woher kannst du sowas?«
Die Stille veränderte ihren Klang. Ihr Schweigen nahm eine tiefere Färbung an. Schwarz.
Ich wollte ihr helfen und bohrte zielsicher den Fingernagel in eine klaffende Wunde, die ich doch kaum ahnte.
»Vielleicht wäre es besser, wenn man Kinder hätte.« Damit drehte sie sich auf die andere Seite.
Ich lag im Dunkeln und lauschte den Geräuschen der Nacht. Jennifers Atemzüge hatten sich rasch vertieft. Sie konnte eine leichte Trance benutzen, um sich in den Schlaf hineinzuschieben. Das war praktisch, vor allem wenn man viel um die Ohren hatte, aber trotzdem auf ein Mindestmaß an Ausgeruhtheit angewiesen war. Sie hatte immer wieder versucht, mich in die Mysterien des Prana-Bindu-Ordens einzuführen, etwa während unseres langen Fluges in dem gekaperten Sineser-Shuttle. Dort hätten wir die letzte und längste Etappe und ihre ungeheuren Strapazen nicht überlebt, wenn wir nicht auf diese uralten Meditationstechniken und die Weisheit der Körperkontrolle zurückgegriffen hätten. Aber im täglichen Leben verlor sich derlei wieder. Ich hörte voller Neid ihrem ruhigen, gleichmäßigen Atem zu. Andererseits war die Strecke heute nicht allzu anstrengend gewesen. Kein Weg, um sich zu erschöpfen. Von daher machte es nichts, wenn ich eine Stunde später einschlief. Ich musste mich nicht dazu zwingen.
Diese Nächte im Zelt, unzählige schlaflose Stunden. Auf wie vielen Welten hatte ich so in die fremdtönende Finsternis hinausgelauscht. Der Wind hatte auf jedem Planeten einen anderen Klang. Manchmal gab es Wasser, das rieselte, oder Laub, das in den Böen tuschelte. Sogar Tiere! Auch hier scharrten hühnerartige Vögel in der Erde und pickten an unserer Ausrüstung herum. Aus dem Dorf drangen vertraute und weniger vertraute Geräusche. Einmal sogar ein Turbinengeheul, das sich vom Raumhafen bis in diese Schlucht verirrt hatte und lange den Ausgang nicht fand.
Dann wieder Stille.
Saugende, tiefschwarze, alles einschlingende Stille, in der der eigene Pulsschlag schmerzhaft werden konnte.
Ich dachte an andere Nächte. Meine Erinnerungen führten mich zu jener anderen Wanderung, die wir auf dieser Welt unternommen hatten. Im selben Gebirge, zu den selben Klöstern, nur auf einer anderen, noch wilderen Route. Wie lange war das her! Auf dem Kalender hätte man es bestimmen können. Aber was war in der Zwischenzeit nicht alles geschehen! Wir hatten Jahre in der Diaspora verbracht. Wir hatten eine nicht endenwollende Reihe von Kriegen durchgefochten. Wir hatten uns bis ans äußerste erschöpft und aufgerieben. Jetzt waren wir wieder hier. Alt und ausgebrannt und im Innersten verwundet. Und doch konnte selbst Jennifer noch lachen.
Wir waren schon unglaublich zäh!
Mit einem grimmigen Grinsen auf den Wangen schlief ich ein.
Aus dem Aufwachen und noch aus Schlaf und Traum heraus nahm ich Anlauf zu diesem neuen Tag. Ich erwachte mit dem Gefühl des Genesenden. Ein Zur-Welt-Kommen noch einmal. Ich sah nicht ein, weshalb ich die Augen öffnen sollte. Zunächst einmal lag ich unbestimmte, aber sehr lange Zeit einfach nur da und genoss dieses: zu sein. Ich selbst zu sein. Genesen zu sein!
Mit jedem Tag und vor allem jeder Nacht, die wir auf dieser Welt verbrachten, wurden wir wieder wir selbst. Was das ausmachte: In einem richtigen Bett zu schlafen! Nun ja: einem sensoriellen Schlafsack. Bei natürlicher Schwerkraft. In einer richtigen Atmosphäre. Bei den ganz normalen Geräuschen und Gerüchen, die es auf einer Welt gab! Keine Feldgeneratoren, die irgendwo summten. Keine Lüftung, die unhörbar wisperte. Keine Automatik, die jede noch so unbewusste Lebensregung überwachte und dokumentierte und kommentierte und mit mütterlichem Fiepen und Piepen interpunktierte.
Stattdessen der Morgenwind, der sachte und zärtlich über die Zeltplane strich. Wie eine Geliebte, die ein paar Atemzüge vor einem selbst wach geworden war und einen sanft ins Dasein zurückstreichelte. Und die Gerüche von warmen, lebenden Körpern. Und darüber der Duft von Erde und Tau und Reisigfeuern und Dung und von Vieh und ungewaschenen Kindern und von sommertrockenem Laub und vom feinen Sandelholz der Rauchopfer. Und das Schnauben der kleinen gedrungenen Rinder und das Klirren winziger goldener Glöckchen und gedämpfte Stimmen in einem gutturalen Dialekt und die stapfenden Schritte der Menschen, die in diesem Tal geboren waren und die hier sterben würden, ohne es je verlassen zu haben.
Allmählich wurde ich wieder ich selbst. Wie lange waren wir von uns selbst getrennt gewesen! Wie durch unsichtbare Scheiben und Wände von uns selbst geschieden. Ich dachte zurück. Wann hatten wir uns zuletzt so frei gefühlt? Da musste ich weit zurückgehen. Da waren all die kleinen Schlachten und Feldzüge gewesen, die Kriege gegen Zthronmic, Tloxi und Laya. In den Geschichtsbüchern der Zukunft bloße Fußnoten. Aber jeder für sich war eine gewaltige Unternehmung gewesen, die uns alles abverlangt hatte. Tausende der Unseren hatten wir sterben sehen. Jedes Mal. Davor die Schlacht um Sina. Das gewaltigste militärische Ringen, das der Galaxis bis zum heutigen Tag geboten worden war. Davor die Jahre der Diaspora.
Und davor? Die Jahrzehnte der interstellaren Exploration. Doch auch sie hatten wir an Bord von Schiffen verbracht oder auf Basen, die wir auf lebensfeindliche Welten vorschoben. Auch dort hatten wir künstlich erzeugten Sauerstoff geatmet und selbsterhitzende Fertigprodukte gegessen.
Im Grunde brachte diese Wanderung uns unsere Jugend wieder und den rätselhaften und idyllischen, damals ganz unversehrten Planeten namens Erde. Plus die Tatsache, wie lange das alles her war!
Aber das war mir egal. Ich fühlte mich jung. Die Tatsache, dass ich erwachsene Kinder haben könnte, ging mich nichts an, solange ich die Muskeln dehnte und die Luft einsog, als hätte ich ein halbes Menschenalter nicht mehr richtig ausgeschlafen gehabt.
Ich blieb liegen und streckte mich. Das kehlige Lachen der Kinder des winzigen Weilers, in dessen Nähe wir campierten, drang an mein Ohr. Dazu andere Geräusche, jedes einzelne unendlich kostbar. Jemand klopfte die Bastmatten aus, mit denen man hier die nackten Lehmböden der Hütten auslegte. Jemand spaltete Holz mit einer Axt. Ein Muli scheute und kratzte seine wundgescheuerten Weichen an einer Mauer. Ein einheimischer Vogel sang und piepte mit einer sonderbaren Stimme, die an ein elektronisches Signal erinnerte.
Der Wind frischte ein wenig auf und drückte die Zeltplane nach innen. Das wirbelte andere Gerüche auf, die im Inneren unserer Unterkunft zuhause waren. Der Dunst unserer Körper, die seit Tagen nicht mehr richtig gewaschen worden waren. Das ganz eigentümliche Aroma, dasAnzüge, Rucksäcke und Ausrüstung abstrahlten, wenn sie lange der Sonne ausgesetzt gewesen waren. Der Duft der Lebensmittel, die wir unterwegs in den Dörfern gekauft hatten. Der süße beizende Geruch eines kleinen Blumenstraußes, den Jennifer am Wegesrand gepflückt und zum Trocknen in den First des Zeltes gehängt hatte.
Ich öffnete die Augen und sah die blassen Blümchen über mir schaukeln.
Es war taghell. Eben leuchtete die oberste Spitze des Zeltes auf, als sie vom ersten Sonnenstrahl getroffen wurde. Wir hätten die Planen auch auf volle Absorption schalten können, dann wäre es selbst in der prallen Sonne stockfinster gewesen. Oder sie auf transparent programmieren, dann hätten wir durch sie hindurch die Landschaft betrachten können. All diese Sperenzien waren wir leid. Wir hatten das Zelt einfach nicht angeschaltet, die raffinierte Automatik, die es natürlich auch hier gab, gar nicht erst aktiviert. So war die Plane eine Plane und nichts außerdem.
Jetzt glühte und strahlte sie in der Morgensonne dieser kargen und doch so überaus reichen Welt.
Ich spannte und entspannte noch ein paar Mal die Muskulatur, bis jeder Zoll meines Wesens vor Bewusstsein und Kraft vibrierte. Dann setzte ich mich auf. Der Platz neben mir war natürlich leer. Ich hatte mit nichts Anderem gerechnet. Eine Weile hockte ich einfach nur da, im Schneider- oder im Lotossitz, ganz wie man wollte, und ließ die Blicke über die zweimal zwei Meter unserer Unterkunft schweifen. Stiefel und Elastilflaschen. Zusammengeknüllte Hosen und Jacken. Beutel aus grobem Stoff, die die kleinen, kugelrunden und feuerroten Kartoffeln dieser Welt enthielten. Andere Beutel mit Lauch, Zwiebeln und wilden Kräutern. Ein Amulett des Prana-Bindu-Ordens, das wir einem Bettler an einem verfallenen Schrein abgekauft hatten. Mein Handkom. Es war offline und abgeschaltet.
Als ich den Kopf aus dem Eingang streckte, empfing mich ein Morgen im Hochgebirge, wie er malerischer nicht sein konnte. Als wäre ich in einem Bilderbuch aufgewacht und betrachtete nun die idealisierenden Darstellungen, von denen ich ein Teil war. Die abgeernteten Terrassenfelder, auf denen unser Zeit stand, waren von Reif bedeckt. Ihre Stufen und Absätze brachen in die Tiefe, wo der verblüffend steile Hang irgendwann in die wilden Wälder überging, durch die wir heraufgekommen waren. Am Grund des Tales, das wie mit einer antiken Säge in das Gebirge geschnitten war, strömte der Fluss, der grau und grün durch sein viel zu breites Kiesbett mäanderte. Er speiste sich aus den Gletschern weiter oben. Auf der anderen Talseite stieg die Abfolge von Wald, Feldern und abermals Wald in die Höhe, bis sie der rohen Gewalt von nacktem Fels zu weichen hatte. Darüber Eis. Unabsehbar hohe Wände aus blankem Eis, von Lawinen gerieft, von Séracs zerrissen, von Hängegletschern überwölbt, die schwer und trächtig waren wie die üppigen Formen von Fruchtbarkeitsgöttinnen. Sie gipfelten in weißen Zinnen und Graten, an denen lange Schneefahnen hingen und über denen nun die Sonne stand. Die dünnen körperlosen Wolken, die in Wahrheit Schleppen von Eiskristallen waren, glühten zinnoberrot auf und begann dann rasch, farblos zu gleißen, als die Sonne senkrecht über sie hinaufstieg. Der Himmel füllte sich mit ihrem Licht wie mit dem Dröhnen eines großen bronzenen Gongs, den ein übergewichtiger Mönch in einem uralten Tempel mit einem riesigen Schlegel in Schwingung versetzte.
Was für eine Lust es war, barfuss über die Erde zu gehen, die dort, wo sie in der Sonne lag, schon körperwarm war, während sie einen Schritt daneben, im Schatten eines Busches oder eines Felsens, steinhart gefroren und von den Runen des Reifs bedeckt war.
Jennifer saß wenige Parzellen weiter in einem der Felder, die vor wenigen Tagen mit primitiven Pflügen umgebrochen worden waren, und meditierte. Sie hatte den Lotossitz eingenommen. Ihre Hände ruhten auf ihren Knien. Ihre Augen waren geschlossen. Ihr Gesicht war blicklos in imaginäre Fernen gerichtet. Sie trug das mattgraue Unterzeug. Ein weiblicher Buddha. Ihr Schweigen war voller Leben und Kraft. Ich konnte spüren, wie ihre Energie das Tal erfüllte und die ganze Landschaft mit geistiger Präsenz auflud.
Die Kinder des kleinen Dorfes hatten einen Kreis um sie gebildet. Sie wahrten ehrfürchtig einen Abstand von mehreren Schritten und sahen ihr zu, die sie nicht wahrzunehmen schien. Jungen und Mädchen waren nicht zu unterscheiden. Beide trugen sie nur schmutzstarrende zerrissene Kleidchen. Die Haare standen als verfilzte Skulpturen um ihre Köpfe. Sie waren mehr nackt als bekleidet und durchweg unterernährt. Manche hatten selbstgebastelte Spielsachen und Kuscheltiere auf dem Arm. Die etwas größeren, die fünf oder sechs Jahre alt sein mochten, schleppten ihre kleineren Geschwister auf dem Rücken.
Ich blieb in einiger Entfernung stehen und sah mir die Szene an. Sie tuschelten und kicherten. Als sie mich sahen, schien sie das nicht zu verunsichern, sondern im Gegenteil noch anzustacheln. Endlich wagte sich eines der größeren Mädchen vor, das die Anführerin des kleinen Trupps zu sein schien. Mit einem Satz überwand sie den selbstgesetzten Kreis und stupfte Jennifer kurz an. Unter dem Gekreisch der anderen zog sie sich wieder auf den Sicherheitsabstand zurück.
Nichts geschah.
Ein zweites Mal sprang sie vor und zupfte die regungslos Meditierende am Haar.
Nichts.
Nach und nach trauten sich auch die anderen, bis Jennifer von der Horde aufgeregt johlender Dreckspatzen umringt war.
Plötzlich packte sie eines der Mädchen und riss es an sich. Blitzschnell aufspringend, versuchte sie die anderen zu schnappen, die auseinander stoben wie ein Rudel Murmeltiere, aus deren Mitte der Adler ein Junges gerissen hatte. Jennifer war schneller als sie alle. Nur ihre Arme waren irgendwann zu kurz. Sie konnte nicht zehn oder zwölf Kinder zugleich an sich pressen, auch wenn es so aussah, als ob sie am liebsten die ganze Schar auf einmal an ihre Brust gezogen hätte.
Die Kleinen kreischten in einer Mischung aus Panik und Verzückung.
Jennifer gab sie wieder frei, wobei sie einige Worte zu ihnen sagte. Sie verstand ein wenig den hiesigen Dialekt.
Ich ging zu ihr, die schwer atmend in der zerwühlten Erde stand, während die Kinder laut plappernd zu den Hütten liefen, wo sie nun den Rest des Tages etwas zu erzählen hatten.
»Dass die Welt uns dabei stört, uns in ihr Nichtsein zu versenken!«
Sie sah mich verständnislos an.
»Geht es nicht darum? Die Nichtigkeit aller Dinge.«
Jennifer sah noch immer den Kindern nach, die barfuss über die Mäuerchen klimmend den Häusern zustrebten.
»Nie würde ich behaupten, dass diese Kinder nicht existieren«, sagte sie leise. Sie war nicht bei der Sache. Ich hörte an ihrer Stimme, dass sie keine Lust auf tiefschürfende Diskussionen hatte. Dabei war es auch nur als hingeworfene Bemerkung gemeint gewesen.
»Nicht?«
»Nein.« Ein Lächeln spielte um ihre Lippen. »In allerletzter Hinsicht. Aber dann sind auch diese Berge nicht und ist diese Sonne nicht und ist vielleicht der ganze Kosmos nicht, denn alles wird vergehen und nichts wird davon bleiben. Aber jetzt ist alles da.« Sie zwinkerte mir zu. »Und es ist immer jetzt!«
»Ich weiß schon, warum ich nie über die Anfangsgründe hinaus gekommen bin.«
»Alles ist«, sagte sie verträumt. »Alles lebt. Alles atmet. Sieh es dir an!«
Ich legte den Arm um sie. Nebeneinander standen wir da und sahen über das Tal hinweg zu den Bergen, die es begrenzten. Darüber der stahlblaue Himmel. Alles war vollkommen.
Der Dorfälteste wurde oben am Mäuerchen sichtbar. Die Kinder scharten sich um ihn, als wären es alle seine eigenen. Vielleicht waren sie das sogar. Er gestikulierte, mehr drohend als winkend, und blökte etwas, das wir nicht verstanden.
»Oh, oh«, grinste Jennifer.
Wir kletterten nach oben, wobei wir uns die allergrößte Mühe machten, nicht ein Steinchen aus den Trockenmauern zu brechen.
Jennifer beschrieb den traditionellen Gruß, den ich unbeholfen nachvollzog. Wir blieben einige Schritte unterhalb des Alten stehen, was ihm den Triumph gab, auf uns herabblicken zu können. Er spuckte seine Worte eher aus, als dass er sie artikuliert hätte. Selbst wenn ich des Dialektes mächtig gewesen wäre, hätte ich ihn kaum verstanden. Er hatte weniger Zähne im Mund als Finger an einer Hand.
Jennifer radebrechte und dolmetschte.
»Er sagt, wir sollen die Kinder in Ruhe lassen«, erklärte sie nach einem Wortwechsel, der sich anhörte, als rührte man mit einem Stock in nassem Kies herum. »Und wir sollen auch das Dorf verlassen. Sie wollen uns hier nicht.«
Ich nickte. Da sie die Konversation führte, konnte ich mich ganz auf deren nonverbalen Anteil konzentrieren. Mir fiel auf, dass der Alte immer wieder über uns hinweg sah und einen bestimmten Punkt auf der gegenüberliegenden Talseite fixierte. Ich versuchte seinem Blick zu folgen, konnte jedoch nichts ausmachen. Seine gehetzte Miene und die unduldsame Sprechweise verrieten, dass er vor etwas Angst hatte.
»Sag ihm, wir sind in einer Stunde weg«, meinte ich zu Jennifer.
Sie schien schon etwas in der Art vorgebracht zu haben. Der Alte brauste auf. Vermutlich war ihm diese Frist zu lang. Aber wir wollten uns auch nicht von ihm ins Bockshorn jagen lassen. Jennifer richtete noch zwei, drei Worte in unmissverständlichem Ton an ihn. Dann trollte er sich, Unverständliches in sich hineinmümmelnd, das selbst für einen Muttersprachler keine Bewandtnis mehr haben würde.
Wir kehrten zu unserem Platz auf den Terrassen zurück.
»Wie geht es dir?«, fragte Jennifer. »Du hast geschlafen wie ein Stein!«
»Ich fühle mich ausgesprochen seiend heute«, ulkte ich. »Ich glaube, ich habe seit mindestens dreißig Jahren nicht so gut geschlafen.«
»Das ist gut.« Sie lächelte mich an und musterte mich wohlwollend, als sei ich der Patient und sie meine Betreuerin.
»Und wie geht es dir?«
»Gut.« Die Antwort kam rasch und knapp. Es war noch nicht das »gut«, um das es bei der ganzen Sache ging, aber auf einer oberflächlichen Ebene wirkte auch sie erstaunlich erholt und ausgeruht.
»Schön«, sagte ich ebenso kurz. »Was hältst du von Frühstück?«
»Hast du Hunger?«
»Wie ein Bär!«
Wir schlenderten zu unserem Zelt, wo bald der Duft von Kaffee und Marmelade um die Planen webte. Nachdem wir uns gestärkt hatten, schlug ich das Lager ab. Jennifer ging noch einmal zu den Hütten hinauf. Der eine oder andere Dorfbewohner hatte in der letzten Stunde über das halbhohe Mäuerchen gelugt, das die Felder von der Siedlung trennte. Auf die Entfernung war nicht festzustellen, ob Argwohn oder Neugier in diesen Blicken war. Nahmen auch sie Jennifer übel, dass sie mit den Kleinen gespielt hatte?
Jetzt stieg sie die steil übereinander aus dem Hang getriebenen Terrassen hinauf, unterhielt sich eine Weile mit den Leuten und kaufte ihnen Mehl und Gemüse ab. Den kleinen Verdienst nahmen sie noch gerne mit, wie die einfachen Dorfbewohner insgesamt versöhnlicher gestimmt schienen als der Alte. Doch auch sie sandten hin und wieder scheue Blicke zum gegenüberliegenden Berghang, so dass wir uns beeilten, uns von ihnen zu verabschieden.
Wir wanderten weiter.
»Hier bleiben wir.«
»Warum eigentlich nicht?« Ich sah mich um. Der Platz hätte nicht idyllischer gewählt sein können. Die Schlucht beschrieb eine Kurve und weitete sich dabei zu einem Schwemmboden, den der Fluss in einer gemächlichen Mäanderschleife durchlief. Auf der Nordseite stieg eine senkrechte Felswand mehrere hundert Meter in den Himmel. Zwei Wasserfälle kamen in stupender Symmetrie von dort herunter. Wo sie in die Wiese stürzten, ein kleines Becken bildeten und dann in den Fluss strömten, erhob sich ein grasbedeckter Hügel, auf dem wiederum die Ruine eines kleinen Tempels oder Schreins stand. Das alles war so pittoresk, dass es arrangiert schien. Nicht nur das kleine Heiligtum, das freilich stark verwittert war und kaum noch kultische Bedeutung zu haben schien, die ganze Landschaft, die ganze Talebene schien wie von Künstlerhand erschaffen.
Jennifer sagte etwas, das wie »Tal« klang.
»Was sagst du?« Das Rauschen des Flusses und der beiden Wasserfälle hatte ihre Stimme übertönt.
»Das ist der Name dieser Stelle«, erklärte sie.
»Das Tal heißt Tal?«
»Dal«, präzisierte sie. »Das einheimische Wort für See.«
Ich nickte. »Das kann man sich gut vorstellen.«
Auf der Südseite schob ein Seitental eine Moräne vor. In der letzten Eiszeit dieser Welt hatten offenbar die Gletscher bis hier herab gereicht. Jetzt hatte sich das Eis zurückgezogen, aber es war gut denkbar, dass der breite Wall aus Erde und Geröll einmal den Hauptfluss aufgestaut und die Talbiegung in ein Seebecken verwandelt hatte. Später hatte das Wasser sich wieder seinen Weg gebahnt. Doch auch jetzt war es nur ein schmaler Durchbruch, wo der Fluss sich zwischen der Moräne und der Felswand durchwand.
Jenseits davon erstreckte sich eine große, beinahe ebene Wiese, und am Rand, wo die Wasserfälle für genügend Feuchtigkeit sorgten, gab es ein kleines Wäldchen aus Haselsträuchern, Birken und endemischen Laubbäumen.
»Hier?«, fragte ich.
Jennifer nickte nur.
Ich sah sie an: »Wie lange?«
Sie hob die Schultern. Das konnte sie nicht sagen. Zwei Tage, vielleicht drei. Ich versuchte in ihrer Miene zu lesen, die ungewöhnlich abweisend war. Eine Woche? Sie wusste es nicht. Aber ihre Haltung strahlte Entschlossenheit aus.
Hier also.
Wir bauten das Zelt im Schutz des kleinen Birkenhains auf und richteten uns häuslich ein. Der Platz war gut gewählt. Es gab frisches Wasser, und nachdem wir eine Weile die nähere Umgebung durchstreift hatten, fanden wir wilde Erdbeeren, einheimische Apfelbäume und einen Strauch, dessen Rinde essbar war. Wir hatten Vorräte genug dabei, um längere Zeit autark zu sein. Schlimmstenfalls war es ein halber Tagesmarsch zurück ins Dorf, um Gerste und Kartoffeln einzukaufen.
Darüber hinaus war der Ort geschützt, und das Tempelchen verlieh ihm die Aura eines heiligen Bezirks. Jennifer sagte nichts dazu, aber ich vermutete, dass ihre Wahl auch darin begründet war. Es war ein Sanktuarium, eine Stätte, die mit einem Tabu belegt war. Wenn wirklich, wie man uns immer wieder eingeschärft hatte, Gefahr aus dem Hinterland drohte, würde uns das vielleicht schützen.
»Es heißt auch Heiliger Hain«, sagte sie noch, als habe sie meine Gedanken mitgelesen. »Also mehr im übertragenen Sinn.«
Das leuchtete mir ein. Wasser musste hier etwas Heiliges sein. Es war nur scheinbar im Überfluss vorhanden, denn entweder lag es gefroren in den Gletschern, die hoch und steil auf den Bergen lasteten, oder es stürzte sich reißend, alles verschlingend die Schluchten herab. Wo es gefasst, kanalisiert und den Felder zugeleitet wurde, war es ein Äquivalent für Leben, Fruchtbarkeit und Wohlstand, aber welch ungeheurer Fleiß war nötig, die Terrassen anzulegen und die Rinnsale zu ihnen zu führen.
Die Gletscher, dachte ich, sind die Bibliotheken des Wassers. Es ruht in ihnen in Latenz, wie der Geist in den Millionen Bänden eines abgeschlossenen Archivs. Was hier der Blick des Lesers, ist dort der Sonnenstrahl, der die Kristalle aufschließt und den eingesperrten Geist herausschmilzt.
Wir verbachten hier mehrere Tage und Nächte. Die Nächte waren das eigentliche, die Tage brauchten wir dazu, uns von den Nächten zu erholen. Ich konnte nur wenig mehr tun als da zu sein, bei ihr zu sein, ihr beizustehen, die sich jetzt endlich den Dämonen stellte, die seit Zthronmia in ihr hausten. Nachts schrie sie, würgte, knirschte mit den Zähnen. Sie rollte die Augen, warf sich herum, versuchte sich die Kleidung und den Schlafsack herunterzureißen. Ich redete ihr gut zu, auch wenn ich nicht wusste, ob sie mich wahrnahm. Ich hielt sie fest, wenn sie sich wie eine Tobende gebärdete. Ich flößte ihr etwas zu trinken ein. Ich verhinderte, dass sie ihr Unterzeug zerfetzte und aus dem Zelt stürmte. Dann lag sie wieder da wie tot, den Atem in tiefer Trance bis an die unterste Schwelle abgesenkt, der Körper steif und kalt, die Seele weiter von mir entfernt als selbst in Megaparsek anzugeben wäre. Sie kämpfte. Sie forderte heraus, was seit der Geiselhaft und ihrer Folterung an ihr fraß. Sie stellte sich dem Trauma, was bedeutete, die Verwundung wieder aufzusuchen, die Situation zu rekapitulieren, den Wahnsinn wieder und wieder zu durchleben. Die Hilfe, die ich ihr bot, ging nicht darüber hinaus, ihr einen Tee zu bereiten oder sie lange in den Armen zu wiegen, die wimmerte und schniefte wie ein Kind, das schlecht geträumt hatte. Dennoch versicherte sie mir jeden Morgen, wie wichtig es für sie sei, dass ich da war.
Und dann war sie verschwunden. Am schönsten Morgen, der auch der tiefsten Nacht aus irgendeinem Grunde immer folgt, erwachte ich spät. Ich war allein. Ich ging hinaus, streifte über die Wiese, setzte mich auf einen sonnenwarmen Felsblock. Ihre Stiefel und ihr Anzug lagen im Zelt. Sie konnte nicht weit sein. Aber vielleicht war ihr etwas zugestoßen. Sie konnte auf der anderen Seite der Moräne gestolpert und mit dem Schädel gegen ein Stein geprallt sein, und ich würde es nie erfahren.
Gerade als ich anfing, mir ernsthaft Sorgen zu machen, ließ mich eine Bewegung herumfahren, die meinen Augenwinkel erwischte wie ein störendes Insekt. Dann sah ich sie. Barfuss, nur mit dem grauen sensoriellen Zeug angetan, war sie eine Felszinne hinaufgeklettert, eine freistehende Granitnadel, die jeden Kirchturm an Höhe und schwindelerregender Glätte übertraf. Sie stand da oben wie die Ikone einer Alpinistin, gestikulierte, schrie, jauchzte, dass die Berge von den Echos ihrer Freude widerhallten. Das ganze Tal zitterte in der Erkenntnis ihrer Befreiung.
Sie kam wieder herunter, kam über die Wiese gelaufen. Ich sah wie sie strahlte. Alles war gut. Worte waren nicht nötig. Sie riss sich das Unterzeug vom Leib und stellte sich unter den Wasserfall, um eine Naturdusche zu nehmen. Dann legte sie sich zum Sonnenbad an die Böschung der Moräne. Mir war es draußen zu grell. Die Sonne stach. Ich ging ins Zelt.