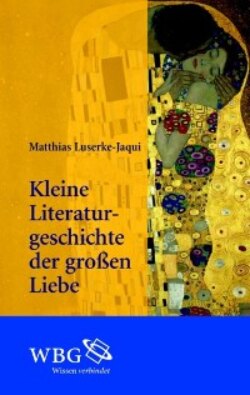Читать книгу Kleine Literaturgeschichte der großen Liebe - Matthias Luserke-Jaqui - Страница 11
„Liebe, der schönste Text“. Modelle der Deutung
ОглавлениеDiskurstheorie, Poststrukturalismus – Systemtheorie – Kultursoziologie, Medientheorie – Psychoanalyse – Kulturgeschichte der Literatur
Wenn Liebe wirklich der schönste Text ist, wie es bei Schiller heißt, dann stellt sich doch die Frage, ob es nicht eine dazu passende Texttheorie oder Philosophie gibt, die gleichsam als Schlüssel zum Verstehen dienen könnte. Gibt es aber tatsächlich eine Theorie der Liebe oder gar eine Philosophie der Liebe oder der Wollust? Eine ‚Literaturwissenschaft der Liebe‘ jedenfalls existiert nicht, wie ein Zeitgenosse festgestellt hat. Und doch lohnt es sich, einen Blick auf die Beiträge einiger Diskutanten zu werfen, die aus höchst unterschiedlichen Perspektiven und mit teils sehr differenten methodologischen Zugangsweisen der Liebe zu Leibe rücken.
Diskurstheorie, Poststrukturalismus
Der französische Literaturtheoretiker Roland Barthes veröffentlichte 1977 sein Buch Fragmente einer Sprache der Liebe, worin er konsequent die Konzentration auf den Diskurs der Liebe zur Anschauung bringt. Dies im wörtlichen Sinn, denn bereits auf der handwerklich-strukturellen Ebene seines Buchs verweigert er jedwede Form von Sinnsuche, um die Fokussierung auf die Liebe als „Deklamation einer bereits vollzogenen [. . .] Tatsache“ zu optimieren. Damit er als Autor der Versuchung einer Suche nach Textsinn widerstehen konnte, so schreibt er, sei es erforderlich gewesen „eine absolut bedeutungslose Gliederung zu wählen“.1 Dies erklärt die nicht weiter durchschaubare Lemmatisierung seines Buchs, das in einzelnen Artikeln über den Liebesdiskurs aufgeht und von A wie Abhängigkeit bis Z wie Zugrundegehen reicht. Barthes beklagt zu Recht, dass sich der leidenschaftlichen Liebe heutzutage kein Denksystem mehr annähme2 und wiederholt unwissentlich damit einen Aphorismus von Schlegel: „Es giebt noch keine Philosophie der Liebe; vielleicht ist sie nicht bloß der beste sondern der einzige Gegenstand der Romanpoesie“,3 obwohl er – mit Blick auf seine Lucinde – eine „Philosophie der Wollust“4 durchaus festzustellen vermag.
Wenn Johann Christoph Rost in seinem anonym erschienenen Gedicht Die schöne Nacht (1754) im Hinblick auf eine amouröse Situation schreibt – und die Leser haben tatsächlich ein entsprechendes, mit heutigen Maßstäben gemessen harmloses Kupfer vor Augen –:
Weg war die Hand, das heißt: Sie war nicht mehr zu sehen,
Was im Geheim mit ihr geschehen,
Das sag’ ich nicht; doch wenn ihr schärfer fragt,
So merkt: es war, was man viel lieber thut, als sagt [. . .],5
dann lenkt er den Blick gerade auf das Nichtgesagte. Die Verweigerung der Beschreibung ist bereits selbst wieder Bestandteil einer Beschreibung. In das Feld einer Untersuchung über den Liebesdiskurs, also über die Frage, wie reden und schreiben die Menschen über Liebe und was verschweigen sie darüber, gehört zweifelsohne das unvollendet gebliebene Spätwerk Sexualität und Wahrheit (Bd. 1 1976, Bd. 2 u. 3 1984)6 von Michel Foucault. Die darin vorgetragene, von Foucault sogenannte Repressionshypothese bildet den Grundstein, auf dem sich sein dreibändiges Werk aufbaut. Ins Zentrum seines Interesses stellt Foucault das Beziehungsgeflecht von Macht, Wissen und Sexualität. Gegen die herkömmliche Lesart, dass dieses Beziehungsgeflecht auf Repression basiert und repressiv wirkt, stellt Foucault die Repressionshypothese, die besagt, dass es im Interesse von Macht liegt, Sexualität nicht zu unterdrücken, sondern sie erst auf vielfältige Weise zu diskursivieren, also sprachlich zu vergegenständlichen. Zugespitzt könnte man sagen, dass die Repression von Sexualität erst den (auch emanzipativen) Diskurs über die Unterdrückung der Sexualität hervortreibt. Foucault interessieren aber nicht die Gründe für die Unterdrückung von Sexualität, sondern allein die Gründe dafür, weshalb wir Menschen so nachdrücklich die Tatsache betonen, dass unsere Sexualität unterdrückt wird.7 Er untersucht in der historischen Analyse der „‚Diskursivierung‘ des Sexes“ die „‚polymorphen Techniken der Macht‘“.8 Das bedeutet nun nicht, dass Foucault die Geschichte der Verbote, Verneinungen, Ausgrenzungen und Unterdrückung von Sexualität infrage stellt oder gar leugnet. Vielmehr gewichtet er diese Tatsachen anders.
Während die Vertreter der Repressionshypothese in der Negation von Sexualität den zentralen Schaltmechanismus für die Unterdrückung der Sexualität sehen, erkennt Foucault darin nur eine Taktik der Vorrichtung mit operativer Absicht innerhalb einer übergeordneten ‚Diskursstrategie‘. Diese beschreibt er als Techniken der Macht und als Willen zum Wissen, die sich beide keineswegs in der bloßen Repression der Sexualität erschöpfen. Foucault schreibt die Geschichte von Sexualität und Wahrheit gleichsam „im Rücken der Repressionshypothese“9 als eine Geschichte der Instanzen der Produktion von Diskursen, von Macht und von Wissen. So ziele beispielsweise die Diskursivierung von Sexualität seit Ende des 16. Jahrhunderts auf eine Vielfalt von unterschiedlichen Diskursen. Diese diskursive Überproduktion lasse sich nicht mit einer zunehmenden Repression erklären. Und auf der anderen Seite münde der Wille zum Wissen schließlich in eine Wissenschaft von der Sexualität, die sich in der Verlaufsgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft konstituiert.
In jeder Gesellschaft werde die Produktion eines Diskurses kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert. Die Steuerungsmechanismen übernehmen dabei bestimmte externe Prozeduren, die unmittelbar auf den Prozess des Diskurses einwirken. Eine solche Prozedur ist beispielsweise die Ausschließung wie ein Verbot, die Vernunft-Wahnsinn-Antinomie oder das Grundgesetz der zweiwertigen Logik, die Wahr-Falsch-Antinomie. Auf dem Weg der Analyse von Verboten gelangt man zur Einsicht in das Verhältnis von Macht und Begehren, das den Diskurs bedingt. Ein Diskurs ist zugleich auch Gegenstand des Begehrens und wird zur Schnittstelle von Macht und Begehren. In diesem Zusammenhang muss man wohl Foucault recht geben, der in einem Gespräch mit Gilles Deleuze 1972 gesagt hatte, „das Begehren wird noch lange ein Problem sein“.10
Die drei Ausschließungssysteme (das verbotene Wort, die Ausgrenzung des Wahnsinns und der unbedingte Wille zur Wahrheit) treffen einen Diskurs zentral. Insbesondere der fiktionale Diskurs der Literatur ist von der Ausschließungsprozedur ‚Wille zur Wahrheit‘ nachhaltig betroffen, intendiert er doch das eigentlich Unwahre. Neben diesen Prozeduren, die einen Diskurs äußerlich betreffen, gibt es die internen Prozeduren, mit denen die Diskurse sich selbst kontrollieren. Dazu zählt Foucault den Kommentar, den Autor und die Disziplinen. Die Funktion der internen Prozedur Kommentar besteht darin, das Prinzip der Abstufung von Primärtext und Sekundärtext aufrechtzuerhalten. Auf ein und denselben literarischen Text können sich beispielsweise zwei völlig verschiedene Diskurstypen des Kommentars beziehen.11 Der Kommentar lebt von dem Paradox, dass er das erstmals zur Sprache bringen muss, was im Primärtext nicht gesagt, aber doch enthalten ist, und zugleich muss er das beständig wiederholen, was im Grunde nie gesagt wurde. Den literarischen Texten bescheinigt Foucault einen „merkwürdigen Status“12 zwischen den Alltagsdiskursen und den dauerhafteren Diskursen religiöser und juristischer Texte. Das neben dem Kommentar zweite Verknappungsprinzip eines Diskurses betrifft die Autorfunktion, wie sie von der jeweiligen Schreib- und Zeitsituation vorgeschrieben wird. Foucault geht es nicht darum, die Tatsache eines schreibenden und kreativen Individuums zu leugnen. In seinem Vortrag Was ist ein Autor? (1969) hatte er zu dieser Frage ausführlich Stellung genommen und die Autorfunktion als die Existenz-, Distributions- und Funktionsweise von bestimmten Diskursen charakterisiert. Sehr ausgeprägt ist diese Funktion bei literarischen Diskursen.
Die letzte interne Prozedur betrifft die sprechenden Subjekte. Der Eintritt in die Ordnung des Diskurses wird durch bestimmte Auswahlkriterien geregelt, nicht jedes sprechende Subjekt kann an jedem Diskurs partizipieren.13 Dass darin wiederum Mechanismen von Macht und Begehren eingeschrieben sind, liegt auf der Hand. Rituale, Diskursgesellschaften, der Prozess der gesellschaftlichen Aneignung von Diskursen und Doktrinen regeln den freien oder eingeschränkten Zugang zu den Diskursen. Insbesondere fordern die Doktrinen eine doppelte Unterwerfung: einmal die Unterwerfung der Subjekte unter die Diskurse, zum anderen die Unterwerfung der Diskurse unter die sprechenden Subjekte. Dazu gehören beispielsweise Formen der familialen und gesellschaftlichen Erziehung.
Aus Foucaults Untersuchung kann man für eine Bewertung des Liebesdiskurses die Erkenntnis gewinnen, dass die Literatur eine spezifische, nämlich zivilisatorische Funktion übernimmt. Diese besteht in der Bändigung der Liebe, und der Diskurs ist der Ort dieser Bändigung. Eine der vielen Quellen aus dem 18. Jahrhundert formuliert dies folgendermaßen: Lesen – und damit Schreiben – könne nicht nur die Empfindung für das Gute und Schöne schärfen, das Herz veredeln und den Verstand aufklären, sondern könne „alle Triebfedern der Seele in Bewegung setzen“.14 Das schreibt Gottfried Benedict Funk in der Zeitschrift Nordischer Aufseher von 1762. Der Herausgeber Johann Andreas Cramer hatte am gleichen Ort den aufgeklärten Poetikstandard wiederholt, wonach der Dichter „die stärkern Leidenschaften der Seele erschüttert“ und dadurch nach und nach bei den Lesern der „Geschmack gereinigt und erhöht“ würde. Das Wissen, dass Poesien mehr „Gewalt über das Herz“ hätten „als andere Schriften“,15 gehörte zum Allgemeingut derer, die sich an der Diskussion über Leidenschaften und der Frage ihrer Bändigung beteiligten.
Systemtheorie
Niklas Luhmann versucht in seinem Buch Liebe als Passion (1982) nichts Geringeres, als die Frage zu beantworten, weshalb Menschen immer wieder beginnen sich zu lieben, obgleich sie wissen, dass die Liebe vergänglich ist. Er möchte die Motivlage nicht anthropologisch, „erst recht nicht durch den kruden Hinweis auf Bedürfnisse nach sexueller Befriedigung“ erklären, sondern er beabsichtigt vielmehr in seiner Studie, historische Perspektiven mit theoretischen zu verbinden. Die anfänglich so banale Frage nach dem Warum einer Liebesbeziehung liest sich dann, in die mechanistisch-technizistische Sprache der Luhmann’schen Systemtheorie übertragen, so:
Sie kombiniert gesellschaftstheoretische, evolutionstheoretische, kommunikationstheoretische und attributionstheoretische Ausgangspunkte im Begriff des symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums und verknüpft dann diesen Theorieansatz mit Untersuchungen über Ideenevolution, das heißt über Evolution im Kontext einer historischen Semantik, die in Abhängigkeit von Möglichkeiten, die die gesellschaftsstrukturelle Entwicklung bietet, auf Erfahrungen mit ihrem jeweiligen Ideengut in der kommunikativen Praxis reagiert.16
Für unseren Zusammenhang ist nicht die theoretische Tragfähigkeit dieses Ansatzes relevant. Interessant für die Untersuchung des Verhältnisses von Literatur und Liebe ist allein die Bedeutung und Rolle, die Luhmann in seinem Buch der Literatur zumisst. Besonders fällt auf, dass die Beispiele, die er anführt, nahezu ausnahmslos der englischen oder französischen Literatur entnommen sind. Der Abstraktionszwang, unter den sich Luhmann selbst stellt, verleitet ihn dazu, Entwicklungen in der deutschsprachigen Literatur und ihre sozialen und historischen Signifikanzen zu ignorieren. Auch seine spärlichen Rückgriffe auf Forschungsliteratur beziehen sich fast durchweg auf völlig veraltete Darstellungen. Die einschlägige literaturwissenschaftliche Forschung erwähnt er nicht.
„Die wohl wichtigsten Veränderungen“, die sich im 18. Jahrhundert vollziehen, betreffen nach Luhmann die Sexualität. Eine gesteigerte soziale Reflexivität habe „die Befreiung der Sexualität eingeleitet“,17 behauptet der Autor und stützt sich dabei ausschließlich auf französische Romane. Dies widerspricht anderen Forschungen, die gerade in der Inflationierung von Sexualitätsdiskursen eine zunehmende, verfeinerte Repressionsapparatur sehen. Auch Luhmanns Äußerung, dass sich im 18. Jahrhundert eine „Verlagerung der literarischen Quellen von der direkten Sachaussage in den Roman“18 vollziehe, ist auf die Sexualität bezogen so nicht richtig.
In der Neukodierung von Sexualität im ausgehenden 18. Jahrhundert sieht Luhmann eine sich abzeichnende „Neutralisierung der Schichtdifferenzen“. Dass Sexualität auch ein Machtdispositiv ist, bleibt dabei unberücksichtigt. „Meine Vermutung ist, dass über die Aufwertung der Sexualität dann auch die Konkurrenz von ‚Liebe‘ und ‚Freundschaft‘ als Grundformeln für eine Codierung der Intimität entscheidbar wird. Liebe gewinnt. Am Anfang des 18. Jahrhunderts sind beide Formeln am Start mit je unterschiedlichen Chancen“. Luhmann macht einen „Veredelungsprozeß“ aus, wonach Sexualität durch Freundschaft aufgewertet wird, dessen institutionell teleologisches Ziel die Ehe sei. Historisch nicht zutreffend urteilt Luhmann: „Mit Rührung stellt man fest, daß die gleichen Tendenzen zur sexuell basierten Liebesehe sich auch in den unteren Ständen beobachten lassen“. Der Autor meint, dass noch vor der Romantik „deutliche Tendenzen zu einer neuen Synthese“ von Liebe, Ehe und Sexualität erkannt werden könnten, die für alle Stände gälten.19
Als die herausragende Leistung des 18. Jahrhunderts betrachtet Luhmann die Entdeckung der „Inkommunikabilität“. Die Erfahrung von Inkommunikabilität falle dort an, „wo immer Moral auf Begriffe gebracht wird, die in der Kommunikation kontraintentional wirken“. Dem ist allerdings entgegen zu halten, dass gerade im 18. Jahrhundert der Prozess einer umfassenden Diskursivierung von Leidenschaften, mithin von Liebe und Sexualität in der fiktionalen und nicht-fiktionalen Literatur einsetzt. Die große Entdeckung des 18. Jahrhunderts ist also gerade die Diskursivierbarkeit und nicht die Inkommunikabilität. Welche gesellschaftliche Funktion diese Diskursproduktionen erfüllen, bleibt bei Luhmann ungeklärt, ebenso dunkel bleibt auch die Behauptung, es sei „kein Zufall, daß auf die Erfahrung der Inkommunikabilität die Romantik folgt“. Als Ergebnis verfestigt sich der Eindruck, dass die banale Frage, von der Luhmann ausgegangen war, auch eine banale Antwort erfährt: „Das Vom-anderen-erlebt-Werden wird zur Komponente operativer Reproduktion. Selbstreproduktion und Fremdreproduktion bleiben nach Systemkontexten getrennt und werden doch uno actu vollzogen“.20
Dieses Resümee nährt den Verdacht, dass es bei Luhmanns Untersuchung über die Liebe und ihre Systembedingungen im 18. Jahrhundert eigentlich nicht um die Liebe ging. „Geht man vom Postulat funktionsspezifisch ausdifferenzierter selbstreferentieller Sozialsysteme für Intimbeziehungen zwischen jeweils zwei Personen aus und versteht man Intimität als Interpenetration, kann man rückblickend sondieren, ob und in welchen Hinsichten die semantische Tradition des amour passion und der romantischen Liebe dafür Orientierungsvorlagen geliefert hat“.21 Menschliches Handeln und Sprechen wird so auf systemische Größen normiert und quantifiziert und geht dadurch jeder humanen Tradition der Aufklärung verlustig. Nicht Intimität wird gesellschaftlich kodiert, sondern ein gesellschaftlicher Kode wird intimisiert. Das ist eine andere Perspektive und unterschlägt nicht mehr den individuellen, rebellischen, anarchischen und mithin subversiven Anteil der Liebe.
Schon früh hat Julia Bobsin auf die Probleme einer systemtheoretischen oder diskursanalytischen Explikation des Liebesmodells hingewiesen, da bei diesen Verfahren – aufgrund ihres weit ausladenden Theoriezuschnitts – der einzelne literarische Text nur noch als Beispiel einer spezifischen fiktionalen Liebeskonstellation diene.22 So kann Bobsin beispielsweise über Schlegels Roman resümieren: „In der Lucinde sind die Probleme der Sexualität und der Subjektkonstitution in der Codierung der Liebesehe berücksichtigt“. Bobsin sieht in der Lucinde gewissermaßen einen utopischen Überschuss, wenn sie bemerkt, der Text enthalte „Aspekte einer Liebessemantik von Gleichheit und selbständiger Partnerschaft, die über das trivialisierte Modell der romantischen Liebe, wie sie bis Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts gültig war, hinausweisen.“ Schlegels Ehemodell, wie es die Lucinde offeriere, zeichne sich gerade durch die unaufhebbare Verbindung von Sexualität und Individualität aus und klammere soziale Rücksichten aus.23
Über das geradezu magische Schwellenjahr 1800 liest man dann bei Jutta Greis: „An diesem historischen Punkt ist die expandierende Evolution des literarischen Liebestopos vorläufig abgeschlossen in dem Sinn, daß ein semantisches Feld abgesteckt und in seinen Möglichkeiten erprobt wurde.“24 Sie spricht im Anschluss an Luhmann von einer neuen Formierung der Liebessemantik im 18. Jahrhundert, die in der Identitätsbildung von Liebe und Ehe gipfelt.25 Allerdings sei diese Kongruenz nur semantisch nachweisbar, und doch spricht Greis von deren „Kulturmächtigkeit“,26 die der Ausgangspunkt weitreichender sozialer Umstrukturierungen sei.
Niels Werber verleiht diesen systemtheoretischen Überlegungen in seiner Arbeit Liebe als Roman ein kritisches Gegengewicht, allerdings löst auch er das offensichtliche Grundproblem nicht. Er stellt seinem Buch einen umfänglichen Forschungsbericht voran, der auch die systemtheoretischen Fehlschlüsse Luhmanns nochmals kritisch benennt, obgleich der Autor seine These von literarischer und intimer Koevolution auf einen systemtheoretischen Ansatz aufbaut. Werber bilanziert die Forschung, dass Einigkeit in der Annahme bestehe, die gesellschaftliche Modernisierung finde in der Liebessemantik eine kompensatorische und therapeutische Funktion.27 Das Phantasma der Paarintimität wappne gegen die Schrecken und Unbillen der modernen Gesellschaft.
Werber kritisiert diese gängige These zu Recht: „Die Überzeugungen solcher Aussagen entstammen freilich derselben Semantik, die es soziologisch zu analysieren gälte“. Aus dem Blickwinkel einer Systemtheorie der Liebe eigne intimen Systemen eine doppelte, nämlich psychische und soziale Funktion. Nach Ansicht Werbers gibt es in der Literatur des 18. Jahrhunderts ein Wissen um die soziale Kodierung von Liebe, das aber nur dann in den Blick wissenschaftlicher Expertise zu rücken vermag, wenn man sich nicht mit den Fragen der Ehe (als Liebes- oder als Konvenienzehe), sondern der Eheanbahnung – also herkömmlicherweise dem Prozess der Liebe – beschäftigt. Davon zeugten die Liebesromane: „Der Roman erfüllt [. . .] den Wunsch nach einem authentischen Einblick in die Seele des Menschen und muß zugleich mit der Unmöglichkeit zurechtkommen, die Differenz von Kommunikation und Bewußtsein diesseits des Fiktionalen je aufzuheben“.28
Damit benennt Werber aber selbst das Grundproblem seines Ansatzes: Wie lässt sich über intime Kommunikation anders berichten, als eben literarisch, sofern keine sozialwissenschaftlichen Feldstudien betrieben werden sollen, die historisches Material ohnehin nicht erfassen? Demzufolge werden drei Stilarten intimer Kommunikation bestimmt: die höfische Galanterie, die bürgerliche Konvenienzehe und die naive Hingabe. Über Schlegels Roman bemerkt Werber: Der „von der Romantik oft beschworene Geist, der die Textelemente zu einer Einheit verbindet, hat in Schlegels Lucinde die Gestalt der Liebe angenommen.“
Natürlich hat Werber recht, wenn er betont, „[. . .] eine Literaturwissenschaft der Liebe existiert nicht“. Doch zeigt gerade Schlegels Lucinde, dass die nachfolgende Bemerkung nicht zutreffend ist: „Liebe ist nicht Literatur, wohl aber gibt es eine literarische Reflexion der Liebe. Und als Roman wird die Liebe zum Objekt der Literaturwissenschaft“.29 Im Gegenteil, Liebe ist Text jenseits jeglicher Gattungsverengung. Obwohl Werber die Bedeutung und damit die Gefahren einer Vereinseitigung der Gattungstypologie kennt, verschafft er dennoch dem Roman einen exklusiven Status, der ihm möglicherweise nur quantitativ zusteht, der letztlich aber nicht mehr aussagt über den historischen Wandel intimer Kommunikation in der Literatur als vergleichbare dramatische und lyrische Dokumente.30
Um den Gefahren von Ontologisierungen und ins Uferlose hinauswachsenden Überzeichnungen, die als Hypothesen attraktiv, als Arbeitsgrundlage aber wenig brauchbar sind, vorzubeugen, tut ein gattungstypologisch offener und historisch unvoreingenommener Blick in die Literaturgeschichte not.
Kultursoziologie, Medientheorie
Eine interessante, weil ungewöhnliche Analyse des kulturgeschichtlichen Modells der romantischen Liebe liefert Eva Illouz in ihrer kapitalismuskritischen Studie Der Konsum der Romantik (1997), wobei sie vornehmlich die Produktionsbedingungen des Modells und deren gesellschaftliche Anverwandlungen kultursoziologisch analysiert. Illouz verfolgt die These, romantische Liebe sei eine „kollektive Arena, in der die sozialen Teilungen und kulturellen Widersprüche des Kapitalismus ausgetragen werden“. Das Gefühlsmodell ‚romantische Liebe‘ entpuppt sich so als transformiertes Warenmodell. Kulturelle Rahmenbedingungen benennen dieses Gefühl, sie „spezifizieren die damit verbundenen Normen und Werte und liefern Symbole und kulturelle Szenarien, die das Gefühl gesellschaftlich kommunizierbar machen“ – ergänzen müsste man: konsumierbar machen.31 Sie definiert die moderne – gelegentlich auch postmodern genannte – romantische Liebe mit dem demokratischen Ideal der freien Objektwahl, der Grenzüberschreitungen und der Lustmaximierung als eine kulturelle Praxis, die maßgeblich von der spätkapitalistischen politischen Ökonomie geprägt und gesteuert ist.32 Zugespitzt formuliert, könnte man sagen: Die Liebe dient als Körper des Kapitals.
Genährt würde die Hypothese von Illouz durch einen Blick in die Literaturgeschichte, allerdings wählt der Dichter Schiller ein vorkapitalistisches Beispiel, er vergleicht die Liebe mit einem Tauschgeschäft. In den Ästhetischen Briefen schreibt er: „Aus ihren düstern Fesseln entlassen, ergreift das ruhigere Auge die Gestalt, die Seele schaut in die Seele, und aus einem eigennützigen Tausche der Lust wird ein großmüthiger Wechsel der Neigung. Die Begierde erweitert und erhebt sich zur Liebe [. . .]“.33 Kulturgeschichtlich ist dagegen aber einzuwenden, dass die Maximierung von Lust seit jeher zur großen Liebe im Liebesdiskurs gehört, weit vor Entstehung des Kapitalismus wird der Konnex von maximaler Lust und großer Liebe beschworen, summarisch sei hier auf Enea Silvio Piccolominis Liebesnovelle Euryalus und Lucretia verwiesen. Im Spätkapitalismus kommt das Modell romantische Liebe als Massenmedium und Kitschidentität hinzu. Allerdings sollte man dies sorgfältiger psychoanalytisch und psychohistorisch reflektieren.
Illouz verbindet ihre Beschreibung mit einer Kritik an Luhmanns Theorie des symbolischen Kodes, der sie die Ontologisierung einer Referenz vorwirft, ohne den dazugehörigen Referenten und seine kulturellen Prägungen und Abhängigkeiten zu berücksichtigen. Während Luhmann von der Prägung der Gefühle durch kulturelle (literarischfiktionale) Kodes ausgeht, wonach die Gefühle diese Kodes abbilden, dreht Illouz die Perspektive um und untersucht das Gefühlsmodell ‚romantische Liebe‘ als Medium einer spätkapitalistischen Indienstnahme, wonach die Fiktion keineswegs die Erfahrung ersetzt hat.34
Ist die Bedeutung der medialen Wahrnehmung von Sexualität, Paarintimität und Liebeskodierung in den bisherigen Untersuchungen kaum zur Sprache gekommen oder allenfalls als Randphänomen notiert, so spricht nun Linda Hentschel in ihrem Buch Pornotopische Techniken des Betrachtens (2001) von der geschlechtlichen Kodierung des medialen Raums. Sie erarbeitet eine Leitthese, mit der sie diese Behauptung prüft. Die „metonymische Überlagerung von medialem Raum und weiblichem Körper“ sei Bestandteil einer „aktiven Erziehung zur Skopisierung des Begehrens“, was letztlich auf eine Schulung der Schaulust hinauslaufe. Der visuelle, mediale Raum werde dadurch zunehmend so sexualisiert, dass der Betrachter sich gegenüber dem Bild oder dem Raum insgesamt wie einer Frau gegenüber positioniere. Dieses Verfahren nennt sie die ‚pornotopische Technik des Betrachtens‘; „die Interaktion zwischen Betrachter, seinem Körper und dem Bildraum [kann] analog der Sextechnik der Penetration strukturiert werden“.35
Psychoanalyse
„Liebe sei eine Leidenschaft“, schreibt Montaigne in den Essais, „die aus einer Mischung besteht von recht wenig wirklicher Substanz und viel mehr Hirngespinsten und unruhiger Erwartung“.36 Julia Kristeva untersucht diesen Sachverhalt in ihrem Buch Geschichten von der Liebe (1983) mit psychoanalytischem Interesse und entwickelt die These, dass Liebe eine Melange aus Wahn und Idealisierung sei. Die Liebe herrsche im Zwischenreich zwischen Narzissmus und Idealisierung. Sie entwickelt diese These in der Analyse der großen Figuren abendländischer Liebe: griechischer Eros, jüdische Ahav, christliche Agape sowie an Narziss, Don Juan, Romeo und Julia und der Jungfrau Maria. Die Sprache der Liebe, so führt Kristeva aus, sei Literatur, da sie Metaphern freisetze.37
Das ist eine starke These, denn umgekehrt heißt dies: Wenn Liebe spricht, generiert sie Literatur. In der Literatur der Moderne gehe die Metapher sogar zunehmend in die „narrative Ellipse über, eine Variante der Verdichtung“38 und eine Folge der Lockerung der Überichzensur. Das Brennen des Begehrens offenbare sich in den Zeichen des Nichtgesagten. Das Nichtgesagte sei das Reale. Wird diese These in einem ersten Schritt an Liebes-Texten der Moderne geprüft, müssen sich Zweifel einstellen. Denn schon zum Ende des 19. Jahrhunderts hin nehmen die Versuche zu, eine eigene exakte Sprache der Liebe zu finden. Wenn man allerdings den Blick nur über die Höhenkämme der Literatur schweifen lässt und nur Namen wahrnimmt wie Joyce (obgleich auch hier Mollys Schlussmonolog im Ulysses (1922) Kristeva widerspricht), Flaubert oder Schnitzler, entsteht ein falsches Bild.
Richtet man sodann den Blick auf historische Liebes-Texte, wird Kristevas These vollends unhaltbar, da es – seit es Literatur gibt – je schon Versuche gegeben hat, das Reale – und das meint in der psychoanalytischen Lesart Kristevas das Sexuelle – zu benennen. Die Geschichte der Literatur bewahrt diese Versuche als eindrucksvolle Dokumente. So enthusiasmiert sich beispielsweise ein anonymer Barockdichter in seinem Gedicht auf die Vulva (Auff ihre S====) aus den Deliciae Poeticae (1728) als dem „schöne[n] Lust=Revier“: „Mich hat ein freyer Griff gefangen und gebunden, [/] Der Schlitz den ich berührt macht meinen Hertzen Wunden“.39 Und ein erotisches Epigramm des griechischen Dichters Rufin aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert jubelt: „Glücklich, wer dich erblickt, dreimal glücklich, wer dich hört, / Halbgott, wer dich küsst, unsterblich, wer mit dir schläft“.40 Und bei Catull liest man 55 v. Chr. über ‚das Reale‘:
Und wenn du das willst, sorge dafür,
daß keiner an der Schwelle die Tür verriegelt
und auch du nicht Lust bekommst auszugehn,
sondern zu Hause bleibst und uns bescherst
neun Fickereien in direkter Folge.41
Kristeva löst in ihrer Argumentation den Begriff der Liebe vom Begriff des Liebeskodes. Über die Freiheit des Individuums, die Liebe jedesmal neu oder ein für allemal zu erfinden, schreibt sie: „Die Liebe ist die Zeit und der Raum, in denen sich das ‚Ich‘ das Recht nimmt, außergewöhnlich zu sein. [. . .] In der Liebe bin ich am Gipfel der Subjektivität“. Kristeva vertritt die Ansicht, dass wir heutzutage über keinerlei Liebeskodes mehr verfügen. Darunter versteht sie „keine stabilen Spiegel für die Liebe in einer Epoche, innerhalb einer Gruppe, einer Klasse. Die Couch des Analytikers ist der einzige Ort, an dem der Gesellschaftsvertrag ausdrücklich eine – freilich private – Suche nach Liebe gestattet“. Kristeva spricht auch von Liebeskrisen und Liebesmängeln, die unser Leben kennzeichneten. Auf der Suche nach neuen Liebeskodes seien unter anderem auch heterosexuelle Paare, die sie erstaunlicherweise als eine gesellschaftliche Randgruppe und „Dissidenten der öffentlichen Moral“42 bezeichnet.
Die Geschichte der Literatur, die ja nach der Eingangsthese Kristevas auch eine Geschichte der Liebe darstellt, malt ein anderes Bild. Denn ist es nicht viel mehr so, dass gerade die Moderne von der permanenten Suche nach der Geltung differenter Liebesmuster und Liebeskodes gekennzeichnet ist? Und wendet man dies historisch, steht das Paarmodell einer großen Liebe seit je in der Auseinandersetzung und Konkurrenz mit den herrschenden Liebeskodes und sucht gerade darin nach eigenen, individuellen Ausprägungen. Der Konflikt mit der herrschenden Moral markiert nicht die endgültige Grenze einer großen Liebe, sondern prägt stets die Herausforderung, nach einer Überbietung zu suchen, sei sie nun als Glückserfüllung oder als Scheitern gelebt. Und obwohl Kristeva zu dem Ergebnis kommt, dass wir heute über keinen Diskurs der Liebe mehr verfügen, endet ihr Buch doch halbwegs versöhnlich in der Bemerkung: „Die Psychoanalyse führt also nicht nach der höfischen Minne, dem Libertinismus, der Romantik und der Pornographie einen neuen Code der Liebe ein. Sie unterstreicht das Ende der Codes, aber auch das Fortdauern der Liebe als einer Baumeisterin von Sprachräumen“.43
Kulturgeschichte der Literatur
Eine Literaturgeschichte der Liebe könnte sich als ein Glanzstück einer allgemeinen Kulturgeschichte der Literatur erweisen, da hier anthropologische, soziale und ästhetisch-literarische Fragestellungen und Aufgaben in besonderer Weise ineinander greifen. Eignet sich Liebe als Paradigma einer performativen Wende in der Literaturwissenschaft? Da dies den Rahmen des vorliegenden Essays vollkommen sprengen würde, sollen nur ein paar wenige Stichworte eines Aufrisses genügen.
Das Paradigma einer kulturwissenschaftlichen Germanistik war zum Ende des vergangenen Jahrhunderts nicht neu.44 Neu war aber der Versuch, die Germanistik neben den etablierten kulturwissenschaftlichen Theoriefeldern in Volkskunde, empirischer Kulturwissenschaft, Geschichte, Soziologie und Philosophie aufzustellen und theoriegeleitet diese Neuorientierung zu begleiten. Auf der Grundlage des Buchs Was ist Kulturgeschichte? (2005) von Peter Burke lässt sich ein Umriss erahnen, wie eine Kulturgeschichte der Liebe ausfallen könnte, gewissermaßen eine Zwischensumme versuchen.45 Unter der Überschrift Die Große Tradition referiert Burke zunächst historische Aspekte einer Kulturgeschichte, die großen Traditionen der allgemeinen Kulturgeschichte werden aufgeführt, und die Wiederentdeckung der Kulturgeschichte in den 1970er-Jahren wird gewürdigt.
Karl Lamprecht stellte 1897 erstmals die Frage: ‚Was ist Kulturgeschichte?‘ Der Gegenstandsbereich wurde bis heute sukzessive erweitert, die Frage, was sich innerhalb der Grenzen befindet, bleibt schwer zu beantworten. Deshalb schlägt Burke vor, die Aufmerksamkeit vom Gegenstandsbereich weg auf die applizierten oder propagierten Forschungsmethoden zu richten. Als allgemeine gemeinsame Grundlage aller Kulturhistoriker begreift er das Interesse am Symbolischen. Burke unterteilt vier Phasen einer Geschichte der Kulturgeschichte: Die klassische Phase (das betrifft den Zeitraum von 1800 bis 1950), die Phase einer ‚Sozialgeschichte der Kunst‘ ab 1930, die Phase einer Geschichte der Volks- und Populärkultur in den 1960er-Jahren und die Phase einer „Neuen Kulturgeschichte“.46
Auf eine Kulturgeschichte der Literatur übertragen könnte dies Folgendes bedeuten: In der kulturwissenschaftlichen Germanistik gab es eine erste Phase der Standortbestimmung mit den Leitfragen: Welcher Theorietransfer zwischen Kulturwissenschaften und Literaturwissenschaft könnte gelingen, welche Thementransformationen wären wünschenswert und – vor allem – welche historischen Vorbilder gibt es bereits zu diesem Neuansatz? Im Mittelpunkt stand also die Frage: Was ist eine literaturwissenschaftliche Kulturgeschichte bzw. was ist eine Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft? Diese Phase begann in den 1990er-Jahren und ist inzwischen an ihr Ende gelangt, man könnte sie die informative Phase nennen, die wissenschaftshistorisch und theoriehistorisch ausgerichtet war. Zu erwarten ist nun eine zweite Phase, die sich gleichsam mit der illokutionären Seite dieses Anspruchs befasst, eine Art transformative Phase, die eben erst begonnen hat und die Frage nach der Intentionalität eines kulturgeschichtlichen Paradigmas stellt. Sie fragt: ‚Was will?‘ und ‚Was wird sein?‘ und mündet bestenfalls in eine projektbezogene Arbeit.
Als ‚Probleme der Kulturgeschichte‘ werden bei Burke die Auswahl der Quellen und die Quantifizierung benannt. Kommt es etwa bei größeren Datenmengen zu anderen Schlussfolgerungen? Burke widerspricht der Widerspiegelungstheorie, wonach „die Texte und Bilder einer Zeit unkritisch als Spiegelungen dieser Zeit“47 begriffen werden. Daraus folgt die Dringlichkeit und Sorgfalt der Quellenkritik und der kritischen Inhaltsanalyse. Denn was ein Dokument erzählt, muss noch lange nicht das Erzählte dokumentieren. Burke expliziert die terminologische Differenz von Hoch- und Volkskultur. Der Gegensatz zwischen beiden solle aus pragmatischen Gründen nicht zu scharf herausgearbeitet werden, vielmehr sollten mehr die Kontexte beachtet werden. Schließlich wendet sich Burke dem Kulturbegriff zu. Operationabel sei ein anthropologischer Kulturbegriff, der die Fähigkeiten und Gewohnheiten des Menschen umfasse.48
Eine Kulturgeschichte der Literatur knüpft an das – allgemein gesagt – zivilisationstheoretische Erbe von Norbert Elias an, wonach Kultur als die Gesamtheit menschlicher Lebensäußerungen verstanden und prozessual begriffen wird. Um diesen kulturellen und historischen Transformationsprozessen Rechnung zu tragen, äußert eine Kulturgeschichte der Literatur Vorbehalte gegenüber der Vorstellung, ein objektivierbarer Autorwille sei Gegenstand einer Textinterpretation. Stattdessen stellt eine Kulturgeschichte die Frage: Sind Rückschlüsse aus literarischen Quellen auf nicht-literarische Kontexte und umgekehrt überzeugend, können sie gar methodisch gesichert werden?49 Eine Kulturgeschichte der Literatur nimmt Peter Burkes Bedenken als starkes Argument gegen ein close reading, wie es in narratologischen Ansätzen expliziert wird, ernst. Dabei müssen die Bedingungen der Rezeption und Transformation von Literatur untersucht werden. Die heute gängigen und selbstverständlichen kulturgeschichtlichen Paradigmata von ‚Mikrogeschichte‘ und einer ‚Geschichte von unten‘, die als das Erbe der Sozialgeschichte bezeichnet werden können, werden dabei bewahrt, dies beinhaltet auch die strikte Ablehnung einer Fixierung auf die Literatur des sogenannten Höhenkamms aus ausschließlich ästhetischen Gründen.
Bei der Untersuchung der Bedeutung der Historischen Anthropologie im dritten Kapitel seines Buchs macht Burke auf die Transformation des Kulturbegriffs aufmerksam und betont dessen Pluralisierung. Etwas emphatisch formuliert er: „Wir sind auf dem Weg zu einer Kulturgeschichte aller erdenklichen Gegenstände“50 – Träume, Gefühle, Nahrungsmittel, Gesten, Reisen, Treppen etc. Eine Kulturgeschichte des Kusses wäre bei dieser Aufzählung zu ergänzen,51 und auch eine Kulturgeschichte der Liebe fände sich in dieser Verwandtschaft wieder. Dies wird als die Geburtsstunde der ‚Neuen Kulturgeschichte‘ gefeiert, die zunächst als New Historicism auftrat. Burke nennt dies eine „anthropologische Wende“,52 die auch die Literaturwissenschaft vollzogen habe.
Innerhalb der germanistischen Kulturwissenschaft spricht man inzwischen von einem ‚cultural turn‘. Burke geht auf die zahlreichen Quellen der ‚Neuen Kulturgeschichte‘ ein. Erstmals taucht die Rede von einer ‚New Cultural History‘ 1989 bei Lynn Hunt auf. ‚Neue Kulturgeschichte‘ wird von Burke als die „vorherrschende Form der heute praktizierten Kulturgeschichte“53 bezeichnet. Sie ist gekennzeichnet durch ein starkes Interesse an Theoriebildung, man mag dies durchaus auch als Ausdruck von Strategien der Selbstvergewisserung begreifen. Dies schlägt bis in die Philologien durch, der Aufwand an Theoriesortierung und Theoriebewertung ist relativ hoch und ein charakteristisches Kennzeichen dieser Phase der Kulturgeschichte. Eines der Schlüsselwörter der ‚Neuen Kulturgeschichte‘ heißt Praxis, es geht also beispielsweise dann nicht um eine Geschichte der Theologie, sondern der religiösen Praxis, oder nicht um eine Geschichte der Literatur, sondern um eine Geschichte des Lesens. Die Konzentration gilt der Rezeption als Form kultureller Gebrauchsweisen. In diesen Zusammenhang gehören auch die Arbeiten zu einer Geschichte des Körpers als Leitparadigma, die durch die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft wie Studien zur Affektkontrolle, zum Leidenschaftsdiskurs oder zu Körperbildern, ergänzt werden. Eine Kulturgeschichte der Liebe gehört in diesen Kontext.
Im fünften Kapitel diskutiert Burke die Bedeutung der kulturellen Konstruktion von sozialer Wirklichkeit wie Klasse und Geschlecht, von Denkbildern, von Handlungsvorstellungen oder von Diskursen, die Konstruktion von Identität und die Konstruktion von Geschichte.54 Die Grundprobleme, die sich aus diesen Fragen aber zwangsläufig ergeben, bleiben freilich weiterhin strittig diskutiert: Wer konstruiert, unter welchen Bedingungen, aus welchem Material? Burke spricht von den jüngsten Entwicklungen als von einer „‚performativen Wende‘ in der Kulturgeschichte“.55 Als deren Leitfrage könnte die Frage gelten, was dieses eine Schreiben tut, welches seine Strategien sind, seine Techniken, seine Inszenierung, seine Rezeption und seine Wirksamkeit. So verstanden kann man mit Blick auf die Liebe verallgemeinern: Liebe wird zu einer Art Kulturtechnik.
Burke macht im letzten Kapitel drei Szenarien aus, die durchaus auch einen prognostischen Wert für eine Kulturgeschichte der Literatur bereithalten: 1. Jacob Burckhardts Rückkehr, worunter die Restitution einer traditionellen Kulturgeschichtsschreibung zu verstehen ist. „Eine mögliche Zukunft für die Kulturgeschichte [. . .] ist eine neuerliche Konzentration auf die Hochkultur“.56 Dies führt zu einer Neubestimmung von Hochkultur und zu einer Verlagerung ihrer Merkmale, ein Prozess, wie Burke feststellt, der bereits in Gang ist. 2. Eine weitere Ausdehnung des Gegenstands- und Themenbereichs. Unter anderem werden dabei Politik, Gewalt, Emotionen, sinnliche Wahrnehmungen als neue Gegenstandsbereiche erschlossen. 3. Eine Gegenbewegung zur Reduktion von Gesellschaft auf Kultur. Die Definition von Kultur sei inzwischen zu weit, die Wörter ‚sozial‘ und ‚kulturell‘ seien austauschbar geworden. Eine Verschränkung von Sozialgeschichte und Kulturgeschichte sei nicht rückgängig zu machen. Burke arbeitet hier nochmals scharf die Bedeutung der sozialen Frage auch und gerade einer Kulturgeschichte heraus: Wer rezipiert?57 Neue Quellen bedürften neuer Formen der Quellenkritik und neuer Regeln.
In diesem Zusammenhang kommt Burke am Rande auf den textualistischen Kulturbegriff zu sprechen. Er verweist darauf, dass beispielsweise Historiker und Anthropologen diese Metapher des Lesens von Kultur nicht in gleicher Weise verwenden. Man kann hier ergänzen, dass es selbst unter Historikern, auch unter Literaturhistorikern, keine terminologische und pragmatische Klarheit gibt. Burke kritisiert, die Metapher ‚Kultur als Text‘ garantiere der Intuition einen zu großen Raum dadurch, dass unklar bleibe, wer im Falle zweier kontroverser ‚Lektüren‘ (also Deutungen) tatsächlich die richtige durchführe. Hier könnte möglicherweise die performative Kulturgeschichte weiterhelfen, die gerade auf die Wahr-falsch-Distinktion verzichten muss, will sie denn als eine performative gelten können. Und schließlich benennt Burke die Gefahr der Fragmentierung. Eine Absage an universalistische Zugriffe könnte die Gefahr der dann nur vereinzelt gültigen Schlussfolgerungen zur Folge haben.58 Burke hebt die Bedeutung der Erzählung in der Kulturgeschichte hervor, man spreche in diesem Zusammenhang dann von kulturellen Narrativen, die auch narratologisch interpretiert werden könnten, zugleich lasse sich Kulturgeschichte auch narrativ darstellen.59 Wäre Liebe demnach nur ein Narrativ in unterschiedlichen Kulturen?
Kulturgeschichte ist keine Leitwissenschaft, keine Großtheorie, die weder willens noch in der Lage wäre, alle hegemonialen Theoriebedürfnisse im Wissenschaftsbetrieb zu befriedigen. Eine Kulturgeschichte der Literatur kann als Metabegriff differenter kulturwissenschaftlicher Theorieprofile und Lösungsansätze verstanden werden. Kulturgeschichte zeichnet sich dann durch eine Kombinatorik unterschiedlicher Selbstthematisierungsvorschläge aus. Dadurch bewahrt sich eine Kulturgeschichte der Literatur ihre Anschlussfähigkeit an unterschiedliche Konzeptualisierungsformen von Kultur, von Kulturtheorie, von Kulturwissenschaft. Die klassische sozialgeschichtliche Trias der Bedingungen von Produktion, Distribution und Rezeption von Texten bleibt unabdingbar für die Literaturinterpretation. Durch den Rekurs auf einen textualistischen Kulturbegriff wird das figurative Denken gefestigt, Kulturgeschichte kommentiert den Wandel literaler Kommunikation und erklärt die Transformation von Kulturtechniken.
Zwischen den beiden kulturgeschichtlichen Lagern ‚Buchstabengläubigkeit‘ und Symbolbedeutung wird sich auch die literaturwissenschaftliche Binnendiskussion weiter bewegen, und eine Kulturgeschichte der Literatur wird die symbolische Bedeutsamkeit von Texten und Kontexten methodisch sichern helfen. Damit besinnt sie sich wieder auf das, was von jeher zum Kerngeschäft der Literaturwissenschaft zählte. Die Geschichte der Hermeneutik entwickelte die Lehre vom mehrfachen Schriftsinn, wonach einem Text neben dem sensus litteralis, also dem wörtlichen, buchstäblichen Verstehen, stets auch ein sensus spiritualis, also eine symbolische Bedeutung, eingeschrieben ist. Die symbolische Bedeutungsebene des Textes erschöpft sich nicht in der Materialität der Zeichen. Es geht also beim kulturgeschichtlichen Kontextualisieren um jene Textebene, von der Schiller 1797 spricht, als er „eine Symbolische Bedeutsamkeit“60 von Texten fordert, Texte seien „in Chiffern verfaßt“ und man müsse sie „dechiffrieren“,61 wie er im Geisterseher schreibt. Später wird auch Rainer Maria Rilke im Jahr 1893 die „andere, symbolische Bedeutung“62 von Texten betonen.
Wo Liebe ist, ist Kultur, friedfertige Kultur. Liebe ist eine Kulturtechnik, Liebe ist mehr als der aktive Beitrag der Natur zur Aggressionshemmung, um es evolutionsbiologisch auszudrücken, und Liebe ohne Intimität gibt es nicht, und davon berichtet die Literatur. Liebe ist, wie es nüchtern im Grimm’schen Deutschen Wörterbuch heißt, „in anderm sinne leidenschaft, als das sinnliche, gegenüber dem geistigen und herzlichen der liebe“.63 Eine kleine Literaturgeschichte der großen Liebe ist also auch eine kleine Kulturgeschichte der großen Liebe.