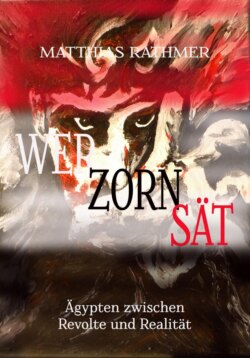Читать книгу Wer Zorn sät - Matthias Rathmer - Страница 7
2
Zwei und zwei sind weiß ich nicht
Оглавление„Wie viel sind zwei und zwei?“ fragt Lehrerin Rania in die Runde, greift ein Stück Kreide und schreibt die Zahlen auf die Tafel. Die Schwingung und der Winkel ihrer Niederschrift auf das Dunkelgrün erzeugen augenblicklich ein schauderhaftes Quietschen.
Wie die Orgelpfeifen sitzen alle im Klassenraum. Die Kleinen vorne, die Großen hinten. Dazwischen die, die sich schon immer unsicher waren, wo ihr Platz ist. Den Tisch- und Stuhlgruppen sieht man an, dass sie von überall her zusammengesammelt worden sind. Es ist hell und sauber im Raum. Trotz der Hitze draußen ist die Betriebstemperatur erträglich. Selbstgemalte Bilder hängen an der Wand, Zahlenreihen auf Arabisch und Plakate der Hilfsorganisation.
Ein paar Schüler stöhnen wegen der fiesen Trommelfellreizung kurz auf, andere halten sich die Ohren zu, während wieder andere, die kleinen Leiber elanvoll nach vorn und die Zeigefinger eifrig in die Höhe gestreckt, ungestüm anzeigen, die Antwort zu wissen.
„Ich weiß es! Ich weiß es!“ rufen einige und flehen nahezu danach, mit ihrer Logik glänzen zu dürfen.
Lehrerin Rania hat mit der zweiten Zahl ihren Schreibstil korrigiert. Sie steht nun vor der Klasse. Sie trägt ein weißes Sommerkleid und lächelt milde. Ihre Gesten zur allgemeinen Beruhigung wirken nur langsam. „Habir!“ ruft sie den Kids schließlich entgegen.
Sofort nehmen alle Kinder ihre Arme wie selbstverständlich zurück. Es ist still. Ungewöhnlich still für eine Horde Schüler in diesem Alter. Ein Mädchen hält beide Hände an ihre Wangen, die Ellbogen auf den Tisch gepresst.
„Was meinst du?“ fragt Rania erneut. „Wenn ich zwei Äpfel habe und zwei dazubekomme, wie viele habe ich dann insgesamt?“
Die kleine Habir schweigt verlegen und rutscht nervös auf ihrem Stuhl hin und her. Sie windet sich. Sie vergräbt ihr Gesicht. Ganz offensichtlich kennt sie das Ergebnis nicht.
„Na komm, Habir! Letzte Woche wusstest du die Antwort noch. Was haben wir gelernt? Erinnerst du dich?“
Das Mädchen, es mag zehn oder elf Jahre alt sein, wirkt noch verschüchterter. Plötzlich verharrt sie und starrt nach vorn, so als wolle sie ihren ganzen Protest ausdrücken, nicht weiter in ihrer Unwissenheit vorgeführt zu werden.
Ein Mitschüler aus der Sitzreihe vor ihr wendet sich ihr zu, quetscht angestrengt seinen kleinen Daumen in die Handfläche und zeigt ihr vier Finger an.
„Mahmoud! Du kennst unsere Regeln. Du sagst mir gleich, wie viele Äpfel es sind, wenn alle von euch die Anzahl von Äpfeln haben, die ich von Habir wissen will.“
Der Junge wendet sich sogleich ab und zählt innerlich durch.
Es ist noch ruhiger geworden.
Rania ist mittlerweile an den Tisch der kleinen Habir herangetreten. Sie legt zwei Kreidestücke ab, zwei weitere folgen.
Das Mädchen schaut zunächst mit großen Augen verängstigt hoch. Dann geht ihr Blick langsam auf die weißen, kleinen Tafelstifte, die vor ihr liegen. Sie ringt mit sich, schließt für einen Moment die Augen, lehnt sich zurück und verharrt.
„Das sind keine Äpfel,“ ertönt es sofort hinter ihr mit erhellendem Ausdruck unbekannter Herkunft.
„Habir! Zwei und zwei sind...“ Rania versucht geduldig zu helfen und legt ein weiteres Mal alle vier Kreidestücke zusammen. Sie hockt sich vor den Tisch, um auf Augenhöhe zu sein.
„Ich... Ich weiß es nicht,“ schluchzt die Kleine plötzlich auf und vergräbt verschämt ihren Kopf zwischen Hände und Arme. Sie beginnt zu weinen. Kein noch so fürsorgliches Wort des Trostes kann helfen.
Es gab viele bewegende Begebenheiten an diesem Tag. Doch mitzuerleben, wie verzweifelt dieses Mädchen war, weil sie eine einfache Rechenaufgabe nicht lösen konnte, war an Ergriffenheit nicht zu überbieten. Später, als sie mit ihren Freundinnen in einer Pause um die Ecken flitzte, rief sie allen ständig die Antwort zu. „Vier! Vier! Vier! Ich weiß es. Vier!“
Vielleicht war sie nervös gewesen. Möglich, dass sie meine Anwesenheit irritiert hatte. Doch als Rania mir erklärt hatte, dass die kleine Habir erst seit ein paar Wochen regelmäßig zur Schule kam, dass sie dazu eine ausgeprägte Lernschwäche quälte, lag der Verdacht nahe, dass sie in der kommenden Woche wieder Schwierigkeiten haben würde, wenn sie sich geistigen Auges statt zwei mal zwei Äpfeln drei mal drei Bananen gegenübersah.
Ich war in Manschiyet Nasser, einem Stadtteil Kairos etwa auf halbem Weg zwischen dem Zentrum und der Al Azhar Universität am Fuße des Muquattam-Hügels gelegen. Mehr als sechshunderttausend Ägypter leben hier. Der Großteil der Hütten und Behausungen in diesem Viertel war bereits in den letzten Jahrzehnten unerlaubt errichtet worden. Und noch immer zog es jedes Jahr Hunderte, die es anderswo in der Hauptstadt nicht geschafft hatten, in die Ruinen der zumeist nie fertig gestellten Gebäude.
Informell, wie die Stadtregierung sich ausdrückt, haben sich hier auch die Zabbalin angesiedelt, die Müllsammler. Ihre Anzahl kennt keiner genau. Auf siebzigtausend Menschen werden sie geschätzt. Mit ihren hoch beladenen Eselskarren oder oftmals schrottreifen Minitrucks sind sie für jedermann im Straßenbild Kairos sofort erkennbar, sind sie für die Hauptstadt unverzichtbar geworden. Tausende Familien, zumeist koptischen Glaubens, arbeiten nicht nur als zusätzliche Müllabfuhr. Weit mehr haben sie sich auf die Trennung und das Recycling vieler Materialien spezialisiert.
Gleich mit der Einfahrt ins Viertel sind sie unübersehbar, die Berge von Plastikflaschen und Wertstoffen wie Dosen, Becher oder Pappe. Dutzende große, weiße Müllsäcke aus Jute stapeln sich neben- und übereinander. Ansammlungen von Metall, Glas und Essensresten lagern daneben. Elektroschrott, Kabelzüge und Holz liegen dahinter. Werden die Rohstoffe teurer, lungern immer auch mehrere Männer zu ihrer Bewachung herum. Hektische Kommandos ertönen. Schreie rufen zur Ordnung. In den verfallenen Klinkerbauten lagern Tonnen dieses Abfalls, Ecke um Ecke, Straßenzug um Straßenzug. Es riecht widerlich nach Müll, Fäule und Zersetzung. Katzen über Katzen streifen umher. In einem Hinterhofverschlag werden Schweine gehalten. In den Gassen quälen sich unzählige Karren und Laster vor und zurück, alle beladen mit dem, das in der Nacht aus allen Winkeln der Stadt eingesammelt worden war.
Weiter nach Osten liegt die riesige Höhlenkirche St. Sama’an, die größte Koptenkirche im Nahen Osten. Ist sie zu hohen Feiertagen voll besetzt, beten zwanzigtausend Gläubige in beeindruckender Architektur. Auf halbem Weg dorthin hatte ich mich mit ihr verabredet. Sie war pünktlich, wie sie höflich aber bestimmt am Telefon zu verstehen gab, während ich im Taxi saß und warten musste, dass sich der Stau, den ein Kleinlaster mit der Anlieferung seiner Fracht verursacht hatte, aufzulösen begann.
Die Gerüche aus allen Winkeln dieses Viertels waren kaum mehr auszuhalten, ein unerträglicher Lärmpegel dröhnte in die Ohren. Dann und wann flitzten ein paar Kinder und Jugendliche umher, kletterten auf die Halden oder halfen Männern bei der Arbeit. Zentnerschwere Säcke wurden entleert oder gefüllt, um Momente später auf Ladeflächen zu fallen. Auf einem Platz warteten riesige Containertrucks darauf, mit dem Recyclinggut beladen zu werden. Eine Planierraupe und ein Bagger lieferten unentwegt zu. Fiel etwas zu Boden, war schwere Knochenarbeit erforderlich. Endlich. Es ging raus aus diesem üblen Gestank und Getöse. Von weitem konnte ich sie sehen. Sie winkte dem Taxifahrer zu, der neben ihr hielt. Sie stieg ein. Ihre Frische und Dynamik passten so gar nicht zu diesem Umfeld, dachte ich mit unserer Begrüßung. Wie außergewöhnlich dieser Tag tatsächlich werden sollte, entzog sich mir immer noch jeder Ahnung.
Rania ist nicht ihr richtiger Name. Sie bestand darauf, als wir dieses Treffen verabredet hatten, weder ihre Identität preiszugeben noch Bilder von ihr zu veröffentlichen. Sie befürchtete, wie sie meinte, Unannehmlichkeiten mit der Behörde, denn früher oder später würde ich sie nach Zuständen fragen, die das ganze Dilemma der Schulpolitik Ägyptens aufzeigten. Da war Anonymität dienlicher Selbstschutz. Kritische Stimmen gegen das System und ihre Verantwortlichen waren unerwünscht.
Rania war Lehrerin aus einem anderen Stadtteil. Sie war Ende zwanzig, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Einmal in der Woche kam sie hierher, in das Armenviertel Manschiyet Nasser, in die Slums der Müllmenschen, um gemeinsam mit fünf anderen Lehrern ehrenamtlich an einer Schule der Organisation Stephen’s Children zu unterrichten.
Zweigeschossig ist der Bau, mit Fenstern und Türen ausgestattet, was ihn allein schon deswegen im Umfeld der zahlreichen Bauruinen in der Nachbarschaft hervorhebt. Spendengelder und Improvisationskünste haben ihn erstehen lassen. Kommunikationszentrum nennt die Wohlfahrtsgemeinschaft eine Stätte wie diese, einen Ort, an dem es Hilfen aller Art gibt. Neunzig dieser Zentren unterhält die Hilfsorganisation mittlerweile im gesamten Stadtgebiet.
Maggie Gorban, zentrale Leitfigur von Stephen’s Children und Kairos Mutter Theresa, wie sie genauso bewundernd wie ehrfurchtsvoll genannt wird, ist mittlerweile weit über die Landesgrenzen Ägyptens hinaus bekannt geworden. Die Fünfundsechzigjährige und ehemalige Informatikprofessorin wurde bereits mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert. Seit fünfundzwanzig Jahren setzt sie sich in den sozialen Brennpunkten zwischen Christentum und Islam für die Menschen in den Slums der Stadt ein, fokussiert zwar auf die Kopten Kairos, doch oft genug auch frei von allen Glaubensbekenntnissen. So außergewöhnlich diese barmherzige Seele und Mama aller Straßenkinder war, samt der Perspektive, sie möglicherweise an diesem Tag auch zu treffen, wenn es ihre Zeit und Aufgaben zuließen – gekommen war ich wegen einer anderen Frau. Die saß nun neben mir und rang damit, das ganze Ausmaß eines Desasters in Worte zu fassen.
Es war große Pause. Die Mathestunde lag hinter allen, Lesen und Schreiben stand als nächstes an. Ich verfolgte die Verspieltheit der kleinen Habir. Ihre Tränen waren getrocknet. Fröhlich hüpfte sie umher. Mehrfach eilte sie an uns vorbei und bemerkte noch einmal voller Stolz, dass zwei und zwei vier waren.
„Ich hätte mitweinen können,“ offenbarte Rania unvermittelt, atmete tief durch und sah ihrerseits auf die Unbekümmertheit eines Kindes, dessen Zukunft bereits mit ihrer Geburt abgeschlossen war, wie sie nüchtern angefügt hatte.
Mir fehlte augenblicklich jedes Wort.
„Manchmal denke ich, dass es besser ist, dumm zu bleiben. Wenn man wenigstens glücklich ist.“
Wieder verbot sich jeder Kommentar.
„Aber gut. Wie auch immer.“ Mit diesen Worten begann sie nach einer Weile des Schweigens ihre Ergriffenheit abzulegen. Sie fasste für mich in Kürze die Grundzüge des ägyptischen Schulsystems zusammen und skizzierte den Idealfall einer Schulzeit, die mit dem Beginn eines Studiums oder nach einer entsprechenden Ausbildung im Berufsleben endete. Aus ihrem privaten Umfeld hatte sie dazu Einblick in die Arbeit einer Kommission, die vor kurzem erst Vorschläge für eine Reform an einem Teil dieses Bildungssystems erarbeitet hatte.
So kannte ich sie. Unangepasst und zielstrebig. Zweimal zuvor hatte ich sie im Vorfeld meines Besuchs an ihrer Schule getroffen und miterleben dürfen, wie beliebt sie bei ihren Schülern war. Vorgesetzte wie Kollegen attestierten ihr zusätzlich eine fachliche wie soziale Kompetenz, die derart voller tiefer Anerkennung geäußert worden waren, dass man ob dieser ultimativen Lobeshymnen schon wieder hätte stutzig werden können.
Kennen gelernt hatte ich Rania auf dem Grillfest eines Bekannten. Bereits nach kurzer Zeit hingen alle Kids wie Kletten an ihr, tobte und alberte sie mit ihnen herum, als kannten sie sich seit Jahren. Ich mochte Menschen, die ihrem Beruf mit Begeisterung nachgingen. In Ranias Fall bedeutete diese Hingabe gleichzeitig anstecken zu können. Als Respektsperson kam sie ausgesprochen authentisch daher. Ein Verbot war ein Verbot, eine Mahnung die Vorstufe und Erklärungen der Beginn. Strahlten Lehrer dazu diese ihre Souveränität aus, mit ihrem Mehr an Wissen niemanden zu überfordern und möglichst jeden individuell zu begleiten, durften sie völlig zu Recht Klassenzimmer betreten. Ich hatte bereits eine Menge anderer ausgebildeter Pädagogen getroffen, die zum Wohle aller besser draußen geblieben wären.
Nach der Mathestunde hatten die Schüler einen Einkaufszettel für den Supermarkt angefertigt. Diejenigen, die Banane nicht hatten schreiben können, hatten sie gemalt. Eine knappe Stunde lang. Mama Maggie steckte in einem Verkehrsstau. Weil sie zusätzlich andere Termine drängten, hatte sie ihr Kommen abgesagt. Das bescherte den Kids eine verlängerte Pause, weil der hohe Besuch in ihrer Klasse entfiel, und Rania zusätzlich festzustellen glaubte, dass die Konzentration ihrer Schüler mehr und mehr nachließ, als sie die Ergebnisse aller Schriften über den Erwerb einer gesunden Ernährung kurz nur überflogen hatte.
Wir saßen auf einem Mauervorsprung im Schatten einer Wohnhausruine und blickten auf die kleine Bildungsanstalt, die so Großes leistete. Die vorderen Zimmer hatte die Organisation zu zwei Unterrichtsräumen hergerichtet. Dahinter würde man bestimmt wieder ins Nichts stürzen, dachte ich.
Weil hier keine Straßenkinder schlafen oder essen durften, begann Rania zu erzählen, besaß dieser Ort etwas Magisches, etwas, das alle Beteiligten zu bewahren versuchten wie einen kostbaren Schatz. Vor allem die Schüler selbst. Als es im vergangenen Winter den Slumbewohnern in den Wohnbaracken, die weiter einwärts im Viertel lagen, zu kalt geworden war, hatten sich viele Kids zu einer Nachtwache zusammengeschlossen, um ihre Tische und Stühle zu verteidigen. Die wären sonst als Brennholz verheizt worden. Vielleicht lag der Zauber dieser Energie, so bereitwillig und motiviert um Wissen zu kämpfen, in dem Spürsinn der Straßenkinder begründet, doch etwas für sich und ihre Zukunft zu tun, überlegte ich. Wahrscheinlicher aber war, dass ihnen sonst niemand beibrachte, etwas wertzuschätzen, das kein Geld einbrachte.
Noch immer haderte sie mit sich, schien sie nicht zu wissen, wie sie über das berichten sollte, was unsere Augen nicht sahen. Erst später, als ich daheim die Aufzeichnungen unseres Gesprächs mehrfach angehört hatte, um die Inhalte aufs Papier zu bringen, entdeckte ich, wie zerrissen sie in ihrer Leidenschaft wahrlich gewesen war.
Während die Kleinen umhertollen und die Haltbarkeit der Bälle ausgiebig testen, die ich auf Ranias Vorschlag als Gastgeschenk mitgebracht hatte, beschäftigen sich die Teenager aus der Klasse streng getrennt voneinander. Zwei Jungs versuchen sich eifrig daran, die gleichfalls überlassene Frisbeescheibe in eine taugliche Rotation zu bringen. Die drei Mädchen der Klasse beobachten sie. Immer mal wieder stecken sie die Köpfe zusammen, tuscheln und kichern reichlich albern. Omar, ein dreizehnjähriger Junge, der im Unterricht auffällig still gewesen war, sitzt abseits und liest in einem deutschen Lesebuch, das er mir noch vor dem Unterricht gleich mit meiner Ankunft erhaben präsentiert hatte.
„Er kann überhaupt nicht lesen,“ kommentiert Rania meine Blicke auf ihn.
„Kann er denn wenigstens schon etwas sprechen?“
„Guten Morgen! Ich bin zwölf Jahre alt.“
„Immerhin! Was, wenn ich versuche ihm beizubringen, dass er in Wahrheit ein Jahr älter ist?“
„Und was nützt ihm das?“
Rania hatte Recht, beginne ich einsichtig über eine Antwort nachzudenken. Es ist besser, ihm, wie sie das tut, Rechnen, Lesen und Schreiben in seiner Sprache zu ermöglichen. Jede Sekunde seiner Aufmerksamkeit wird gebraucht.
„Er hat noch ein Lesebuch aus Finnland und eines aus Frankreich.“ Momente später hilft sie mir. „Es sind Spenden. Und immer, wenn ich sage, dass sie jetzt eine halbe Stunde das tun dürfen, was ihnen Spaß macht, greift er sich eines dieser Bücher.“
„Er hat Spaß daran, Bücher zu lesen, die er gar nicht versteht?“
„Nein! Er will zeigen, dass er mehr lernen will, als wir ihm hier vermitteln können.“
„Verstehe,“ antworte ich, ohne selbst jemals zuvor in einer ähnlichen Lage gewesen zu sein.
Rania schmunzelt, während ich, als ich endlich ihren kleinen Witz begriffen habe, denke, ob und was sie tun könnte, wenn es die Wahrheit wäre.
„Einmal sind seine Eltern gekommen, als er zusammen mit den anderen in der Pause gespielt hat. Sie haben ihn sofort mit nach Hause genommen und gesagt, dass er besser arbeiten sollte, wenn er schon nicht lernt.“
Ich verharre augenblicklich genauso überrascht wie betroffen.
Eine Weile schweigen wir erneut und beobachten ihre Schüler, die in unbändigem Eifer entweder den Bällen oder einer ständig eiernden Plastikscheibe nachlaufen. Selbst Spielen will gelernt sein.
„Sie kommen und gehen,“ setzt Rania schließlich ein. „Manche sind ein halbes Jahr hier, manche ein paar Wochen. Es ist fast immer gleich. Die Eltern kommen dann und sagen, dass ihre Kinder doch jetzt eine gute Grundlage und genug gelernt hätten.“
„Für was?“
„Fürs Leben. Wofür sonst?“
„Sie meinen wohl eher für ihr Leben,“ bemerke ich. „Und was ist mit denen, die tatsächlich auf eine gute Schule gehen könnten?
„Manche schaffen den Sprung. Die meisten nicht. Aber wir kämpfen um jeden.“ Rania gerät nachdenklicher. „Bildung ist in unserem Land überall zuallererst eine Frage des Geldes. Wirst du in Ägypten geboren und kann deine Familie nicht ausreichend für dich bezahlen, bist du von jeder nützlichen Bildung ausgeschlossen. Damit fehlst du der Allgemeinheit. Und zwar unabhängig von deiner Intelligenz oder von deinen Talenten. Für die ägyptische Gesellschaft gibt es dich einfach nicht, weil dir niemand ermöglicht dich einzubringen. Die Straßenkinder in Slums wie diesem sind die, um die sich wirklich keiner mehr kümmert.“
„Warum?“ frage ich zunächst vorsichtig nach und ringe mit den richtigen Worten meiner Fortsetzung, weil ich bemerkt habe, wie nahe Rania ihre Feststellung selbst geht. „Warum ist Bildung in Ägypten so schwierig?“
Rania lacht auf, bevor sie sich, einem Buchhalter gleich, unverkennbar anschickt, ihre Gedanken in eine Ordnung zu bringen. „Die Ägypter setzen einfach zu viele Kinder in die Welt. Jahr für Jahr. Besser gesagt die armen Ägypter. Und dieser Bedarf bringt enorme Probleme. Dann haben wir viele Fehler in der Vergangenheit gemacht, unter denen wir heute noch leiden. Dann gab es Reformen. Und Reformen der Reformen. Die Oberstufe wurde reformiert, aber nicht die Grundschule. Dann wurden Teile des Grundschulsystems neu geordnet, aber anderes nicht darauf angeglichen. Nur etwa ein Drittel aller Kinder finden einen Platz im Kindergarten. Immerzu wurden und werden nur einzelne Abteilungen anders geordnet. Nie das ganze System. Und jede Reform kostet ja auch Geld. Entscheidend ist, wie viel Geld wir im Jahr für unsere Schulen ausgeben können. Wenn der Staat sagt, dass er das Geld erst einmal anders investieren muss, dann sind wir in der Regel die, die nichts oder nur wenig bekommen. Und das war schon immer so.“ Ihr Blick auf mich besitzt plötzlich nahezu mosaische Züge. „Heute wissen wir zum Beispiel auch, dass unter der Regierung Mubarak, trotz aller Versprechen, Milliarden Dollar zweckentfremdet worden sind. Das war Geld aus dem Ausland, von Hilfswerken. Es war nur für unsere Schulen gedacht.“
Rania wählt den Plural der ersten Person in ihrer Rede. Während ich darüber zu sinnieren beginne, wie sehr sie sich als Teil des Systems sieht, springt sie unvermittelt von der Mauer und läuft vor mir auf und ab.
„Wir haben einfach zu viele und zu große Probleme. Noch einmal. Bildung ist in unserem Land überall zuerst eine Frage des Geldes. Reiche ägyptische Familien können ihre Kinder und Jugendlichen auf ausländische Schulen schicken. Die bieten zumeist hochwertigen Unterricht auf fast internationalem Niveau an. Das kann sich aber nur die Elite des Landes leisten, oder besser gesagt die, die sich dafür halten.“
„Private Schulen also,“ bemerke ich und ringe mit einer nächsten Bemerkung, die helfen soll, sie ein wenig in ihrer zunehmenden Dynamik zu drosseln.
Doch Rania ist nicht mehr aufzuhalten. „Ja! Britische, amerikanische, deutsche und andere. Zweihundert solcher Schulen gibt es im Land. Und wenn du weißt, dass im Durchschnitt etwa tausend Schüler in jede dieser Schule gehen, also etwa zweihunderttausend, dann stehen diesen Schülern die große Mehrheit der anderen gegenüber. Mehr als zwanzig Millionen ägyptische Kinder und Jugendliche nämlich besuchen die öffentlichen Schulen. Und jeden Tag werden es mehr. Immer mehr. Verstehst du?“
Ich erlebe eine Frau, die in ihrem Engagement derart aufgeht, als hatte sie der Präsident empfangen, um von ihr aus erster Quelle zu hören, was sie, losgelassen von allen Hemmungen, von dem ägyptischen Bildungssystem hält.
Noch engagierter schreitet sie fortan dozentenähnlich von links nach rechts, wieder zurück und wieder zu beiden Seiten, gestikuliert wild, bleibt stehen, um zentralen Aussagen noch mehr Wirkung verleihen zu wollen und kümmert sich nicht einen Moment um die Kids, die ihren Vortrag ob ihres ungewohnten Benehmens bisweilen irritiert verfolgen. „Nehmen wir die ägyptischen Lehrer. Sie sind meistens schlecht bezahlt und ausgebildet. Sie verdienen alle gleich, unabhängig von ihrem Können oder von ihrem Engagement. Das macht keinem Spaß. Die, die gut sind, geben Privatunterricht und fehlen somit den öffentlichen Schulen. Genauso wie die Schüler, die von ihnen unterrichtet werden. Das bedeutet, dass es wieder Unterschiede gibt. Wieder gewährleistet Geld eine bessere Bildung und damit bessere Chancen. Dann. Es ist gleich, wie viel Geld die Regierung im Budget für Bildung hat. Nie ist es genug. Jedes Jahr werden zum Beispiel aus dem gesamten Bildungsetat fünfundachtzig Prozent allein für Gehälter ausgegeben. Damit kommen wir zu einem anderen großen Problem. Zum Zustand und der Ausstattung der Schulen. Viele Gebäude sind baufällig, viele sind so ruiniert, dass man Angst haben muss, sich darin zu bewegen. Und manchmal habe ich nicht einmal mehr ein Stück Kreide, um etwas an die Tafel zu schreiben.“
Die kleine Habir steht überraschend vor uns und schaut mit großen Augen auf Rania.
Rania hat ihre Besorgnis entdeckt und ihre Darstellung, die mehr und mehr zur Wutrede geraten war, jäh beendet. „Ist schon gut, Habir! Geh wieder spielen, ja?“
„Wenn mein Papa so laut redet, dann kriegt Mama immer Schläge,“ bemerkt die Kleine.
Als Rania ihre Worte übersetzt hatte, schreit in mir augenblicklich Entsetzen auf. Sie hat nur noch ein paar Jahre, denke ich und verfolge, wie sie davon hüpft. Dann würde ihr Vater sie verheiraten, damit sie aus dem Haus ist, damit sie nichts mehr kostet, damit sie Kinder gebärt, damit auch sie die ganze Familie unterstützen kann. Für diese Zukunft braucht sie wirklich kein Abitur.
„Sorry,“ setzt Rania ein, als wir lange genug über das Elend des Mädchens geschwiegen hatten. „Ich weiß auch nicht. Manchmal gehen eben die Esel mit mir durch.“
Ich kann nicht anders. Ich muss augenblicklich laut lachen, was sie stutzig macht, erst recht, als ich mich wieder beruhigt habe und zu erklären versuche, dass es Pferde sind, die einen in diesem Sprichwort im Zustand eines Temperamentsausbruches davontragen, ohne dass man das will.
„Wie auch immer,“ meint Rania. Sie hat ihre Fassung zurück, jene souveräne Art, die dennoch so leicht zu reizen ist, wenn es um die Ungerechtigkeiten und Chancengleichheiten der offiziellen Bildungspolitik geht. Sie beginnt von ihrem Schulalltag zu berichten, davon dass jeden Tag bis zu fünfzig Schüler in ihrem Unterricht sitzen. Wenn alle gesund und da sind. Ihre Frage, ob ich mir vorstellen kann, was das bedeutet, bejahe ich zunächst wortlos. Erst als ich darüber nachdenke, während sie berichtet, womit sie an diesem Vormittag zu kämpfen hatte, rutscht eine Ahnung nach der anderen tatsächlich in mein Bewusstsein.
Fünfzig Zehnjährige, fünfzigmal Unerzogenheit und Wildheit. Zusammengepfercht. Fünfzig Launen, fünfzigmal Chaos. Fünfzigmal fünfzig Zurechtweisungen. Fünfzigmal staatlich verordnete Präsenz, fünfzig Überlebenskämpfe. Fünfzig Väter, die schlagen, fünfzig Mütter, die ertragen. Fünfzig Chancen am Vormittag, fünfzig verlorene Kindheiten danach. Fünfzig Begabungen, fünfzigmal Aussichtslosigkeit. Fünfzigmal Unwissenheit, fünfzig Leben in Schlichtheit. Fünfzigmal Unschuld, fünfzigmal Kritiklosigkeit. Hoffentlich. Hoffentlich kommt wenigstens eines dieser Kinder durch.
„Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass etwa ein Drittel der ägyptischen Bevölkerung nicht lesen oder schreiben kann. Manche meinen, dass diese Zahl noch höher liegt. Mehr als die Hälfte davon sind Frauen und Mädchen.“
„Bitte?“
„Es gibt Millionen von Analphabeten im Land. Und mehr als die Hälfte davon sind Frauen und Mädchen,“ wiederholt Rania genauso betroffen wie eindringlich und mustert mich in einer Strenge, als hatte ich soeben versucht, ihr zum fünften Mal als Entschuldigung für nicht gemachte Hausaufgaben zu versichern, dass Oma gestorben war.
„Tut mir Leid. Ich hatte etwas anders im Kopf. Aber ja! Ich habe davon gelesen. Der Verdacht liegt wohl nahe, dass der, der sie alle gezählt hat, auf diese Zahlen kommen sollte.“
„Ja!“ stimmt sie mir zu. „Und ausländische Organisationen sagen, dass es noch mehr werden. Dass die ägyptische Regierung die Augen vor dem wahren Ausmaß verschließt. Ausländische Organisationen sagen auch, dass die Schulpolitik in diesem Land ein bildungspolitisches Desaster ist. Jetzt und erst recht für die kommenden Generationen.“ Rania begutachtet mich noch entschiedener. „Vor ein paar Wochen habe ich ein Interview mit unserem Präsidenten gesehen. Er meinte, dass das Land auf dem Weg ist. Dass es Prämissen geben muss. Dass wir nicht alle Probleme gleichzeitig lösen können.“
Hatte ich wieder nicht richtig zugehört, frage ich mich, weil ihr stechender Blick eine Schärfe annimmt, der man unverzüglich entkommen möchte.
„Verstehst du? Ausländische Organisationen sagen das. Unsere Verantwortlichen schweigen. Die meisten Lehrer übrigens auch. Und warum schweigen sie? Warum schweigen alle? Weil sie sich deswegen schämen. Das ach so stolze Ägypten schämt sich. Und keiner ist da, der etwas verändert.“
Gerade, als ich ihr entgegnen will, dass sie hier ist, dass sie etwas tut, dass ihr Engagement hochgradig beeindruckend und Erfolg immer auch eine Frage des Maßstabs ist, entschuldigt sich Rania und klatscht in die Hände. Ich verfolge ihre Mahnungen an die Kinder, sich nicht noch weiter vom Gebäude zu entfernen, weil der Ball, der augenscheinlich zum dienlichsten aller Spielgeräte auserkoren worden war, über die Straße gekullert ist.
Rania setzt sich wieder neben mich auf die Mauer. „Alles zusammen gezählt nenne ich es die Spirale der Volksverdummung. Denn wer selbst keine Schule besucht hat, wer selbst kein Bewusstsein dafür hat, der wird auch wenig Wert darauf legen, dass seine Kinder eine gute Bildung bekommen. Eltern, die ihre Kinder einen Monat lang nicht in die Schule schicken, müssen eine Strafe zahlen. Normalerweise. Zehn ägyptische Pfund. Da ist doch klar, dass sie ihre Kinder viel lieber zur Arbeit schicken. Aber selbst diese zehn Pfund werden nur selten erhoben und auch gezahlt. Sie sollen demnächst tausend Pfund zahlen, so jedenfalls der Plan der Schulaufsicht. Weißt du, was dann passieren wird?“
„Es bräuchte wieder eine Reform,“ bemerke ich lapidar und versuche mir das Chaos vorzustellen, wenn tatsächlich alle Kinder des Landes urplötzlich auf der Schulbank säßen.
„Das ganze System, das ganze Land gehört reformiert,“ stößt Rania so trocken aus, dass mich ihre Nüchternheit wundert. „Wenn alle einen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung hätten, fehlt es an Arbeit für sie. Wo sind sie, die Fabriken und Büros, in denen sie arbeiten könnten? Wo ist sie, die Arbeit? Manchmal denke ich, dass das der wahre Grund ist.“
„Du meinst, dass das Schulsystem bewusst deswegen so vernachlässigt wird, weil die Behörden wissen, dass die meisten mit ihrer Bildung nichts anfangen können?“
„Genau das meine ich, ja! Was nützen einem gute Schulnoten, wenn es danach nicht weitergeht? So lange Schulzeit in unserem Land verlorene Zeit ist, so lange sich Schulzeit nicht lohnt, wird sich an unserer Misere nichts ändern.“
„Du redest über staatliche Berechnung. Du redest über staatliche Kontrolle,“ hake ich nach.
Rania stimmt mir zunächst wortlos zu, um sich mir Momente später mit einem Ausdruck in ihrem Gesicht zuzuwenden, der ihre tiefe Erkenntnis unmissverständlich dokumentiert. „Das ist wohl so. So ist das System. Wenn du schon weißt, dass du keine Antworten hast, tust du besser nichts, dass jemand die passenden Fragen stellen kann. Wenn unsere Gesellschaft gebildeter wäre, dann würden auch mehr Fragen gestellt, würden die Menschen kritischer. Und damit sind sie eine Gefahr für die, die über sie bestimmen. Wer mehr weiß, wird früher oder später gegen das protestieren, über das er vorher nie nachgedacht hat.“
„Das geht schon lange so,“ halte ich nach einer Weile unseres gemeinsamen Schweigens fest, einer Zeit verbindender Wortlosigkeit, die getrost vergehen darf, weil die ganze Wucht des bedeutendsten aller Gründe für die so beklagenswerte Schulpolitik Ägyptens offenbar geworden ist.
„Das geht schon zu lange so,“ ergänzt Rania und schüttelt sich selbst aus der Schwere ihrer Erkenntnisse. „Tut mir Leid. Wir können gerne später weiterreden oder ein anderes Mal, aber jetzt...“ Sie deutet auf ihre Uhr und beginnt, die Kids zusammenzurufen, elanvoll, motiviert, in die Hände klatschend.
Fast scheint es mir so, als habe sie unser Gespräch an ihre so gewaltige Aufgabe erinnert, derer sie an diesen Ort kommt. Dass reden nicht hilft. Dass sie keine Zeit mehr verlieren darf. Dass schon genug Zeit vergangen ist. Ich stimme ihr zu und bitte darum, zur Lesestunde erst später dazu zu kommen, weil die Tonaufnahme, die ich von unserem Gespräch gemacht habe, ein paar Erläuterungen braucht, die eine Aufzeichnung nicht leisten kann.
Während ich sie beim Einsammeln ihrer Schüler beobachte, ertönen weit entfernt die Rufe eines Vorbeters. Gerne hätte ich sie noch zu ihrer Meinung gefragt, wie sie den Einfluss des Islams auf das Bildungswesen im Land einschätzt. Immerhin, so hatte vor meinem Besuch gelesen, waren viele Funktionäre des Systems Muslime. Ich hatte von Religionsunterricht und Bürgerkunde gehört, die angeblich ein förderliches Maß übertrafen. Wer tatsächlich Weltbürger werden wollte, konnte nicht früh genug damit anfangen, eine Diskussion zwischen Glauben und Wissen zu berücksichtigen. Ich verwerfe diesen Gedanken wie auch jene, wissen zu wollen, ob es nicht besser ist, Englisch zu lernen statt aus dem Koran zu lesen, oder ob und wie es möglich wäre, Eltern in die Schule zu bringen. Ich schreibe meine ersten Anmerkungen nieder, da steht plötzlich die kleine Habir vor mir.
Fast skeptisch schaut sie zu mir hoch. Zaghaft ist ihr Benimm. Offensichtlich, so kommt es mir vor, will sie etwas sagen, weiß aber nicht, wie sie das anstellen soll.
Und ob sie das weiß. Gerade, als ich sie fragen will um ihr zu helfen, ob sie noch weiß, wie viele Äpfel sie hat, wenn sie zwei besitzt und noch zwei dazubekommt, streckt sie mir ihre kleine Hand entgegen, setzt ein süßes Lächeln auf und kullert mit den Augen. „Mister, Mister! Inta quais!“
Mister, Mister! Sie sind gut! Ich schrecke sofort auf. Habir bettelt mich tatsächlich mit den Worten an, die verraten, wie geübt sie darin ist. Sie will Geld. Sie hat gelernt, dass einer wie ich Geld haben muss. Sie hat gelernt, dass beharrliches Anschnorren erfolgreich ist, wenn sie ihre kindlichen Reize einsetzt. Sie hat gelernt, dass Würde Hunger nicht stillen kann. Wie wichtig war ihr da noch das Ergebnis einer simplen Rechenaufgabe?
„Ich habe kein Kleingeld,“ antworte ich ihr mit harschem Ton in ihrer Sprache, was sie zunächst ignoriert. In ihrem Flehen wird sie anhänglicher, fordernder und schließlich so unangenehm aufdringlich, dass ich reagiere, wie ich schon seit langer Zeit auf Begehren dieser Art antworte. „Genug jetzt! Ich will nicht!“
Augenblicklich verziehen sich ihre Gesichtszüge zum Ausdruck einer herben Enttäuschung. Die kleine Habir wirft fast zickenähnlich den Kopf in den Nacken, belegt mich kurz mit einem vorwurfsvollen Blick und schreitet davon. Sie tut es in einer Art, die mir sagen soll, dass Betteln und Stolz zwei grundverschiedene Angelegenheiten sind. Dann, nach ein paar Metern, hüpft sie wieder so fröhlich und unbeschwert, wie sie nur kann und streckt mir, kurz vor dem Eingang ins Gebäude, ihre Zunge entgegen.
Meine anfängliche und übliche Befremdlichkeit über ihr im ganzen Land so typisches Bedrängen nach Almosen wechselt allmählich in Gelassenheit. Ich lächle schließlich über ihr kleines und durchaus gekonntes Schauspiel und bleibe bei meinem Wunsch für sie, dass sie noch möglichst oft durch die Tür dieser kleinen Schule ein- und ausgehen mag.
Nach der ersten Lesestunde, in der die Schüler Auszüge eines Märchens vorgetragen hatten, verabschiede ich mich. Ob ich noch einmal wiederkommen würde, und ob ich etwas gelernt habe, fragt mich Omar, worauf die anderen lachen. Auch die kleine Habir schlägt in meine Hand ein. Sie ist wieder so, wie ich sie mit Beginn meines Besuches erlebt hatte. Verschüchtert, klein, zerbrechlich, unwissend und unschuldig. Das Klassenzimmer, denke ich, als ich sie vergeblich zu einem kleinen Lächeln bewegen will, ist für sie eine Welt, die mit ihrer Wirklichkeit so wenig gemeinsam hat. Hoffentlich, wünsche ich ihr zusätzlich die Erfahrung, behält sie es eines Tages wenigstens in so guter Erinnerung, dass sie dafür einstehen kann, wie sehr Wissen ihren Kindern auf keinen Fall schadet.
Zusammen mit Rania überschlage ich in der kleinen Pause das Geld, das nötig ist, um mit allen Kids die Lebensmittel in einem Supermarkt zu erstehen, die jeder einzelne zuvor als gesunde Ernährung aufgeschrieben hatte. Ähnlich energisch, wie ich die kindliche Bettelei abgewiegelt hatte, verbitte ich mir nun jeden Protest gegen meine Idee, einmal Gelerntes ganz praktisch anzuwenden.
Der Abschied von Rania fällt herzlich aus, mit der Verabredung, über die verbrachten Stunden in naher Zukunft noch einmal zu reden. Draußen dann, mit dem Blick zurück auf dieses so außergewöhnliche kleine Haus, ergebe ich mich endgültig meiner melancholischen Stimmung, weil ich weiß, dass für ein paar der Müllkinder gerade tatsächlich ein Märchen wahr wird. Für wie lange auch immer
Ein paar Tage nach meinem Besuch im Viertel der Müllmenschen meldete sich Rania bei mir. Zunächst berichtete sie, dass der Einkauf im Supermarkt, den die Klasse wegen der großen Ungeduld aller Kids gleich am folgenden Nachmittag zusammen mit einer anderen Lehrerin unternommen hatte, ausgesprochen stressig gewesen war und viele Tränen ausgelöst hatte. Weil jeder Schüler einen eigenen Warenkorb besessen hatte, fehlte Geld, um alle Waren auf den Einkaufszetteln erstehen zu können. Zusätzlich war untereinander Neid ob der Größe und Anzahl der verschiedenen Produkte aufgekommen. Immerhin war der Ausflug tauglich genug, einen Kompromiss zu entwickeln. Erst wurde in der folgenden Mathestunde ermittelt, wie viel Geld einem jedem zur Verfügung stand. Anschließend kauften alle exakt die gleichen Waren ein. Pädagogisch wertvoll, urteilte Rania süffisant und mahnte lediglich die Konsequenz der Unternehmung an. Alle Schüler nämlich hatten entweder schlagartig Hunger bekommen, befürchteten den sofortigen Verfall der Haltbarkeitsdaten oder wollten schnellst möglich ihre Familien überraschen. Jedenfalls. Alle wollten unverzüglich nach Hause.
Mehrfach hatte ich schmunzeln müssen, und auch Rania betonte, dass sie, so ungewöhnlich diese Art des Unterrichts auch war, den Spaß an diesem Streifzug ins wahre Leben sehr geschätzt hatte. Momente später war sie wieder ganz die souveräne Lehrerin. Sie bot an, mir eine Zusammenstellung der aktuellen Daten und Fakten über das ägyptische Bildungssystem zukommen zu lassen. Und sie begann, die angebliche Unordnung in ihren Gedanken und Aussagen während unseres Gesprächs auf der Mauer entschuldigen zu wollen. Bis auf kleinere Abweichungen seien zum Beispiel all die Zahlen, die sie genannt hatte, zwar korrekt gewesen, aber eben nicht genau. Eine andere Liste würde die Reformen benennen, die von der zentralen Schulbehörde geplant waren. Für die Zukunft. Wann immer die auch stattfinden würde.
„Rania! Es ist alles gesagt,“ bemerkte ich, als sich mir die Möglichkeit geboten hatte, sie in ihrem Bemühen um Genauigkeit zu unterbrechen.
Im Vergleich zu ihrer sonstigen Gesprächsführung verweilte sie ungewöhnlich lange in Wortlosigkeit, bevor sie eine Frage stellte, deren Antwort nur die kannten, die ihre Geschichte gelesen hatten. „Ist es das wirklich?“