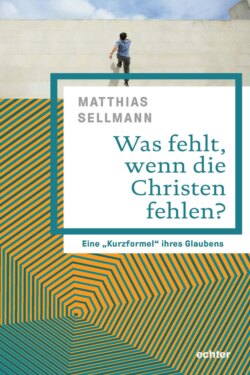Читать книгу Was fehlt, wenn die Christen fehlen? - Matthias Sellmann - Страница 8
Оглавление1. Einführung
Was fehlt, wenn die Christen fehlen? Zu diesem Buch
Die Nachricht letztes Jahr machte schnell die Runde. Und obwohl sie viele hatten kommen sehen, markierte es doch einen echten Punkt, als es dann amtlich war: Voraussichtlich im Jahr 2033 werden weniger als die Hälfte der in Deutschland Lebenden zu einer christlichen Kirche gehören. So um das Jahr 2060 herum stellen sie nur noch ein Drittel. 3 Allein im Jahr 2019 haben mehr als 500. 000 Menschen ihren Kirchenaustritt erklärt.
Solche Zahlen belegen: Christsein wird zum Minderheitenphänomen. Wir bewegen uns in die nach-christliche Gesellschaft.
Nun können sich die, denen etwas an Kirche liegt, die Fakten schönreden: Wo bitte steht, dass man Mehrheit sein muss, um präsent zu sein? Haben sich nicht auch andere schon gesundgeschrumpft? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen! Und überhaupt: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast…
Trotzdem – so richtiger Humor will nicht aufkommen. Und das übrigens auch bei vielen nicht, die in Distanz zur Kirche stehen und noch nie den Wunsch verspürt haben, hier Mitglied zu werden. Selbst rudimentäre Kenntnisse reichen, um die enorme kulturelle Zäsur zu bemerken, die diese Zahlen ausdrücken.
– Das große christliche Abendland mit der Prägekraft so vieler Jahrhunderte: Es soll vorbei sein?
– Die Power, die einen Kölner Dom gebaut hat: erschöpft?
– Die politische Intelligenz, die die europäische Idee und den Sozialstaat mitkonzipiert hat: erblasst?
– Die ehrfurchtgebietende Feiergemeinschaft, die einen Festkreis aus Weihnachten, Ostern und Pfingsten rund um die Welt gespannt hat und die sowohl in Palästen wie in Baracken Momente der Ewigkeit kreiert: nur noch Folklore?
– Dieser Erzähl-Container aus unendlich vielen Geschichten und Geschichtchen rund um Heilige und Möchtegerne, Alltagsweisheiten, Bauernregeln und Kalendersprüchen: sprachlos, auserzählt?
– Und nicht zuletzt: Diese seltsamen Typen, diese Christinnen und Christen, die oft so linkisch daherkommen, so modeunfähig und nervig weltverloren, die man aber andererseits oft auch als so enorm engagiert erlebt, so alltagstauglich; diese ambivalenten Gutmenschen aus der Nachbarschaft: Leute von gestern?
Ob man es nun bedauert oder nicht – dass sich da eine kulturelle Tektonik verschiebt, das dürfte klar sein. Ebenso klar ist, dass der Schnee von gestern heute nicht mehr nass macht. Wenn eine Kirche meint, sie dürfe aus den Errungenschaften von gestern Privilegien und Komfortzonen für heute ableiten, ist das ein Irrtum. Wir müssen alle nach vorne kommen – und wenn dafür die meisten im Christentum keine echte Ressource mehr sehen, muss man das wohl erst mal akzeptieren.
Trotzdem: Wenn schon Abschied, dann auch mit vollem Bewusstsein und an der richtigen Stelle. Und wenn schon nach-christliche Gesellschaft, dann at it’s best. Soll heißen: Es wäre schade, ein Christentum von dem her in Erinnerung zu behalten, was für es selbst gar nicht die Hauptsache war Und es wäre schön, das zu behalten, was weiterhin seinen Nutzen bringt.
Das ist das Projekt dieses Buches. Es wendet sich an drei Gruppen von Personen:
– Denen, die gerne wüssten, was diese Christinnen und Christen so ausgemacht hat, möchte es Informationen geben, was fehlen wird, wenn diese Leute fehlen.
– Denen, die sich sicher sind, dass Christsein in ‚Moral‘ aufgeht, in ‚Dogma‘, ‚Kirche‘ oder ‚Gehorsam‘ oder dass man den Anspruch erhebt, mit einem bestimmten ‚Glauben‘ den ‚Weg‘ aus allen Schwierigkeiten gefunden zu haben, möchte es sagen: Weit gefehlt.
– Und denen, die selber Christen sind und die in den letzten Jahren durch so viele verwirrende Prozesse (Skandale um Missbräuche, Zusammenlegung von Gemeinden, Schließung von Kirchen, Fehlen von Priestern usw.) unsicher geworden sind, warum man überhaupt noch dabeibleibt, möchte es zurufen: Vielleicht darum.
Das Buch wird von jemandem geschrieben, der selber zu den Christen gehört. Der Autor ist einer dieser ambivalenten Gutmenschen. Natürlich ist es darum parteiisch. In Wahrheit will es dafür werben, die Option des Christseins für ein Leben auf der Höhe der Zeit für sich zu prüfen. Aber es entspringt einem bestimmten Zorn; und der macht (hoffentlich) die Energie des Buches auch für die aus, die keine Christen sind.
Christsein hierzulande ist nämlich zu einer Karikatur seiner selbst geworden. Es steht in einem Ruf, in den es nicht hineingehört – jedenfalls meiner Meinung nach. Christinnen und Christen werden als hüftsteif erlebt, als schnell beleidigt, oberlehrerhaft, vergangenheitsorientiert, langsam, überheblich, diskriminierend, autoritätshörig, lebensuntüchtig, bieder, blutleer. Sie scheinen auf der Bühne des modernen Lebens herumzustehen wie die Requisiten des Volkstheaters, die man wegzuräumen vergessen hat.
Für viele dieser Zuschreibungen gibt es gute Gründe und sicher auch viele unschöne Erlebnisse. Und trotzdem: Wer das Christsein weglegt, sollte sich nicht von irgendwelchen Papp-Kameraden befreien, sondern von jener realen kulturellen Kraft, die nachweislich eine Menge geschafft hat. Alles andere wäre ein zu billiger Gegner. Man bestreitet ja auch nicht die Schönheit Skandinaviens nur deswegen, weil man noch nie dort sein konnte.
Insofern freuen sich Buch und Autor tatsächlich vor allem, wenn die Karikatur des Christseins zugunsten eines realeren Bildes durchbrochen werden kann. Wenn es gelingen kann, die Aufmerksamkeit von Nicht-Christinnen und -Christen zu bekommen. An diesem Gespräch fehlt es nämlich. Das Minimum, was ich hier erzielen will, ist Respekt für eine bestimmte Form von Lebensklugheit, die das Christsein entdeckt hat und die – das ist versprochen – auch von denen genutzt werden kann, die keine Christen werden wollen. Das Gegengeschenk für diese wertvolle Dosis Lese- und Lebenszeit wird sein: Kürze; verständliche Sprache; Relevanz für existenzielles, freies, selbstbestimmtes Leben; ein Mix aus Information und Unterhaltung; Multimedialität (siehe die Vorbemerkung).
Die leitende Frage ist diese: Wie kommt man anständig und kreativ durch das eigene und durch das gemeinsame Leben? Und inwiefern kann Christsein hier inspirieren?
Der verlorengegangene Fokus: Lebensleistung
Damit sei bereits der erste Punkt gesetzt: Christsein ist eine Ressource für positive, gelingende Existenz. Und alles, was dazugekommen sein mag – komplizierte Dogmen oder schlichte Marienandachten, einschüchternde theologische Bibliotheken oder anpackende Sozialarbeiter-Nonnen, Weihnachtsläuten im Schnee oder Messdienerlager am See –, all dies will nichts anderes sein und bedeuten als eine Hilfe zum Leben. Noch der Gottesdienst, den man zur Ehre Gottes feiert und in dem eben nicht jeder Moment vor den Karren der gelingenden Biografie gespannt wird, entspringt einer existenziellen These: dass es nämlich zu sich hinführt, von sich wegzukommen.
Der übliche Beleg für diese Zentralstellung eines vollen, reichen, satten Lebens ist aus dem Neuen Testament der Ausspruch Jesu: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10,10). Aus dem Alten Testament kann man dieselbe Idee über die Rede von der andauernden Schöpfung beziehen, der creatio continua. Den bekannten ersten Vers der Bibel „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ kann man nämlich auch so übersetzen: „Als Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ – und schon nimmt das Ganze Fahrt auf. Leben ist Bewegung, Bewährung, Veränderung. Lebensfülle ist machbar, Herr Nachbar.
Aber Achtung: Hier wird es sprachlich schon brenzlig. Diese Rede vom ‚Leben in Fülle‘ oder vom ‚dauernden Anfangen‘ kriegt schnell Patina, klingt nach Predigt und Kalender und muss dringend aus einer drohenden Seichtigkeit gerettet werden. Daher schlage ich vor, einen weit unbequemeren Begriff anzupeilen: den der Lebensleistung.
Genau die Fixierung auf den Punkt der Lebensleistung ist dem Christsein hierzulande verlorengegangen. Darum wirkt es oft so einstudiert, weil man es wie einen Energydrink zu sich nimmt, ohne dass man für irgendetwas wachbleiben will.
Dabei ist es so simpel zu schreiben wie schwer zu tun: Menschen, wer und wo immer sie sind, müssen und wollen ihre Lebensleistung bringen. Ob wir es mögen oder nicht: Leben heißt performen. Je erwachsener Menschen werden, desto mehr geht ihnen auf, dass ihr Leben auf zwei Dimensionen eine Antwort geben muss: erstens auf die Belange anderer, ihnen zugeordneter Menschen, Situationen und Aufgaben (sei diese Zuordnung freiwillig und erfreulich oder nicht); und zweitens auf die in ihnen als Subjekte spürbaren Impulse, seien es Träume, Ängste, Grenzen oder Ideen. Menschen leben in dieser Doppel-Grammatik von ‚Widerstand‘ und ‚Impuls‘.
Unsere Situationen sind das Material, das in dieser Grammatik durchzudeklinieren ist Und die Vokabeln ‚Schönheit‘, ‚Krankheit‘, ‚Glück‘, ‚Liebe‘, ‚Versagen‘, ‚Armut‘, ‚Pflicht‘ usw. bilden manchmal Sätze mit Sinn – manchmal sogar stimmige Reime und ganze Gedichte –, oft, sehr oft aber auch versickerndes Geschwätz. Dann steht man vor den eigenen Lebenssätzen, sieht weder Satzbau, Punkt noch Komma und wünscht sich sehnlichst, dass kein Deutschlehrer um die Ecke kommt.
Man kann Bücher über Bücher darüber schreiben und Film über Film darüber drehen – es ändert doch nichts daran: Ein Leben lebt sich nicht von selbst; man muss Entscheidungen treffen, Antworten geben, Mitstreiter/innen finden, es mit sich aushalten und im Ganzen sein Glück versuchen. Und je mehr man sich dem stellt, desto mehr steht man in seiner Lebensleistung.
Und das heißt: Das Allgemeinste, was uns als Menschen verbindet, ist der Bedarf an Hilfen für die Lebensleistung. Darum ist jede und jeder interessant und nützlich, der hierzu einen Vorschlag einbringt: sei dieser philosophisch, religiös, skeptisch, lebenspraktisch, esoterisch, karrieristisch oder wie auch immer.
Die Christen gehören dazu. Sie haben eine Idee, wie ‚es‘ gehen kann. Und sie machen einen Vorschlag.
Die Christen und ihre Lieblingszahl: Drei
Diesen Vorschlag kann man nun in vielen Varianten rüberbringen. Das Christentum ist eine große komplexe Sache; es ist immerhin eine Weltreligion – und so viele gibt es davon nun auch nicht; es gliedert sich in unzählbare Konfessionen und Denominationen; es hat früher anders geschmeckt als heute; und natürlich hat auch noch jede und jeder seinen eigenen Reim aufs Leben, Christ hin, Christin her.
Um der Komplexität in diesem Buch gerecht zu werden, die Einfachheit aber nicht zu verlieren, möchte ich mir mit einem Projekt behelfen, das theologisch etwas aus der Mode gekommen ist: Ich werde eine Kurzformel ihres, der Christen, Glaubens entwickeln. So heißt es ja schon im Buchtitel. Was eine ‚Kurzformel‘ ist und was nicht, dazu später im nachfolgenden Kapitel.
Hier aber schon mal dieses: Wer den Christen begegnet, der stößt sehr schnell auf ihre Lieblingszahl – und das von Kiel bis Garmisch und von Syrien bis Tokio. Es ist die Zahl Drei. Diese Zahl muss ihnen etwas sehr Wichtiges bedeuten. Und darum muss jede Kurzformel, die den Punkt treffen will, diese Zahl aufmerksam beachten.
Einige Belege. Die Christen feiern drei große Feste im Jahr, Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Das sind ihre großen Christusfeste – die Zeit von Mai/Juni bis Dezember ist dagegen der Alltag, der ‚Jahreskreis‘. Egal ob Dorfkapelle oder Dom, in ihren Kirchen setzen sie mindestens drei fromme Stationen in Architektur um: eine inszenierte Eingangssituation (Portal, Vorhof, Weihwasser), einen Durchgang (Prozession, Gabenbereitung, Interaktion), einen Vorleseort und einen Altar (Lesung, Gebet, Wandlung, Segen). In ihrer Hauptfeier, der sogenannten Eucharistie, bekennen sie in einem zentralen rituellen Gebet das ‚Geheimnis ihres Glaubens‘. Es ist eigentlich selber eine Kurzformel (allerdings zu voraussetzungsreich), und zwar eine dreigeteilte: „(1) Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir; (2) deine Auferstehung preisen wir; (3) bis du kommst in Herrlichkeit.“ Und nicht zuletzt bringen sie in das Gespräch der Religionen als Gottesvorstellung ein, dass ihr einer und einziger Gott in drei ‚Personen‘ (besser: Subsistenzen) antreffbar und wirksam ist: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die berühmt-berüchtigte Dreifaltigkeit.
Eine solche Häufung an so zentralen Stellen kann kein Zufall sein. Weitere Hinweise ließen sich anführen. Wir halten fest: Christinnen und Christen aktivieren zur Bewährung der Lebensleistung die Zahl Drei. Sie haben da irgendetwas entdeckt, was mit ‚Drei‘ zu tun hat.
Dies ist nicht banal und auch keine schlichte Mathematik. Es gibt buchlange Abhandlungen über das, was geschieht, wenn ‚der Dritte‘ dazukommt. Der große Begründer der deutschen Soziologie, Georg Simmel, hat zum Beispiel hierzu geforscht. Denn diese Zahl ist der Beginn des Sozialen: Sie fügt der möglichen Beziehung von jedem der ehemals beiden nicht nur einen weiteren Partner hinzu, sondern verändert auch die nun mehrfach möglichen Zweierbeziehungen fundamental. Es gibt jetzt Raum für Selbstfindung der beiden durch Öffnung; für Konflikt durch Verschließung; oder für Auflösung durch alternative Paarbildung.
Wie auch immer, dies ist keine Partnerschaftsberatung, und Soziologie ist zentral die Lehre von Organisation. Das Thema ist ‚Ressourcen finden für das Erbringen der Lebensleistung‘. Und da lautet ein erster Beitrag des christlichen Vorschlags: Nutze die Prozessdynamik der ‚Drei‘.
Die zentrale These: Christsein ist eine bestimmte Form von Lebensklugheit
Aus dem Fokus auf ‚Lebensleistung‘ folgt ein Zweites: Das, was wirklich fehlt, wenn die Christen fehlen, ist keine Lehre, sondern ein Weg. Das ist es, was uns abhandengekommen ist: Christsein ist eine klar fassbare Praxis. Eine Methode. Eine Lebensführungsweisheit. Eine Kompetenz. Dafür kann man werben: So wie man Lebensleistung nicht theoretisch, sondern nur existenziell performt, so kann auch eine kulturelle Ressource für Lebensleistung nicht irgendwie theoretisch genutzt werden. Keiner ist Christ im Schaukelstuhl. Man kann Wege schnell verstehen, und doch dauert es lange, sie zu gehen. Die Kenntnis des Weges hat die, die ihn gegangen ist, nicht der, der ihn auf irgendwelchen Karten nachschreibt.
Christsein, so die These hier, ist also erstens eine bestimmte Kompetenz, die man hervorragend dafür benutzen kann, seine individuelle Lebensleistung zu bringen und damit auch für das Gemeinwohl etwas beizutragen. So nämlich nutzt man die Dynamik der Kurzformel. Willst du deine Freiheit so leben, dass dein Leben im Ebenmaß zu dem deiner Leute gelingt und qualitativ gesteigert wird, dann prüfe für dich diese Kompetenz.
Und zweitens: Diese Kompetenz ist Ausdruck einer bestimmten Klugheit, also einer mentalen Ressource. Präziser: einer ‚geistlichen‘ Klugheit. Was dieses Adjektiv ‚geistlich‘ heißt, vor allem aber, was nicht, ist Gegenstand weiter unten in Kapitel 3.
Hier reicht für die Einführung, dass die beiden Begriffe ‚Kompetenz‘ und ‚Klugheit‘ wichtige Weichenstellungen der ‚Kurzformel‘ ausmachen. Zum einen sind es eminent auf Praxis hinzielende Substantive: Kompetenz ist das, was jemand kann; und klug ist die, die sich bewährt. Zum anderen aber geht es natürlich um Religiosität, wenn es um das Christsein geht. Man wäre schön enttäuscht, wenn sich das Lebenswissen einer religiösen Gruppe dann doch restfrei in säkulare Philosophie auflösen ließe. Auch wenn ich nichts vom obigen Versprechen zurücknehmen werde, dass sich die typisch christliche Lebensklugheit auch säkular leben lässt (worauf es im Projekt der Lebensleistung doch wohl zentral ankommt), so wäre es doch übergriffig in beide Richtungen, zu verschweigen, dass Christinnen und Christen diese Kompetenzen von ihrem Meister lernen, Jesus von Nazareth, den sie als präsent erfahren und als sehr, sehr kraftvoll.
Darum ‚geistliche‘ Klugheit. Dieser Vorschlag, Christsein elementar als eine Klugheit zu konzipieren, aus dem sich klare Kompetenzbündel folgern lassen, hat natürlich eine Spitze: Er will von vornherein verhindern, dass man im Christsein vor allem eine Ethik, eine Tugendlehre oder gar einen Benimm-Katalog vermutet. Das aber ist mit Sicherheit die Haupterfahrung vieler Leserinnen und Leser: dass das Christsein vor allem deswegen angeboten wird, damit man nichts falsch macht, nicht ‚sündigt‘, wie es dann heißt, dass man nicht aufbegehrt, sich im Zaum hält, keinen Ärger verursacht, nicht auf dünnem Eise wandelt oder den eigenen Trieben folgt. Christsein wird durch solch moraline Durchsäuerung zu einem ganz blutleeren Geschäft, völlig ungeeignet zum Bestehen eines Lebens, erst recht eines modernen, beschleunigten, technisierten Lebens. Das Ziel scheint darin zu liegen, einen Ball gar nicht zu treten, weil man danebenschießen könnte. Frommgesprochene Risikoangst beherrscht die Agenda; und das Ethos der Willfährigkeit lullt das gesunde Aggressionspotenzial ein, das auf Veränderung aus ist, auf Selbstwirksamkeit, auf start-up und auf die once in your lifechance.
Die Rede von einem Christsein als Klugheit steuert klar gegen solch eine kleinbürgerlich nörgelnde Gouvernanten-Ethik (Karl Rahner) – die übrigens erst seit dem 19. Jahrhundert triumphiert, seitdem aber einen langen Schatten wirft. Wir werden im Buch mit höchster biblischer Autorität sogar nicht einmal davor zurückschrecken müssen, dass es hier auch um eine bestimmte Bauernschläue geht, um strategische Intelligenz, um Durchsetzungsvermögen. Die Lebensleistung ist eben eine echte Leistung; Leistung aber ist, physikalisch gesehen, Arbeit durch Zeit; und man kann Religiosität auch so denken, dass sie zu einer Intensivierung dieser Arbeit aufrüttelt, statt vor der Knappheit der verfügbaren Zeit zu warnen.
Der Gedankengang in der Übersicht
Getreu dem Titel steht das Wort ‚Kurzformel‘ im Zentrum des Buches. Diese Formel wird sofort im nachfolgenden Kapitel 2 präsentiert.
Ist man ehrlich, muss man sagen: Mit diesem Kapitel könnte auch Schluss sein. Denn es wurde ja festgestellt: Leben muss man schon selbst; das Lesen wird die Mühe (aber auch den Spaß) nicht ersetzen; und Klugheit hat es an sich, dass man sie nur erlangt, wenn man riskiert, sie zu brauchen. Das Buch wird zeigen, dass auch geistliche Klugheit nur aus Risikobereitschaft resultiert.
Nimmt man nun noch hinzu, dass der Beweis für eine Erprobung der christlichen Lebensentdeckungen auch von nicht-religiös Gebundenen darin liegt, dass man ‚es‘ einfach tut, hat man einen weiteren guten Grund dafür, das Buch nicht bis zum Ende zu studieren. Trainiert wird das Ganze in realen Situationen.
Für die, die nach Kapitel 2 schon Lust kriegen, das Ganze auszuprobieren, hat das Buch bereits eines seiner Ziele erreicht. Es wird aber manche andere geben, die mit so viel Vorschussvertrauen doch etwas sparsamer sind. Man will ja nicht überredet, man will überzeugt werden.
Darum kümmern sich die weiteren Abschnitte. Kapitel 3 fokussiert auf das Adjektiv ‚geistlich‘. Hier sind eine Menge Missverständnisse abzuwehren, bis man auch hier die Karikaturen hinter sich gelassen hat. Der Lohn: Mit dem griechischen Wort ‚phronesis‘ erhält man einen neuen und überraschend profanen Zugang auf etwas sehr Frommes.
Kapitel 4 löst ein, warum das Buch den Optimismus verbreitet, auch nicht-r eligiöse Personen könnten von religiösen Gedanken real profitieren. Neue Erkenntnisse über das, was religiöse Erfahrungen im Kern sind, lassen die Monopole erodieren und geben den Blick frei auf jene weltanschauliche Kreativität, in der wir alle längst stecken – und zwar gerne. Zudem zeigt der Blick auf die alttestamentliche Weisheitsliteratur, dass sogar die Bibel lange nicht so konventionell religiös ist, wie man eventuell dachte.
Kapitel 5 bietet die neutestamentliche Grundlage für die hier entwickelte Kurzformel. Diese wird ja nicht einfach am grünen Tisch entwickelt, sondern hat den Anspruch, authentisch die ‚Schrift und die Tradition‘ auszulegen, wie man theologisch sagt. Der Text, um den es geht, ist ein Lied, an das sich der Apostel Paulus im Gefängnis erinnert, als er um sein Leben fürchtet.
Nach Kapitel 5 ist etwa die Hälfte des Buches erreicht. Die andere gehört der weiteren Erläuterung der Kurzformel und ihrer Elemente. Drei weitere griechische Begriffe – alle abgeleitet aus dem Gefängnislied des Paulus – bilden die Kapitel 6 bis 8 und die Überschriften: physis, kenosis und dynamis. Sie stehen für die drei Kompetenzen geistlicher Klugheit: immer weniger wegrennen müssen; aus sich herauskommen; Kraft von außen aufnehmen.
Um diese drei Lebenskünste kreist alles. (Und da ist sie wieder: die Zahl Drei.) Wer sie hat und wer sie kann, ist ein Glückspilz. Sie sind das, was fehlt, wenn die Christen fehlen. Nicht weil sie diese Künste virtuos leben – das wäre vermessen zu sagen. Aber sie erinnern daran, dass es sie gibt. Und sie vermissen es, wenn niemand sie lebt.
Ihre Kurztitel heißen: physis, kenosis und dynamis. Sie alle ergeben die eine Klugheit (phronesis). Wer diese Klugheit lebt, so das Versprechen und die Erfahrung, füllt sein Leben und im selben Zuge, das ist das Schöne, auch das der anderen.
Einen Griechisch-Kurs bilden die Kapitel 6 bis 8 trotzdem nicht. Zwar werden die Begriffe gut erklärt; dann aber geht es bunter zu. Es wird gezeigt, wie große und wie normale Gestalten christlichen Lebens diese drei spirituellen Varianten umgesetzt haben. Und dann: wie physis, kenosis und Co. riechen (keine leere Ankündigung – reiben Sie mal an der beigefügten Postkarte!), wie sie aussehen, sich anhören, wie man mit ihnen Ernst und wie man mit ihnen Comedy macht. Eine multisensuale Präsentation also – da es um Lebensleistung geht, darf es schließlich nicht zu trocken werden.
Am Ende kommen in Kapitel 9 Abrundungen, Anwendungen, Überraschungen, Weiterleitungen.
*
So weit das Verlesen der Speisekarte. Bevor aufgetragen wird, vier kurze Klärungen:
– Um redlich zu bleiben, weise ich darauf hin, dass die Paderborner Pastoraltheologin Dorothea Steinebach bereits eine ähnliche Interpretation des Christusliedes vorgelegt hat. Davon bekam ich allerdings erst etwas mit, als ich schon in vollem Gange war.4
– Um den Lesefluss nicht zu stören, arbeiten wir mit Endnoten; und auch diese sind eher sparsam gesetzt.
– Um niemanden unzulässig zu adressieren, spreche ich mal weibliche, mal männliche Gegenüber an. Das geht durcheinander und ist sicher gewöhnungsbedürftig; es zerhaut einem aber auch nicht so die Sprache wie die dauernde Doppelnennung oder lange Endungen.
– Um unter den vielen, von denen ich als Autor profitiert habe, wenigstens drei zu nennen, danke ich hiermit ausdrücklich Björn Szymanowski, Hannah Wahlers und Stefanie Nüsken. Alle drei sorgen am Bochumer Lehrstuhl für eine großartige Arbeitsumgebung – sowohl was kritische Reflexion als auch was Logistik und Humor angeht.