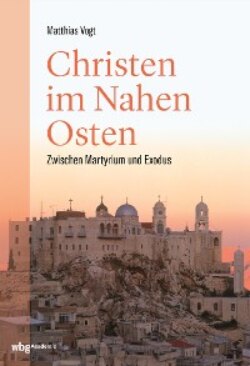Читать книгу Christen im Nahen Osten - Matthias Vogt - Страница 15
Ägypten
ОглавлениеFür Ägypten beginnt die Neuzeit abrupt: Am 2. Juli 1798 landeten französische Truppen unter Napoleon Bonaparte bei Abukir und nahmen Alexandrien ein. Drei Wochen später, am 21. Juli, wurde das Heer der Mamluken, die Ägypten im Namen der osmanischen Sultane beherrschten, bei den Pyramiden von Gizeh vernichtend geschlagen. Die Franzosen nahmen Kairo und das gesamte Niltal ein. Allerdings wurde ihre Flotte bereits kurz darauf von den Engländern unter Lord Nelson bei Abukir vernichtet. Ein Rücktransport nach Frankreich war somit unmöglich. Die Franzosen saßen in Ägypten fest. Ein Feldzug Napoleons Richtung Syrien endete bei Akko. Nach mehrwöchiger, vergeblicher Belagerung der Stadt, die die Osmanen mit britischer Unterstützung verteidigten, musste sich Napoleon im Mai 1799 nach Ägypten zurückziehen.
Zwar bemühte sich Napoleon, den Muslimen Ägyptens als Freund zu erscheinen – er ließ in Flugblättern sogar durchblicken, er sei zum Islam übergetreten –, dennoch brachte die französische Herrschaft für die Christen Ägyptens einige Freiheiten mit sich, die ihnen aus islamischer Zeit unbekannt und mit den traditionellen islamischen Vorstellungen von der Rolle der Nicht-Muslime kaum vereinbar waren. Unmittelbar nach der französischen Eroberung Ägyptens hatte sich das zivile Haupt der Kopten (raʾīs al-aqbāṭ), Muʿallim Ğirğīs al-Ğawharī, an Bonaparte gewandt mit der Bitte, gemäß den Idealen der französischen Revolution rechtliche Beschränkungen, die den Kopten auferlegt waren, aufzuheben und Gleichheit herzustellen. Die Franzosen schafften daraufhin die diskriminierenden Bestimmungen der ḏimma ab (Beschränkungen bei öffentlichen Gottesdiensten, Kleidungsvorschriften, das Verbot, auf Pferden zu reiten und Waffen zu tragen). Außerdem wurde eine Gesetzeskommission eingerichtet, die aus sechs muslimischen und sechs koptischen Mitgliedern bestand; Vorsitzender wurde ein Kopte. Die Franzosen bauten sogar eine koptische Legion auf, die ihre Truppen bei der Einnahme Oberägyptens unterstützte. Die französische Herrschaft dauerte allerdings nicht lange. 1801 mussten sich die französischen Einheiten einer Allianz von osmanischen und britischen Truppen geschlagen geben und aus Ägypten abziehen. Nach der Niederlage der Franzosen bezahlten die Kopten den Preis für ihre Zusammenarbeit mit den Besatzern: Unruhen brachen aus, koptische Viertel wurden angegriffen, geplündert und angezündet. Der Vorsitzende der Gesetzeskommission wurde enthauptet. Außerdem wurde Eigentum von Kopten beschlagnahmt und der Gemeinschaft eine Sondersteuer auferlegt.80
Aus dem Machtkampf zwischen Osmanen und Mamluken, der nach dem Rückzug der Franzosen ausbrach, ging schließlich Mehmed (arabisch: Muhammad) Ali, ein in osmanischen Diensten stehender, in Thrakien gebürtiger, türkisch-sprachiger Albaner, als Sieger hervor. Er war 1801 an der Spitze einer albanischen Einheit in den Reihen der osmanischen Truppen nach Ägypten gelangt. 1805 wurde er vom Sultan Selim III. zum Gouverneur von Ägypten ernannt. Er sollte das Land bis 1848 regieren und vom Osmanischen Reich weitgehend unabhängig machen. Zwar erkannte Mehmed Ali die Oberhoheit des Sultans in Istanbul an und entrichtete einen jährlichen Tribut an die Hohe Pforte, die politischen Geschicke des Niltals bestimmten aber hinfort er und seine Nachfolger. Mehmed Ali und seine Dynastie führten mit Hilfe europäischer Berater eine Reihe von Reformen durch, die vieles dessen, was die osmanischen Sultane während der Tanzimat-Zeit in Angriff nahmen, vorwegnahmen und damit beispielgebend wurden für das Osmanische Reich.81 Allerdings blieben nicht alle Freiheiten, die die Kopten unter der kurzlebigen französischen Herrschaft genossen hatten, unter Mehmed Ali in Kraft. Die ğizya wurde wieder erhoben. Auch scheinen sich Muslime besonders daran gestoßen zu haben, dass Christen Waffen tragen und auf Pferden reiten durften. Mehmed Ali ließ daher 1817 diese Vorschriften für Kopten und Griechen neu bekräftigen. Öffentliche Gottesdienste und Prozessionen sowie das Läuten von Kirchenglocken waren unter seiner Herrschaft aber erlaubt.82
Die von Mehmed Ali eingeleiteten Veränderungen zielten hauptsächlich auf die Schaffung einer schlagkräftigen Armee ab. Notwendig für den Aufbau einer modernen Armee waren eine produktive Landwirtschaft als Basis der Steuereinnahmen, eine effiziente Bürokratie, eine im damaligen Sinne moderne Industrieproduktion zur Versorgung der Streitkräfte und schließlich die Rekrutierung geeigneter Soldaten sowie die Ausbildung der Offiziere. Für Bürokratie und Offizierscorps war ein Bildungssystem europäischer Prägung notwendig.83 Bis zur Regierungszeit Mehmed Alis war die osmanische Provinz Ägypten stark von der türkischen Herrscherschicht geprägt. Auf dem Land wurden alle Verwaltungsposten oberhalb des Ortsvorstehers (ʿumda) von Nicht-Ägyptern eingenommen. 1833 wurden die ersten Ägypter, darunter auch einige Kopten, auf die Posten von Distrikt- und Bezirksvorstehern ernannt. Reformen im Eigentumsrecht für Landbesitz und der Steuerpacht ließen eine Schicht von Großgrundbesitzern entstehen. Auch hiervon profitierten Kopten.84 Schlüsselposten in der Verwaltung vertraute Mehmed Ali aber nicht den Kopten, sondern Armeniern, Griechen und Europäern an, die im Türkischen (der Sprache des Hofes) und europäischen Sprachen gewandter waren als Kopten.
Mehmed Alis Sohn Said Pascha (1854–1863) setzte weitere Reformen um. Im Dezember 1855 schaffte er die ğizya ab und führte einen Monat später den Wehrdienst für Kopten ein. Er nahm damit die Reformen des Ḫaṭṭ-ı hümāyūn des Osmanischen Reichs um einige Monate vorweg. Die Einführung des Wehrdienstes stieß bei den Kopten allerdings auf wenig Gegenliebe und der koptische Patriarch Kyrillos IV. soll den britischen Konsul gebeten haben, sich bei Said für ihre Abschaffung einzusetzen. Tatsächlich konnten sie sich bald wieder von der Wehrpflicht befreien.85
Die Regierungszeit Ismails (1863–1879), der zur Betonung der Unabhängigkeit Ägyptens den Titel Khedive annahm, war für die aufstrebenden Christen besonders günstig. Ismail betrachtete Ägypten als Brücke zu Europa und war stark an der Öffnung des Landes interessiert. So gewährte er einer großen Zahl katholischer Missionen aus Frankreich seine Patronage. Französische Kongregationen hatten maßgeblichen Einfluss auf den Ausbau eines modernen Schul- und Bildungssystems in Ägypten. Neben den Missionsschulen katholisch-französischer Prägung entstanden Schulen der amerikanischen protestantischen Mission, der griechischen Gemeinden sowie der Armenier und Juden. Einige koptische Schulen waren bereits auf Initiative von Patriarch Kyrillos IV. (1854–1861), der sich den Beinamen „Vater der Reform“ (Abū l-iṣlāḥ) erwarb, entstanden. Ismail baute aber auch das staatliche Bildungssystem aus. In der Zivilverwaltung erreichten nun auch Absolventen der koptischen Schulen einflussreiche Positionen.86 Aus der Schicht der koptischen Landbesitzer und der städtischen Notablen rekrutierten sich ab 1866 die Abgeordneten des neu eingerichteten Konsultativrats (mağlis šūrā al-nuwwāb). Unter den 1866, 1870 und 1876 gewählten 74 beziehungsweise 75 Abgeordneten waren auch stets zwei oder drei koptische Landbesitzer aus Oberägypten. Außerdem stiegen Kopten ab den 1870er Jahren in höhere Regierungsämter auf, die vorher der osmanischen Oberschicht, einigen ägyptischen Muslimen sowie Armeniern und Griechen vorbehalten waren.87
Die stürmische Modernisierung Ismails, seine horrenden Ausgaben – unter anderem für den Bau des Suez-Kanals – und die Krise der Baumwollwirtschaft führten Ägypten in den Staatsbankrott. Das Land wurde 1876 europäischer Schuldenaufsicht unterstellt. Ismail wurde 1879 zur Abdankung gezwungen und sein Sohn Tewfik (1879–1892) als Nachfolger eingesetzt. Gegen die europäische Kontrolle über die Geschicke Ägyptens regte sich aber Widerstand in nationalistisch gesinnten Kreisen der Armee. Dies führte 1880 zum Aufstand unter dem ägyptischen Offizier Ahmad ‘Urabi. Der Khedive wurde der Revolte nicht Herr und so sah sich Großbritannien 1882 zu einer militärischen Besetzung Ägyptens bewegt, nicht zuletzt um einer französischen Intervention zuvorzukommen. Mit dem ‘Urabi-Aufstand war ein aggressiver ägyptischer Nationalismus an die Oberfläche getreten. Er trat gegen die türkische Herrscherschicht rund um die Khedivenfamilie und gegen die Dominanz von Türken in den hohen Offiziersrängen genauso auf wie gegen die europäische Beherrschung der Wirtschaft. Mit der faktischen Machtübernahme der Briten bekam er ein neues Ziel. Außerdem führte er den Islam, die Religion der überwiegenden Mehrheit der Ägypter, als Identifikationsmerkmal gegen die britische Verwaltung ins Feld. Die Besetzung durch England wurde als Beherrschung durch eine christliche Macht empfunden. Die wirtschaftlich aufstrebende koptische Oberschicht, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine moderne, europäische Bildung genossen hatte, engagierte sich dagegen für einen säkular geprägten Nationalismus, arbeitete zum Teil aber auch mit den Briten zusammen, je nachdem wo sie ihre Interessen am besten vertreten sah.88
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wuchsen die Spannungen zwischen Kopten und Muslimen. Sie erreichten einen ersten Höhepunkt mit der Ermordung des koptischen Premierministers Butros Ghali Pascha durch einen muslimischen Nationalisten im Jahr 1910. Ihm war vorgeworfen worden, als Christ ein willfähriges Instrument der Briten zu sein. Die Kopten sahen sich durch die öffentliche Debatte um die Ermordung des Premierministers einem immer feindlicheren islamischen Nationalismus ausgesetzt.89 Um dem Druck der muslimischen Nationalisten entgegenzuwirken, versammelten sich über tausend koptische Aktivisten 1911 in Assiut zu einem „Koptischen Kongress“. Der Kongress forderte eine bessere parlamentarische Vertretung der Kopten, gleichen Zugang zum Bildungssystem und allen öffentlichen Ämtern, die Anerkennung des Sonntags anstelle des Freitags als Feiertag für koptische Regierungsangestellte und Studenten sowie die Einführung christlichen Religionsunterrichts in den staatlichen Schulen. Diese Forderungen liefen jedoch den Interessen der nationalistischen Regierung zuwider. Während weite Teile der koptischen Presse die Forderungen des Kongresses unterstützten, stellte die Regierungspresse die Veranstaltung als religiöse Verschwörung dar und beschuldigte die Kopten, willfährige Instrumente der britischen Politik zu sein. Als Reaktion auf den Kongress von Assiut wurde auf Initiative von muslimischen Persönlichkeiten und mit Unterstützung der Regierung nur einen Monat später in Heliopolis bei Kairo unter dem Namen „Ägyptischer Kongress“ zu einer Gegenveranstaltung eingeladen. Die etwa 2.500 Teilnehmer wiesen die Forderungen des „Koptischen Kongresses“ zurück und verwiesen darauf, dass Kopten in der öffentlichen Verwaltung weit überrepräsentiert seien.90 Die Teilnehmer waren sich jedoch nicht einig in der Frage, ob Muslime und Kopten gemeinsam den nationalen Kampf gegen die Kolonialherrschaft führen oder ob die Muslime eine Stärkung der islamischen Identität Ägyptens anstreben sollten.91 Kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs war die ägyptische Gesellschaft tief gespalten: die einen basierten ihre Forderungen auf die Ansprüche der jeweiligen Religionsgemeinschaft (muslimisch oder koptisch), die anderen riefen zu einer Kooperation zwischen Kopten und Muslimen auf der Basis eines ägyptischen Nationalgefühls auf.