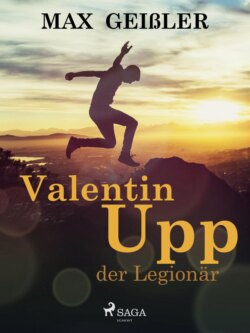Читать книгу Valentin Upp, der Legionär - Max Geißler - Страница 4
Zweites Kapitel
ОглавлениеUm diese Zeit war Valentin Upp, der jüngste Sohn des Bauern, achtzehn Jahre alt.
Nach ihm kamen die drei Mädchen.
Valentin hatte unter den Kindern am meisten von den Eltervätern oder von jenem Veit Upp, der um Sonnenuntergang die Sorgen dem verglühenden Tage nachschickte. Es war die langaufgeschossene zähe Art mit dem trockenen Munde und den Frühlingsaugen.
In ganz jungen Jahren hatten die Upps Haare, die waren beinahe von der Farbe des blühenden Ginsters. Später dunkelten sie bei den Jungen ein wenig nach; bei den Mädchen blieben sie klingend und golden, und die Mädchen hatten auf den Wangen das sanfte Rot der blühenden Heide.
Es waren feste, gesunde Menschen, und die Jungen waren mit fünfzehn fertig für die Soldaten. Grossvater Heinrich war als Reiter 1870/71 mit im Felde gewesen und hatte den Kaiser Napoleon gefangen nehmen helfen — Himmel, das war eine Lust und war ein Leid, so zwischen den Schlachten! Valentin Upp konnte schon als Dreizehnjähriger die ganze Geschichte des Feldzugs aus seinem Herzen vorlesen, so oft hatte ihm der Grossvater im Waldhause die Dinge erzählt, die sich damals zugetragen — von dem grossen Schlage bei Weissenburg an bis zum Einzuge in Berlin, als der greise weisse Kaiser voranritt und das Hurrarufen Unter den Linden bis hinein in die märkischen Wälder lief.
Vater Veit Upp war auch Soldat gewesen — bei dem Brandenburgischen Füsilierregiment Nr. 35, dem jetzigen Füsilierregiment Prinz Heinrich von Preussen — aber der Bauer hatte zu jener Zeit schon in ihm herumgespukt; er hatte den Sterz des Pfluges mit der Flinte vertauschen müssen und war daheim der einzige Sohn. Hatte auch schon ein blondes märkisches Bauernmädchen zur Braut gehabt, die ihm ein paar Acker Land in die Ehe bringen sollte, und noch von einem anderen umworben war ... So war er mit dem halben Herzen daheim im Föhrenwalde geblieben und hatte es auch nur zum Gefreiten gebracht, trotz aller Freude am Soldatenleben, die ihm der Vater ins Herz geredet hatte.
Bei dem jungen Valentin hatte diese Rede Heinrich Upps helleres Feuer geschlagen; denn als der Enkel bei dem Grossvater in der Stube des Waldhauses hockte, waren in dem Alten die Sorgen um das Seine längst nicht mehr da. Und auf dem Gute brauchten sie den Jungen auch nicht. Die Brüder waren von Kind an um Saat und Ernte gewesen — nach dem Kleinen hatte man sich nicht umgeschaut. Und so waren seine Gedanken frühzeitig über die Grenzen der Heimat hinausgeflogen und gerieten aus der Waldeinsamkeit an Länder und Menschen, die ihm des Grossvaters Lust an grossen Erlebnissen zu wunderlicher Schönheit lebendig gedichtet hatte.
Ein angehender Bauer war Valentin Upp darüber zwar auch geworden; aber er hatte als überzähliger Knecht um das tägliche Brot und ein paar Groschen gedient — auf einmal kam ihm die Überzähligkeit zum Bewusstsein.
Da beredete er sich mit dem Grossvater — was eigentlich mit ihm werden sollte; er habe keine Lust, später der Knecht seiner Brüder zu sein.
Der Grossvater hörte diese Frage nicht ungern und sagte:
„Du weisst, dass die Welt weiter reicht als der märkische Sand; und wenn dein Vater dich am liebsten als Bauer auf deiner Heimatsscholle sitzen sähe — womit er ganz recht hat — so soll der Mensch sein Herz doch nicht an Dinge hängen, die so wenig gewiss sind, wie das, was hier auf dich wartet. Und weil ich weiss, dass dein Vater nach einem Wege sucht, auf dem du dich recht ins Leben finden könnest, so sag’ ihm: Ich will bis zu meiner Soldatenzeit in die Welt gehen, etwa nach Süddeutschland oder nach dem Elsass, wovon mir der Grossvater erzählt hat, dass es ein schönes und fruchtbares Land sei; und ich will noch vieles hinzulernen, was ich daheim nicht lernen kann ... Wenn du willst,“ sagte der Grossvater, „so lass mich mit deinem Vater darüber reden und schicke ihn zu gelegener Zeit herüber zu mir.“
So sprachen die beiden im Waldhause miteinander, während Veit Upp an jenem Maiabende sich die Freude an seinem Werk ins Herz schaute.
Als schon die Sterne aufgingen, kam er langsamen Schritts und feierabendlichen Herzens zwischen den Föhren daher und trat ins Waldhaus.
Der Grossvater redete sogleich mit ihm; sie zogen die Sache ein bisschen her und hin, aber weil nicht viel dagegen vorzubringen war, so sagte Veit Upp nach einer Weile:
„Lieber wäre es mir gewesen, es hätte anders sein können. Aber das Glück wächst ja wohl nicht nur im märkischen Sande. Der Grossvater ist sogar einmal im Kriege und ist ein Reiterwachtmeister gewesen, ehe er seine paar Hufen brandenburgischen Acker umgebrochen hat ... So rede mit deiner Mutter, Valentin“, setzte er hinzu. „Es wird da nicht ganz leicht sein, ein Kind aus ihrem Denken und Fürsorgen loszumachen ... aber du kannst ja sehen, wie sie sich dazu stellt.“
Darüber musste Heinrich Upp lachen, dass die Lippen sich über den zahnlosen Kiefern spannten; denn er merkte, dass selbst für den Bauern das Land, das sie 1870 dem Reich und dem Kaiser gewonnen hatten, schier immer noch aus der Welt liege.
Valentin Upp gehörte nicht zu jenen, die einen neuen Gedanken mit leuchtender Leidenschaft aufgreifen und mit ihm spielen als mit einem goldenen Balle. Aber er hörte jedes Wort und legte es in sein Herz als ein Gut, das wert ist, dass man es spare.
Er sass ganz still neben dem Grossvater auf der Ofenbank, lehnte sich wie dieser gegen die Kacheln, hatte die Arme vor der Brust gekreuzt, die Beine übereinandergeschlagen und schaukelte ein paarmal mit dem Pantoffel. Sass dabei, als redeten die Männer von einem, den diese Sache nicht allzuviel anginge. Und es war fein anzusehen, wie diese drei grossen trockenen Gestalten da beieinander waren, aus einem Holze geschnitten und vom gleichen Meister gemacht — der eine das sichere Abbild des anderen in der anderen Zeit.
Die Frau hatte darüber die kleine Lampe aus der Küche hereingebracht, und als sie hörte, wovon die Rede war, sagte sie kein Wort, sondern trat zurück in das Dunkel bei der Tür und dachte: Die Upps haben ein starkes und tapferes Herz, wie man es braucht zum Geradeausgehen.
An diesem Abend trat Valentin Upp zu seiner Mutter in die Küche und sagte zu ihr:
„Wir haben mit Grossvater Heinrich eine Sache besprochen, die dich auch angeht. Die Dinge liegen für mich nicht gut auf dem Hofe ...“
Da wusste die Frau gleich, wohinaus er wollte, und sagte: „Nun ja — jetzt ist das wohl so. Aber es kann kommen, dass einer deiner Brüder in ein anderes Gut einheiratet. Oder du selber.“
„Das ist richtig,“ sagte Valentin Upp, „aber es braucht auch nicht so zu sein. In jedem Fall ist es gut, wenn einer das Leben auch von einer anderen Seite leben lernt. Grossvater meint, in Süddeutschland oder im Elsass wäre feine Gelegenheit dazu. Oder ich könnte auch ins Niederland gehen, gegen die See hin. Mir ist es einerlei.“
Die Frau behielt dabei ihr ruhiges Herz und sagte: „Was meint Vater?“ Und als sie auch dies gehört hatte, fragte sie: „Wann willst du gehen?“
„Warum nicht schon morgen?“ sagte er. Und die Mutter dachte: So sind die Upps alle; sie fassen ihre Gedanken gleich fest an.
„Und wie lange willst du bleiben?“
„Vielleicht ein Jahr oder zwei. Ich kann wohl auch anderswo Soldat werden. Darüber lässt sich jetzt noch nicht reden.“
Er lehnte gegen den Herd, in dem das Feuer niedergegangen war. Und weil er so sicher in die Dinge hineinsah, die vor ihm in der kommenden Zeit lagen, dachte die Frau daran, wie sie diesen fertigen, gesunden Menschen manchmal in Hof und Scheuer hatte nach einem Tagwerk suchen sehen, das er nicht immer fand. Sie ward nun ganz still an ihm und sagte: „Wenn du willst, so kannst du morgen gut gehen. Es ist alles bereit und heil, was du brauchst.“
Weder die Brüder noch die Schwestern wunderten sich über das, was an diesem Abend im Hause vorging. Es war, als hätten sie alles genau so erwartet — Gedanken, die in ihnen langsam gewachsen waren und nun in Blüte standen.
An diesem Abende blieben sie alle länger in der geräumigen, niederen Stube, in der die Decke über der Lampe kräftig angedunkelt war, und redeten von der Reise.
Die Mutter trug ein grosses, fast neues Wachstuch herbei, das sie zur Kirmes oder an den Feiertagen über den Tisch legte. Sie brachten auch ein grünes Gurtband und Riemen und legten sie zu den Dingen, die er mitnehmen wollte: Wäsche und Schuh und die Bilder von Vater und Mutter und eine metallene Deckelschale für die Seife.
Veit Upp aber war um diese Zeit über die Heide zum Gemeindevorsteher gelaufen und liess sich die Papiere ausstellen für seinen Sohn.
Zuletzt sassen Vater und Mutter noch ein wenig mit ihm zusammen und rieten wortkarg an Möglichkeiten herum, die kommen könnten. Jeder sagte sich: sie ständen vor einer Türe, die von keinem ihres Geschlechts je aufgeschlossen worden. Aber sie machten sich die Herzen nicht schwerer.
Zuletzt nahm Veit Upp einen schwarzen Beutel aus dem Schapp, der war noch aus seiner Jungmannszeit darin, und trug auch die kleine Geldtasche herzu, die er während seiner Dienstzeit am Riemen auf der Brust getragen hatte. Er tat in beide etliches Geld und gab sie ihm.
Am anderen Morgen, als die Welt noch voller Tau und feinem Frühnebel hing, waren schon alle wach und waren an ihrer Arbeit.
Da ging Valentin Upp zu jedem hin und sprach ein gutes Wort, und sie lachten einander dabei an, aber es fand sich keins recht heraus aus der Wehmut des Abschiednehmens. Danach ging er aus dem Hof und ging aus dem Tore. Er hatte die aufgehende Sonne im Rücken.
Als er bei dem Haus in den Föhren durch die Scheiben sah, waren die Alten schon da, drückten ihm die Hand und gaben ihm ihre guten Wünsche und einen Taler.
Er sagte, er wollte bis nach der Stadt Halle wandern und dann mit der Bahn fahren und wieder wandern — so immer im Wechsel, bis er etwa nach Metz oder Strassburg käme ... Es war eine jener Minuten, in denen alle Türen an den Herzen aufgehen und alle Fenster; und aus jedem klingt ein warmes Wort, schauen ein Paar liebe, sorgende Augen.