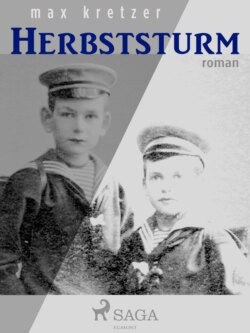Читать книгу Herbststurm - Max Kretzer - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.
ОглавлениеEs gibt ohne Zweifel Zustände im Seelenleben eines Menschen, in denen er die Nachtigall im November schlagen hört, sich um diese Zeit an Flieder- und Maiglöckchenduft berauscht, und zum Überfluss noch den Lenzesglanz unter azurblauem Himmel erblickt, trotzdem draussen der Herbstregen gegen die Scheiben klatscht und seinen faden Wassergeruch durch die offne Balkontür treibt. Die gemeine Aussenwelt ist dann erstorben, das Paradies der Einbildung öffnet sich, die Liebe schwingt den Zauberstab und lässt im Herzen die frischen Keime spriessen, über die eine Fülle rosenroten Lichts sich ergiesst. Und ist es auch eine späte Saat, die zäh die Kruste durchdringt, lockt die Sonne nur noch mit spröder Kraft, kaum die Ernte verheissend, die erwartet wird — der Verstand ist taub geworden, die Vernunft badet sich nur in Wonne, und die Torheit treibt ihr köstliches Narrenspiel.
Wenn es anders gewesen wäre, wie hätte sich sonst Werner Ulten, schon im Frack, die Gardenie im Knopfloch, noch immer abplagen können, zur Bewunderung eines jungen Mädchens den Pegasus zu tummeln, den er mit all der Unsicherheit eines Fünfundvierzigjährigen bestiegen hatte, dem es schwer wird, die rhythmische Gangart herauszubringen, wenn auch die überquellenden Gefühle sozusagen die Geistessporen zu jedem neuen Antrieb sind. Und er hatte doch so manchen Gaul gebändigt, war flott über alle Hindernisse gegangen, nicht nur in seiner schönen Leutnantszeit, sondern noch in den letzten Jahren, als das trostlose Luderleben Dank der Grossmut seines jungen Bruders rasch ein Ende genommen und ihn wieder auf jene Höhe gebracht hatte, von der aus er verachtungsvoll in die Niederungen blicken konnte, in denen er eine Zeitlang „anständig vegetiert“ hatte, wie die Daseinsumschreibung all der Niedergebrochenen lautet. Selbst der etwas steife, rechte Arm, konnte ihn nicht von neuen verwegenen Reiterkunststücken abhalten, die er an schönen Tagen am Charlottenburger Hippodrom zum besten gab.
Und nun war ihm zu diesem Glück ein zweites zugeflogen: Rita Keith, das Geschöpf mit den schweren Flechten und dem krausen Sinn, das auf seinen Lebensweg geschneit war wie eine duftende Blüte, losgelöst vom übervollen Frühlingsbaum. Damit wenigstens hatte er sie soeben verglichen, als die poetisch gebundenen Worte ihm wie einem verliebten Primaner aus der Feder flossen, von jener Überschwenglichkeit tropfend, die der Johannestrieb in den goldnen Becher schüttet. Sein narbenreiches Don Juan-Herz hatte eine neue Wunde bekommen, die ihm aber diesmal so tief und unheilbar dünkte, dass er in Gedanken die ganze Hausapotheke seiner Erfahrungen durchsuchte, um das nötige Besänftigungspflaster dafür zu finden.
Weshalb war sie gekommen, sie, die er in Wahrheit mit der Libelle verglich, die über den Sumpf seines trügerischen Daseins flatterte, um ihn gleich einem verführerischen Irrlicht aus seiner Ruhe zu bringen, hinwegzulocken nach einem Wohin, von dem er noch nicht wusste, würde es in der Tiefe oder auf einem festen Gestade sein!
Die bekannten drei Klingelzeichen schreckten ihn auf, und als er es eilig hatte, um dem Bruder zu öffnen, schlug der Zugwind die Balkontür zu und trieb die losen Papierblätter vom Schreibtisch auf den Teppich. Die Scheiben klirrten, und die Gasflamme der Arbeitslampe züngelte hoch empor.
„Hoi, hoi, der Herbststurm tobt,“ sagte Werner und hiess den Jüngeren im dunklen Korridor willkommen, bevor er ihm voran ins Zimmer ging, um rasch die Glastür zu schliessen und nach den losen Seiten zu suchen, die er mit einer gewissen Schamhaftigkeit unter einigen Büchern verbarg. Dann erst drückte er sein Erstaunen aus: „Was, wieder in Zivil? Du, hör’ mal —!“
„Man kann doch nicht immer in der bunten Jacke herumlaufen,“ gab der andre zurück und legte die in Seidenpapier eingewickelten langstieligen Rosen beiseite. „Und gerade heute, weisst du, passte es mir absolut nicht. Das geht ja auch alles ohne Aufregung ab. Man flitzt so schön in die Droschke hinein, schindet vergnügt den Abend und flitzt dann wieder ungesehen heraus.“
Der Ältere nahm die Haltung eines Vorgesetzten an und drohte scherzhaft mit dem Finger. „Einjähriger Ulten, nehmen Sie sich in acht, dass man Ihnen das Privatwohnen nicht versalzt und Sie zur Strafe vier Wochen in die Kaserne einzieht.“
Und sogleich stellte sich der Jüngere stramm hin und erwiderte mit demselben komischen Ernst: „Herr Leutnant Ulten wollen entschuldigen, aber es soll nicht wieder vorkommen.“
„Hoffentlich hast du wenigstens Urlaub,“ fuhr Werner lachend fort und machte zugleich Licht am Kronleuchter, da die grünumflorte Schreibtischlampe nur einen geringen Schein verbreitete.
„Bis ins Bewusstlose,“ erwiderte Walter gut gelaunt und sah sich nach einem Platz für seinen Zylinder um.
„Na, dann geht’s ja noch, es wird dir ja heute niemand auf die Bude steigen,“ sagte der andere wieder. „Aber für die Folge führe doch lieber deine Schnüre spazieren. Die Karre könnte doch mal schief gehn.“ Dann wetterte er über andre Dinge los, mit all der Lebhaftigkeit, die immer die stille Wonne des Nachgeborenen bildete. Heute müsse er selbst den Diener spielen, denn seine Haushälterin, die gute Frau Schlierke, scheine auf ihre alten Tage noch tanzen zu gehn; es sei nun schon der dritte Sonntag, an dem sie ihn wie einen Waisenknaben versetzt habe.
„Leg’ doch ab, wir haben noch Zeit,“ fuhr er fort und wollte ihm beim Abziehen des Paletots behilflich sein, wogegen sich Walter jedoch wehrte, denn er sah darin etwas wie ein Dankgefühl für Dinge, deren Gewährung er für selbstverständlich hielt.
Beide Brüder standen sich nun im Frack gegenüber, der Ältere aufgeschossen, schlank und biegsam, unverkennbar der Typus des früheren Offiziers, neuerdings der gewiegte Lebenskünstler in full dress, der elegante Zeittotschläger, an dem alles mit einem gewissen Schwung peinlich abgewogen ist: vom kühngestrichenen Haar und dem Bartzwirbel à la Haby, und von der weissen Weste, durch deren Knopfloch die dünne Kette gezogen ist, bis hinab zum weichen Pariser Lackschuh; und der Jüngere mittelgross und breitschulterig, etwas unbeholfen in seinen Bewegungen, zwar in Wichs geworfen wie der andere, aber mehr nach bürgerlicher Art zurechtgemacht, mehr für die gute Stube geschaffen, als für den Salon. Der Grosse der Mann der Welt, der sich fast daran gewöhnt hat, im Frack zu schlafen, der Kleine der Sonntagsgast, der sich notgedrungen eingezwängt sieht in das unentbehrliche Gewand des Festes.
Und so gross der Gegensatz in ihrer Gestalt war, so wenig ähnelten sie sich auch im Gesicht. Werner zeigte ein gerades Profil mit feinen Linien, die fast in einem Zuge schön ausliefen, während bei Walter die Ecken und Rundungen sich stiessen, ohne dass er dadurch hässlich wirkte. Der Ältere war mehr die ausgeführte Zeichnung eines Idealkopfes, der Jüngere glich mehr einer keck hingeworfenen Skizze, die aber doch den Meister verrät. Werner war die abgeklärte Stille nach vielen Lebensstürmen, in Walter drohte noch das heraufziehende Gewitter, das aber selten zum Ausbruch kam, weil ihm die harte Arbeit seiner Jugend keine Zeit zur Entfesselung der Leidenschaften gelassen hatte.
Zwanzig Jahre jünger als der andre, hatte er stets den gehörigen Abstand von ihm empfunden, was ihn schon als Kind einschüchterte, weil er es sich niemals hatte vorstellen können, dass an der Wiege eines kleinen Kerlchens plötzlich ein ausgewachsener Bruder stehen könnte, den man als Spielkameraden behandeln sollte. Und wenn er oftmals die dunkelsten Erinnerungen an seine Kinderzeit durchging, fand er es schier lächerlich, immer zwei grosse Männer um sich gehabt zu haben, die ihn abwechselnd auf den Arm nahmen, als müssten sie sich in die Vaterfreude teilen.
Und etwas von diesem Erziehertum hatte sich Werner bis auf den heutigen Tag bewahrt, was er gerade jetzt wieder bewies, als er den Jüngeren keck an die Schultern fasste und ihn wie einen eingekleideten Einsegnungsjüngling drehte, wobei er sagte: „Lass mal sehen, ist das der neue? Sitzt ja patent, ganz patent. Junge, du wirst Aufsehen machen.“ Und während er ihm über den Rückenteil des Fracks strich, diesen dann vorn über der schmucken Weste wie zum Spasse zusammenzog, um seine Knappheit zu prüfen, sodass er ein wohlgefälliges Lachen hervorrief, versuchte er dem Jüngeren die gesellschaftliche Schüchternheit zu nehmen, indem er ihm lebhaft schilderte, wie gut aufgehoben sie heute bei Frau von Steckel né Krukenberg sein würden, die es endlich erreicht habe, diesen Prachtkerl von Bruder, der es mit kaum vierundzwanzig Jahren bis zum angehenden Grossindustriellen gebracht habe, zu ihren Gästen zu zählen.
„Du, ich hab’ Angst,“ brachte Walter mit wenig schlauer Miene seine stete Redensart an, die jedesmal fällig wurde, sobald ihn der Ältere in seine Kreise mit verfeinerten Lebensgewohnheiten führen wollte, was übrigens noch nicht oft vorgekommen war. Besonders in Gesellschaft kluger Frauen geriet der Jüngere leicht in Verlegenheit, und sein ganzer Mutterwitz schrumpfte zusammen, sobald er sich in eine längere Unterhaltung mit ihnen einlassen sollte.
Werner griff in das lose, nussbraune Haar des Bruders, das einen gewissen Wildurstand zeigte, ziepte ihn zum Scherz daran und sagte: „Hör’ mal, mein Junge, es wird Zeit, dass du deine Weiberscheu endlich lässt.“
„Ach, ich bin ja gar nicht so,“ erwiderte Walter lachend und trat vor den Spiegel, um seine Frisur zu prüfen. „Denk’ nur nicht, dass ich nicht auch schon meine Erfahrungen hinter mir habe. Aber siehst du, das ist doch ’ne ganz andre Sorte, die in meinem Teich herumschwimmt. Durchschnittsware, wie wir Kaufleute sagen. Du hast eben einen ganz andern Umgang.“
Werner stellte sich wie ein Ankläger vor ihm hin. „Ja, sag’ mal, das klingt ja ganz verdächtig, du wirst doch nicht etwa in schlechte Gesellschaft geraten sein, he? Vielleicht gar gewisse Balllokale besuchen, obendrein ohne mich, wie? Du, hör’ mal, mein Junge, das wäre Verrat an deinem älteren Bruder. So etwas tut man doch nicht ohne einen erfahrenen Führer.“
Walter lachte geschraubt. „Kann man’s wissen?“ sagte er dann und bemühte sich, dem Schnurrbärtchen eine gewisse kümmerliche Flottheit zu geben, um hinter dem grossen Vorbild nicht zurück zu bleiben. Angesteckt durch die übermütige Laune des andern, überwand er jedoch rasch seine Verlegenheit. „Ach ich meinte ja nur so alles, was bei unsrer soliden Frau Mitchef herumkreucht und fleucht an süssen Philistermädels, mit und ohne schiefe Hüften ... Was denkst du übrigens, sie will mich absolut unter die Haube bringen, nach dem alten Grundsatz: ‚Jung gefreit, hat niemals gereut!‘“
„Na, erst reisse nur dein Jahr ab, und dann können wir ja weiter darüber sprechen,“ warf Werner heiter ein. Dann aber, als der Jüngere nicht locker liess und meinte, er würde gern einmal unter Führung des andern der „Sumphonie“ des nächtlichen Berlins lauschen, wehrte Werner diese Zumutung durchaus ernst ab, indem er mit einer gewissen Weichheit sagte: „Das wollen wir doch lieber bleiben lassen, mein Junge, es war nur Scherz. Schon genug, dass ich das räudige Schaf in der Familie war, dich möchte ich doch vor einem ähnlichen Schicksal bewahren. Du weisst, ich habe immer Vaterstelle an dir vertreten. Also bleib hübsch gehorsam. Du wenigstens sollst oben im klaren Wasser schwimmen, mein Leben ist doch ein halb verpfuschtes.“
Sein Maitraum war verschwunden, und er hörte jetzt wirklich nur den Herbstregen draussen gleichmässig niederschlagen, und dazwischen den klagenden Gesang des Windes, der die kahlen Bäume in dem grossen Hintergarten ächzen machte. Denn seine Stimmung hatte jäh gewechselt, wie immer, wenn er daran dachte, dass er mit Leib und Seele Offizier gewesen war und im schönsten Mannesalter seinen Abschied hatte nehmen müssen, weil die erbarmungslosen Manichäer die Wechsel nicht mehr verlängern wollten und keine Deckung vorhanden war. Mit Schrecken stand ihm jener Tag wieder vor Augen, als er mit Urlaub nach Berlin gekommen war, um die Notfrist gründlich auszunutzen. Das war zur Zeit, als es mit dem alten Ulten bereits gekracht hatte, der sich nach Aufgabe seiner Landwirtschaft in der Uckermark in allerlei unerspriessliche Gründungen für Bodenkultur eingelassen hatte. Drei Tage lang lief sich der Alte die Sohlen ab, um die achttausend Mark aufzutreiben. Alle Bekannten und Verwandten wurden erfolglos abgeklappert. Und als der Alte schon in hellster Verzweifelung daran dachte, die bald auszahlbare Lebensversicherung an die Gesellschaft zu verkaufen, um die Gläubiger wenigstens vorläufig zu beruhigen, war es zu spät. Der Oberst hatte bereits Kenntnis erhalten, und der Abschied war unabwendbar.
Die Mutter jammerte, und alle Tanten taten dasselbe, denn „der Stolz der Familie“ war gefallen, obendrein nahe vor dem „Premier.“ Die Tragik wurde dadurch noch erhöht. Das schlimmste aber war, dass die paar letzten Kröten des Alten nun doch noch flöten gingen, weil Werner einen Kameraden als Bürgen mit hineingezogen hatte, den er vor dem gleichen Schicksal wenigstens bewahren musste.
Zum ersten Male sah der zehnjährige Walter die Eltern weinen, hörte er eine Szene zwischen Vater und Sohn, die die Wände erzittern machte. Der Alte klagte seinen Jungen an, während dieser nur Vorwürfe dafür hatte, dass man ihn in eine Karriere getrieben habe, ohne die erwarteten Opfer bringen zu können. Es war die alte Geschichte: man hatte sich gegenseitig die Verhältnisse gründlich verheimlicht, bis die Wahrheit um so fürchterlicher an den Tag kam. Schliesslich aber hörten die Vorwürfe auf beiden Seiten auf, übrig blieb nur das dumpfe Verzichtleisten auf alles, was war und hätte sein können.
Der Alte konnte den Schlag nicht überwinden und sank bald, ganz mürbe geworden, ins Grab. Die Brüder hielten wacker zur Mutter, aber der Lebenskampf brachte sie auseinander, wie zwei ganz verschiedene Schwimmer, von denen der eine willenlos umhergetrieben wird, während der andre kühn sein festgesetztes Ziel nimmt. Werner hatte verschiedenes versucht, sich ehrlich durchzuschlagen. Hintereinander war er Privatsekretär bei einem hohen Herrn, besserer Versicherungsbeamter und schliesslich Angestellter in einem Offizier-Verein gewesen; jedesmal jedoch hatten ihm seine noblen Passionen einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn sobald er fest im Sattel zu sitzen glaubte, wurde er rückfällig, d. h. er machte aufs neue Schulden, die ihm schliesslich seine Stellung kosteten.
Und während er so die unglückliche Existenz eines Menschen führte, der weder schlecht noch unredlich ist, den besten Willen zu allem hat, aber jedesmal seiner unglücklichen Veranlagung unterliegt, bewegte sich der Nachgeborene und in der Erziehung Zurückgebliebene in stetem Aufstieg zu einem glänzenden Erfolge. Kaum fünfzehn Jahre alt, war er in die Metallwarenfabrik von Clemenz eingetreten, die noch nicht lange bestand, sich aber im besten Aufschwung befand, weil sie das Patinodum erfunden hatte, eine Art Neusilber, das aber an Güte und Billigkeit alles bisher Dagewesene übertraf. Bald fand der Chef Gefallen an dem aufgeweckten, jungen Menschen, der von früh bis spät nur das Interesse seines Hauses im Auge hatte und nach Geschäftsschluss noch das Bestreben zeigte, sich auch geistig zu fördern, um die Lücken seiner Schulbildung zu überbrücken. Er nahm ihn vom Lager ins Kontor, wo er ihm bald eine bevorzugte Stellung einräumte, wie sie sonst nur ältere Leute einzunehmen pflegen.
Schon mit zwanzig Jahren hatte Walter die Postprokura, und als er nach mancherlei nächtlichem Brüten ein Mittel erfand, das Patinodum vor Schwarzwerden zu bewahren, nahm ihn der Chef kurz entschlossen als Teilhaber in die Fabrik, indem er die Verbesserung mit einem bestimmten Kapital bewertete, das als Einlage zu gelten hatte. Das war im selben Sommer geschehen, als Werner in Ostpreussen bei einer Gestütsverwaltung einen Unfall vom Pferde hatte, sodass nun der Jüngere nichts Eiligeres zu tun wusste, als den einstigen Familienstolz sofort nach Berlin kommen zu lassen, um ihn sozusagen in die Rechte eines Grandseigneurs zu setzen, der nun endlich nach seinen Neigungen leben durfte, ohne sich mit dem Gedanken an den andern Tag zu plagen.
Er bezahlte Werners Schulden, liess ihn eine elegante Gartenwohnung im äussersten Westen beziehen, die er mit einer gewissen Verschwendung ausstattete, schickte ihm an jedem Ultimo einen anständigen Scheck, und tat auch noch so manches andre, was mit aussergewöhnlichen Kosten zusammenhing. Sein einziges Bedauern dabei blieb, dass er mit all diesen Zärtlichkeiten nicht auch die Mutter noch überhäufen konnte, die nun dem Vater gefolgt war. Je gefestigter aber seine soziale Lage wurde, je haltloser wurde die des andern. Werner sah die Goldgrube, gewöhnte sich daran und griff immer tiefer hinein, manchmal so vorzeitig, dass seine Finger schon den Boden berührten, bevor die neu füllende Hand wieder da war. Aber der Jüngere verzieh ihm alle Schwächen, wie man sie einem höheren Wesen verzeiht, zu dem man seit frühester Jugend gewöhnt ist, emporzublicken. Er wusste, dass dieser hübsche Kerl stets die Hoffnung und der Liebling der Eltern gewesen war; ihm selbst aber erschien er immer als das Vorbild unerreichter Schneidigkeit, und so hielt er es für ganz selbstverständlich, wenn er alles mit ihm teilen müsse, um dadurch zugleich die Alten noch im Grabe zu ehren, die seiner Meinung nach unter ähnlichen Umständen dasselbe getan hätten, wie er.
Dritten Personen gegenüber sprach er von Werner nie anders als von seinem „Bruder, dem Offizier“, wodurch er sich gleichsam gesellschaftlich mit gehoben fühlte. Dass der alte Glanz bereits vorüber war, genierte ihn nicht; für ihn blieb die Eigenschaft bestehen.
Und gerade heute, wo er von Stolz erfüllt war, neben dieser prächtigen Erscheinung den Abend geniessen zu dürfen, betrübte es ihn besonders stark, den Bruder sich selbst verkleinern zu sehen. Sofort aber glaubte er die Ursache zu dieser Stimmung zu erraten. „Schmerzt dich dein Arm wieder?“ fragte er teilnahmsvoll, weil er wusste, dass bei dem Sturz damals eine nervöse Schwäche zurückgeblieben war, die oftmals in Zuckungen ausartete, namentlich, wenn jäh die Witterung umschlug. Die Ärzte hatten es als ein rheumatisches Leiden erklärt; eigentlich aber war es nur die Folge der Erschütterung, die der ganze Körper davongetragen hatte, und die der Ältere in Augenblicken seelischer Aufregung am heftigsten durchkostete. Das ging so weit, dass er beim schreiben manchmal den Krampf in den Fingern bekam, was ihn schon wiederholt dazu getrieben hatte, sich den Gebrauch der linken Hand für alltägliche Dinge anzugewöhnen.
Werners graue Gedanken verflogen rasch, denn als er in die grossen, treuen Augen des Jüngeren blickte, schämte er sich fast, seinem Selbstvorwurf mit soviel Milde begegnet zu sehen. Im Stehen zog er ihn an sich und drückte einen Kuss auf seine Stirn.
„Kerlchen, du, der du immer Verzeihung für mich hast! Ich ohrfeige mich moralisch, und du möchtest mir am liebsten eine teure Kur verschreiben. Weiss schon, weiss schon, was du sagen willst!“ Er hielt ihn nun an den Schultern gefasst und wippte ihn sanft hin und her. „,Du musst nach dem Süden, Werner,‘ willst du sagen, nicht wahr? ‚In Wiesbaden hast du ja doch nur geflirtet, statt den Soliditätsprotzen zu spielen. Dort unten aber, irgend wo auf Capri oder sonst wo im warmen Sonnenschein wird es dir besser tun, wieviel brauchst du, Werner?‘ Nicht wahr, mein Junge, das alles hängt dir schon auf den Lippen? Fehlt nur noch deine berühmte Bewegung nach dem Portefeuille, die für mich schon zum reinen Mechanismus geworden ist.“ Und als der Kleine nun vergnügt nickte, fuhr der Grosse in einem Zuge fort: „Aber nein, mein verflixtes Kerlchen, diesmal hast du fehlgeschossen mit deiner Diagnose. Es gibt nichts mehr von Reissen und Schwäche, Frühlingsblut durchströmt meine Adern, und willst du es nicht glauben, so pass auf, ich beweise es dir sofort.“
Und er ergriff mit der schwachen Rechten einen Stuhl und streckte ihn langsam wagerecht, sodass vor Anstrengung sein Gesicht braunrot wurde.
„Bravo, bravo!“ rief Walter aus, trotzdem er merkte, wie diese Kraft eigentlich nur geheuchelt war. Aber Werner fühlte sich dadurch so gehoben, dass er ihm sofort beweisen wollte, was alles er jetzt unternehme, um den Arm zur Untertänigkeit zu zwingen. Seit einiger Zeit übte er sich mit einer schweren Luftpistole im schiessen, und so liess er auch im Salon das Licht aufflammen und schoss von dort durch die offne Tür auf die Scheibe, die er rasch im Balkonzimmer aufgestellt hatte. Und als verschiedene Bolzen kraftvoll eingeschlagen waren, sagte er mit freudiger Genugtuung: „Sieh’ mal, Junge, wie das sitzt. Dreimal hintereinander elf. Deubel, das nennt man doch nicht zittern! Jeden Tag treibe ich das jetzt. Macht mir riesigen Spass. Willst du glauben, das ist die beste Massagekur ... Übrigens geht’s auch mit der Linken ... pass mal auf, mein Junge. Man kann nie wissen, wozu auch diese Abwechselung mal nutzt.“
Walter merkte ihm aber an, wie er den linken Arm nur um deswegen benutzte, weil der rechte ihm nach und nach versagt hatte. Trotzdem liess der Jüngere aufs neue Bewunderung folgen, weil er wusste, dass diese Täuschung zugleich eine Art Gesundung für den Bruder war.
„Ja, mein Junge, der Wille macht viel,“ sagte Werner zum Schluss, als er das Schiesszeug flugs beiseite brachte. „Und siehst du, mein Sohn, ich will jetzt, dass heisst zu dir gesagt: in meinem Dasein gehörig umschwenken. Es muss anders werden, ganz anders! Donnerwetter ja, es wird Zeit, dass ich nun endlich mal diesem, na, sagen wir schon Lotterleben entsage ... mal wieder neu auf die Welt komme! Verflucht, so alt bin ich doch noch nicht, um als Salontatterich zu enden, der um vier Uhr morgens schlafen geht und gegen Mittag erst aufsteht. Ein wenig auch durch deine unverantwortliche Güte, nimm mir’s nicht übel. Ich muss doch endlich mal meine Schulden an dich abtragen. ... Ja, ja, ich weiss schon, was du wieder sagen willst. Es sei nicht nötig, du hättest es ja dazu, und du seiest mir sozusagen auch verpflichtet — von damals noch, als dir vorzeitig die Luft auszugehen drohte. Ewig dasselbe von dir! Aber das waren ja Kinkerlitzchen gegen all die feurigen Kohlen, die du auf mein Haupt ladest. Und die brennen mir schon lange zu sehr. Du sollst doch nicht später mal an meinem Grabe stehen, mit dem Gedanken: ‚Hier ruhet einer, der immer nur erntete, aber niemals säete.‘“
Den angegriffenen Arm in den tiefen Ausschnitt der Weste geschoben, ging er wie in einem Verjüngerungsrausch auf und ab, ohne dass Walter ihn in diesem frommen Selbstbetrug störte. Plötzlich aber blickte er doch von seinem Sessel auf, denn während draussen der Regen kein Ende zu nehmen schien und der Herbststurm ihn in ganzen Schwaden über den grossen Balkon trieb, begann Werner seinen verkannten schönen Bariton zu erproben, indem er wie in Verzückung loslegte: „Winterstürme wichen dem Wonnemond ...“
Dadurch fühlte sich der Jüngere veranlasst, an den Schreibtisch zu treten und auf eine Photographie zu tippen, die einen ganzen Berg von ähnlichen Herzensandenken krönte: „Du, ist sie das?“ fragte er.
Werner liess die Winterstürme in Gedanken weiter entweichen und war sofort an seiner Seite: „Nee du, noch nicht,“ erwiderte er vergnügt. „Aber siehst du, die war mein Unglück, denn ihretwegen ritt ich mich zuerst hinein. Sieht naiv aus, was? Dafür wird sie wohl jetzt irgendwo schon Mütterrollen spielen, vielleicht in Bumsdorf an der Schwemme. Der Teufel brachte sie an unsern Musenstall, wo sie gerade mich auszunehmen wusste. Na es waren amüsante Stunden. Der liebe Gott beschütze meine Nachfolger.“
Er war heute Nachmittag beim Aufräumen verschiedener Schubkästen gewesen, und so packte er den ganzen Kram jetzt wieder ein, Briefe und Photographien wirr durcheinander, zum grossen Leidwesen Walters, der gern ein wenig weiter geschnüffelt hätte, dafür aber den Trost bekam, dass diese „ganze Couleur“ so ziemlich auf eins hinauslaufe, was die Qualität anbetreffe, nur dass sie sich durch andre Farben unterscheide, in diesem Falle durch schwarz, braun und blond.
„Du, deine Routine darin, die möchte ich haben,“ sagte der Kleine plötzlich mit so unschuldsvoller Miene, dass der Grosse nicht bloss beim Lächeln stehen blieb, vielmehr in laute Heiterkeit ausbrach.
„Lieber nicht, mein Sohn. Du siehst ja, wie weit man dabei kommen kann. Zum Tagedieb mit andauerndem Nachtdienst in jener Welt, in der man sich nicht langweilt, die uns aber mit grausamer Wonne langsam die Nerven abstumpft und noch so manches andre. Du bist zu schade dazu.“
Einige Augenblicke überlegte er, dann aber schwankte er nicht mehr; denn was sie beide wussten, wusste nur einer. Er griff nochmals nach dem Schlüsselbund und holte das Bild derjenigen hervor, die der andre vorhin gemeint hatte. „Frau Schlierke braucht es noch nicht zu wissen, sonst hätte ich schon längst meinen Schreibtisch damit geschmückt, das kannst du dir doch denken,“ bemerkte er dabei und liess ihn dann allein, um sich draussen im Korridor die Gummischuhe überzuziehen.
Wieder mit der Garderobe zurückgekehrt, rief er fragend aus: „Ein Mädel, du, was? Rassekopf! Natürlich kein Vergleich mit der Wirklichkeit. Na, du wirst sie ja sehen und deine Augen machen ... Avanti. Reiss dich los, ich glaube ja, dass es dir schwer wird. Aber Junge, nimm sie mir nicht fort, denn du hast die Moneten.“
Aber er sagte es nicht ernst, mehr im Scherz eines Siegers, der einem andern auch gern den harmlosen Anteil an einer schönen Beute gönnt.
Walter schwieg, denn noch immer im Anblick versunken, hörte er kaum die Worte. Dann aber stammelte er wie in einer Mitverzückung: „Du, die hat wirklich so etwas Seltenes. Ich bin neugierig ...“
„Das kannst du auch, mein Sohn. Solche Schätze hebt man nicht alle Tage.“
Werner drehte das Gas aus; dann liess er den Bruder zuerst hinaus und verschloss sorgsam die Türe.