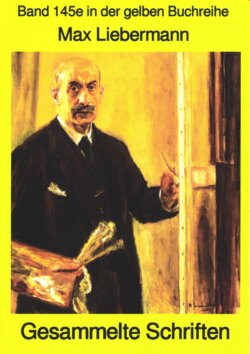Читать книгу Max Liebermann: Gesammelte Schriften - Max Liebermann - Страница 9
Degas „Plan“, 1896
ОглавлениеDegas „Plan“, 1896
Mit einem Leichtsinn, den ich leider nicht einmal mit meiner Jugend entschuldigen kann, hatte ich die Aufforderung einer Kunstzeitschrift, ein paar Zeilen über Degas zu schreiben, angenommen.
Edgar Degas – 1834 – 1917
Ich glaubte, dass die Überzeugung den Redner mache und dass Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vortrage. Auch das Fontane'sche Wort, „die einfache dumme Kuh trifft immer das richtige Gras“, fiel mir ein.
Gar zu bald merkte ich aber, dass die Sache doch nicht so leicht sei, und dass ich die Erzeugnisse meiner neuen Kollegen, der Herren von der Feder, gewaltig unterschätzt hatte.
Auch glaube ich, dass es kaum einen Künstler gibt, dessen Wesen schwerer in Worte zu fassen ist, als das des Degas. Die Vorzüge von Menzel kann man z. B. fast mathematisch beweisen: seine Meisterschaft in der Beherrschung des Materials, seine unendliche Kunst: jeder Technik, dem Holzschnitt, der Lithographie, der Feder- oder Bleistiftzeichnung, das Äußerste an Ausdrucksfähigkeit abzugewinnen; das Genie, mit dem er das Zeitalter Friedrich des Großen uns veranschaulicht hat, wie er auf einen Raum von 12 cm – die Illustrationen zu den Werken des großen Königs durften dieses Maß nicht überschreiten – ihn und seine ganze Zeit verkörpert hat; seinen beißenden Witz und die unerbittliche Wahrheit, womit er Menschen, Tiere und Landschaft schildert; sein riesiges Wissen und Können und seinen ebenso riesigen Fleiß.
Nichts von alledem bei Degas. Mit dem Verstand ist ihm nicht beizukommen. Es ist eine rein sinnliche Kunst, die nicht zu verstehen, sondern nur zu empfinden ist.
Nichts Positives – nur Suggestives.
Degas: Tänzerinnen
Nach akademischen Begriffen kann er weder zeichnen noch malen; statt tiefer philosophischer Ideen bringt er das Leben der Tänzerinnen, der Putzmacherinnen, der Jockeys auf die Leinwand – kurz das Allertrivialste.
Auch fehlt ihm jede offizielle Bestätigung für seine Größe. Er hat weder Titel noch Orden – den einzigen, der ihm je angeboten wurde, die Ehrenlegion, lehnte er ab – noch kann er, wie der selige Meissonier oder Gérôme, den Beweis für seine Unsterblichkeit durch seine Zugehörigkeit zum Institut – die Vierzig sind bekanntlich alle unsterblich – erbringen. Ja sogar vor wenigen Jahren petitionierten die Akademiker beim Minister – es war natürlich in Frankreich –, dass Degas' Werke nicht im Luxembourg aufgenommen würden. Und trotzdem werden kaum eines lebenden Malers Bilder so teuer bezahlt wie die von Degas. In New York wie in London, in Paris wie nun endlich auch in Berlin, reißen sich die Amateure um seine Bilder, was umso wunderbarer erscheint, als nie ein Maler weniger für den Verkauf gearbeitet hat als er. Nichts von dem, was man liebenswürdig oder gar schön oder ausgeführt nennen könnte.
Eins aber ist in seinen Bildern, was uns reichlich für das Fehlen dieser Qualitäten entschädigt: eine eminente Persönlichkeit. Goethe sagt einmal in den Gesprächen mit dem Kanzler von Müller: „die Natur ist eine Gans, man muss sie erst zu etwas machen.“
Waren wir tausendmal vorbeigegangen, ohne es zu bemerken, Degas macht es uns offenbar. Er findet das Gold, das auf der Straße liegt. Alles ist bei ihm Intuition, daher der plötzliche, unmittelbare, schlagende Eindruck.
Seine Bilder scheinen entstanden – ganz zufällig – und nicht gemacht. Nichts von verstandesmäßiger, kalter Berechnung. Jedes seiner Bilder scheint sein erstes; so tastend, so von scheinbar schülerhafter Unbeholfenheit sind sie.
In keines Meisters Manier oder auch dessen Rezept; ohne irgendwelchen Chic; einfach und ungeschminkt die Natur, wie er – Degas – sie sieht.
Es ist das Verdienst der Impressionisten – Manet an ihrer Spitze – dass sie zuerst wieder ohne Voreingenommenheit an die Dinge herangingen. Statt der verstandesmäßigen Malerei der Akademie mit dem Rezept von Lokal-, Licht- und Schattenton versuchten sie, wie sie ihn sahen, jeden Ton auf der Palette zu mischen und auf die Leinwand zu setzen. Die Schulvorschrift lehrte: Das Licht ist kalt, der Schatten warm; die Impressionisten pfiffen auf diese Lehre und malten Licht und Schatten rot, violett oder grün, wo und wie sie es sahen.
Diese Tat, so einfach und natürlich wie die Geschichte vom Ei des Columbus, wirkte wie eine Revolution und ich gestehe, dass ich mir, als ich vor 30 Jahren die ersten Bilder der Impressionisten sah, keinen Vers darauf machen konnte. Man muss eben so sehen lernen wie man einen Beethovenschen Satz hören lernen muss (der Unmusikalische lernt es freilich nie).
Von Jugend auf ist unser Auge verbildet, statt die Natur im Bilde, sehen wir das Bild in der Natur und „der reine Calame“ beim Anblick eines Schweizersees, oder „der wahre Achenbach“ in Ostende, oder „der Schinken, den der Maler nicht schöner malen kann“, sind leider nur zu oft gehörte Ausrufe. Als Manet einmal in einer Ausstellung die Leute vor irgend einem „reizenden“ Bilde aus der Fortunyschule – man kennt solche Kunstvereinslieblinge, kaum größer als ein Oktavblatt, mit tausend Figuren, an denen jeder Fingernagel zu sehen ist – sich drängen sah, rief er so witzig, dass ich es originaliter hersetze: et dire que c'est fait à la main! Der Philister sieht im Bilde nur das Kunststück, nicht das Kunstwerk, nur die Mache, die Empfindung versteht er nicht.
Es war an der Zeit, dass die Impressionisten zur Natur, der Wiege jeder neuen Entwicklung in der Kunst – wie es Tschudi einmal in einer Akademierede so trefflich entwickelte – zurückkehrten.
Zwar hatte die École de Barbizon (Statt der vom klassischen Kanon geforderten Bilder mit historischen, religiösen oder mythologischen Themen malten die Vertreter der Schule von Barbizon kleinformatige Landschaften. Kennzeichnend für die Schule war die Hinwendung zur realistischen Naturdarstellung im Gegensatz zur klassisch-idealistischen Landschaftskomposition.) schon 30 Jahre früher die Natur mit innigster Pietät aufgefasst; in ihrer Malerei jedoch blieb sie – selbst Millet, ihr fortgeschrittenster und persönlichster Repräsentant – der Tradition der alten Holländer durchaus treu. Erst die Impressionisten gossen den neuen Wein auch in neue Schläuche.
Selbstredend, dass Degas bei seinem Auftreten vor 30 oder 40 Jahren mit Hohngelächter empfangen wurde. Wie alles Persönliche, d. h. Natur, in der Kunst zuerst verlacht wird. Der Bauer isst nur, was er kennt, und dem Publikum schmeckt nur die breite alltägliche Bettelsuppe, die es seit Jahren gewohnt ist. Selbstredend auch, dass die vom Staate konzessionierte Kunst der Akademie, die sich im Laufe der Zeiten zu einer Art Kunstpolizei ausgewachsen hat, empört war über seine freche, aller akademischen Regeln spottende Malerei.
An und für sich ist „akademisch“ durchaus kein Schimpfwort. Aber allmählich – und es ist klar, durch wessen Schuld – ist es dahin gekommen, dass kein Künstler, der sich einigermaßen respektiert, ein akademischer genannt werden will; obgleich eigentlich ein jeder es ist, oder es doch sein sollte. Jetzt heißt akademisch: zopfig.
Früher traten die Lehrlinge in die Werkstatt des Raphael oder Rembrandt ein. Die waren ihre Professoren. Später wurden aus den Werkstätten der Meister die Akademien, aber mich will bedünken, dass nicht immer Raphaels oder Rembrandts an ihnen lehrten.
Raphael – 1506 Rembrandt – 1630
Degas ist aus der akademischen Schule hervorgegangen und man weiß, dass er von allen Künstlern Ingres am meisten schätzt. Äußerlich ohne die geringste Ähnlichkeit haben sie doch innerlich manche Züge gemeinsam. Degas ist ein ebenso großer Zeichner wie Ingres, wenn wir unter Zeichnung die lebensvolle Wiedergabe der charakteristisch aufgefassten Natur verstehen. Wiewohl ganz in der Formensprache der Akademie, ist Ingres' Porträt des Mr. Bertin von derselben schlichten Lebendigkeit und Naturwahrheit wie Degas' Graf Lepic mit seinen zwei Töchtern oder sein Desboutin. Degas' Zeichnung ist verblüffend, oft bis zur Karikatur (wie er denn dem Karikaturisten Daumier nahe verwandt ist), immer den Nagel auf den Kopf treffend. Stets verschmäht er den sogenannten schönen Strich, das Kalligraphische.
Ebenso wie seine Zeichnung ist seine Farbe: einfach und stolz, von aristokratischer Vornehmheit. Seine Palette ist die denkbar schlichteste: oft ist ein Bild nur in weiß und schwarz, das auf die feinste Weise nuanciert, allein durch eine Schleife am Kleid einer Tänzerin oder durch deren rosa Atlasschuh gehoben wird.
Auch Whistler malt oft Harmonien in weiß und schwarz. Aber bei ihm hat man den Eindruck des Gewollten, der vorgefassten Meinung, des Preziösen; bei Degas ergibt es sich wie von selbst.
Und dann: sein Raumgefühl. Er komponiert nicht nur in den Raum, sondern mit dem Raum. Der Abstand eines Gegenstandes vom anderen macht oft die Komposition. Keine Linie, nur – wie in der Natur – Flecken von hell und dunkel, von Licht und Schatten.
Und das ohne die Charakteristik seiner Sujets im Mindesten zu beeinträchtigen. Im Gegensatz zu Manet, der nur „ein Stück Natur durch sein Temperament gesehen“ gibt, malt Degas Bilder. Ihm ist die Charakteristik ebenso wichtig wie den deutschen Genremalern. Diese jedoch – selbst die Besten unter ihnen wie Waldmüller oder Knaus –
Ferdinand Georg Waldmüller Ludwig Knaus
zeichnen ihren Gegenstand so charakteristisch wie möglich und setzen dann die einzelnen Typen zu einem Bilde, das sie mehr oder minder angenehm kolorieren, zusammen, wobei ihnen oft wunderbar wahre Gestalten gelingen (man denke z. B. an den alten Juden in der „Salomonischen Weisheit“ von Knaus).
Das Ganze wirkt aber doch noch komponiert.
Degas' Bilder dagegen machen zuerst den Eindruck einer Momentaufnahme. Er weiß so zu komponieren, dass es nicht mehr komponiert aussieht. Er scheint das ganze Bild in der Natur gesehen, die Szene, die er darstellt, unmittelbar belauscht zu haben. Man sehe zum Beispiel den Pédicure: die Szene ist so drastisch wie möglich, ebenso die Pose, wie der Mann dem Mädchen die Hühneraugen schneidet.
Das Arrangement der beiden Figuren so ungesucht und ungekünstelt, als wären sie nach der Natur fotografiert, zufällig, wie sie so da zusammensitzen. Bei genauerer Betrachtung aber entdecken wir unter der scheinbaren Momentaufnahme die höchste Kunst in der Komposition. Wie die Glatze des Operateurs als hellstes Licht und die schwarzen Haare des Mädchens im Bademantel als Dunkelheit gerade da im Bilde sitzen, wo sie dekorativ am wirksamsten sind. Nichts mehr vom Versatzstück. Jedes Detail, das geblümte Sofa, der Stuhl mit dem überhängenden Laken, ist ebenso nötig für die Charakteristik des Vorgangs wie für die Bildwirkung. Der novellistische Inhalt ist vollständig in Form und Farbe umgesetzt. Ohne auch nur das Geringste an seiner Drastik zu verlieren, ist das triviale Motiv zu einem Kunstwerk verarbeitet, das uns in seiner wundervollen Verteilung von hell und dunkel, in seiner farbigen Erscheinung an Velasquez erinnert. C'est une fête pour les yeux. Was ein alter akademischer Ausdruck la mise en toile nennt, von der dekorativen Wirkung eines Outamaro.
Von weitem schon erkennt man jeden Degas an dem originellen Ausschnitt der Natur. Kühn lässt er hier nur den Kopf, dort nur die Hinterbeine eines Rennpferdes sehen; plötzlich durchschneidet er das Podium der Bühne durch eine Bassgeige mit einem so sicheren Gefühl, gerade an der richtigen Stelle, dass wir meinen, es müsste gerade so, es könnte überhaupt nicht anders sein. Wie er manchmal den Horizont ganz oben an den Rand des Bildes verlegt, um uns die Füße seiner Balleteusen besser zeigen zu können, ohne Rücksicht auf die geheiligte Vorschrift vom goldenen Schnitt, wie er uns seine Modelle in den unmöglichsten Stellungen, in den unglaublichsten Situationen zeigt; wie sie ins Tub steigen, wie sie sich aus- und anziehen, wie sie sich abtrocknen.
Und das Alles mit einer Naivität, mit der ein unverdorbenes junges Mädchen über die heikelsten Dinge spricht.
Entweder ist die Kunst des Degas naiv, oder so groß, dass sie naiv erscheint. Stolz verachtet er jede Spur von Virtuosentum, jedes Protzen mit seinem Können oder Wissen. Sein Vortrag ist schüchtern, dezent. Einfach sagt er, was er zu sagen hat ohne irgendwelche Phrase. Er arbeitet mit demselben künstlerischen Ernst wie Menzel; unermüdlich zeichnet er Studien nach der Natur, bis er die charakteristische Pose gefunden hat. Im Bilde gibt er nur den Extrakt, jedes unnötige Detail unterdrückend, immer vereinfachend. Nichts mehr vom Modell.
Bei keinem modernen Maler ist das Novellistische so völlig überwunden wie bei ihm.
Freilich – das müssen wir zugeben – wirkt er oft abstoßend; er hat nichts von dem Mitleid, mit dem Rembrandt malt; im Gegenteil, er scheint seine Modelle zu verachten. In dem halbwüchsigen Mädchen, das sich zur Tänzerin ausbildet, zeigt er schon die künftige Prostituierte. Er ist erbarmungslos wie die Natur, von kaltem Skeptizismus. Der Grundzug seines Wesens ist Stolz; was er an zarten Regungen hat, verhüllt er; er fürchtet weniger den Zynismus als das Sentiment.
Man sieht daraus, er ist nichts weniger als einschmeichelnd, aber wir sind im Banne seiner kolossalen Individualität. Ob sie uns gefällt, ist Geschmacks- resp. Modesache. Aber wie Wagner sich aufgezwungen hat, so dass jeder Musiker mit ihm rechnen muss, ist Degas ein Faktor geworden, mit dem jeder moderne Maler, bewusst oder unbewusst, sich auseinandersetzen muss: ignorieren kann er ihn nicht mehr.
Dass sich die ältere französische Schule ablehnend gegen Degas verhält, ist ebenso natürlich, wie die Abneigung, die er bei uns von den Künstlern der älteren Generation erfahren hat.
Adolph Friedrich Erdmann Menzel
Als Menzel vor etwa zwanzig Jahren bei einem hiesigen Amateur eine vorzügliche Sammlung der Impressionisten sah, fragte er, nachdem er lange und eingehend die Bilder betrachtet hatte: „Haben Sie wirklich Geld für das Zeug gegeben?“ Derselbe Menzel, der in seiner Jugend in dem Garten des Prinzen Albrecht, in der Landschaft bei Schöneberg mit dem Eisenbahnzuge, in dem Bilde von 1848, die Aufbahrung der Särge der Märzgefallenen, in dem Opernhausballe (jetzt in der Hamburger Kunsthalle) ähnliche Probleme zu lösen versucht hatte wie die Impressionisten!
Aufbahrung der Särge der Märzgefallenen
Es geht nur daraus hervor, dass Menzel, als er diesen Ausspruch tat, eine fertige Künstlerpersönlichkeit war, die auf dem schließlich eingeschlagenen Wege nicht weitergehen wollte oder konnte. Kein Mensch kann über seinen Schatten springen, und man kennt die Abneigung Goethes gegen die romantische Schule und Kleists Genie.
Der alte Schadow, der seiner Generation dasselbe bedeutete, was Menzel der unsrigen, schrieb vor nunmehr 65 Jahren beim Erscheinen von Menzels Friedrichsbuch in der Haude & Spenerschen Zeitung: die Griffonagen oder Kritzeleien eines gewissen Menzel seien des großen Königs unwürdig – – und 60 Jahre darauf wird ihm – und zwar so verdient, wie je eine Auszeichnung verdient war – der Schwarze Adlerorden verliehen für die Verherrlichung der Taten des großen Königs, die sich in nuce wunderbar bereits in dem Jugendwerk offenbarte.
Schadow konnte Menzel nicht verstehen, ebenso wie dieser Degas nicht verstehen konnte, weil in Degas wie in Menzel ein Neues steckt, was einer jeden vorhergehenden Generation fremd bleiben musste. Jedes Neue in der Kunst, hat – wenigstens in unserm demokratischen Zeitalter – zwei Generationen, die ältere und die gleichzeitige zu überwinden, bevor es zur Anerkennung gelangt; die vorhergehende kann es nicht mehr, die gleichaltrige noch nicht verstehen.
Degas wird und kann niemals populär werden. Auch scheint er absichtlich den Beifall der profanen Menge zu vermeiden; er arbeitet nur für wenige Feinschmecker, den trivialen Geschmack des großen Haufens hassend. Ein stolzer Einsamer; von eifersüchtigem Egoismus, nicht auf den Erfolg, sondern auf seine Kunst.
Manet ist vielleicht noch temperamentvoller als er, mehr Pfadfinder; keiner aber von allen modernen Malern war begabter als Degas, um auf dem von Manet urbar gemachten Wege die neue Kunst weiter zu führen, zu dem Ziele einer jeden Kunst: zum Stil.
Der heilige Augustinus sagt einmal: „Und so wie alle sinnlich schönen Dinge, sei es, dass die Natur sie hervorbrachte oder dass Künstler sie arbeitend bildeten, durch Verhältnisse des Raums oder der Zeit schön sind, wie zum Beispiel ein Leib und die Bewegung des Leibes; so ist dagegen jene Gleichheit und Einheit, welche nur vom Verstände erkannt und nach welcher durch Vermittlung des Sinnes die körperliche Schönheit beurteilt wird, weder schwellend im Raum, noch wandelbar in der Zeit.“
Wenn je ein moderner Maler, so hat Degas in seinen Bildern Kunstwerke geschaffen, die schwellend im Raum und wandelbar in der Zeit sind.
* * *