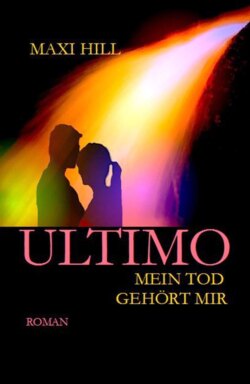Читать книгу Ultimo - Maxi Hill - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Deadline
ОглавлениеIch bin Isa-Kathrin Benson. Für mein neues Buch bin ich weit gegangen. Im doppelten Sinn. Ich wusste vom ersten Moment an, wie es titeln sollte: »Deadline«. Aber ich wusste nicht, wohin es mich führen würde. Seit diesem Tag in der Schweiz war mir erst einmal bewusst, das Buch brauchte noch einen Untertitel, der das zu Erwartende in sich trägt. Vielleicht: Die Würde des Menschen überlebt den Tod?
Titel wie Untertitel waren im selben Augenblick vergessen, als ich den Ort des Sterbens betrat.
Ich hatte Durst und war froh, in meiner Tasche dieses Schächtelchen mit winzigen Pfefferminzpastillen zu wissen. Ich müsste nur vorsichtig die Lasche nach oben drücken und die kleine Schachtel senkrecht halten. Sie war kleiner als eine meiner Visitenkarten, die ich für meine Autoren-Karriere erstellen ließ, aber nur selten benutzte.
In diesem Moment traute ich mich nicht, auch nur eine Hand zu rühren. Die Uhr in diesem Zimmer tickte seltsam klackend. Mir war dabei ebenso unbehaglich, wie auf der langen Fahrt bis hierher.
Noch eine Stunde!
Seit mir Dr. Arnold den Vorschlag gemacht hatte, mit ihm zu kommen, grübelte ich, ob meine Entscheidung richtig war. Genau genommen lebte ich jetzt aktiv, was ich gedanklich stets abgelehnt hatte. Dagegen halfen weder mein distanzierter Blick noch meine Worte, um deren Ausgewogenheit ich mich stets bemühte.
Ich löste meinen Gedanken von dem Schächtelchen und schob die kalten Hände abwechselnd in die Taschen meiner Jacke. Seltsam erschöpft von Gedanken und Bildern, die ich mir zumutete, blieb der Wille, letztendlich zu verstehen. Es ging nicht.
An diesem sonnigen Tag in einer faszinierenden Landschaft sollte ich sehen, hören und vor allem fühlen, wie es ist, wenn der Wunsch zu sterben größer ist als die Liebe zum Leben.
Auf einmal wollte ich daran gar nicht denken. Nur mein Mann Gary kam mir in den Sinn. Mit ihm hätte ich hier sein wollen, um dieses Stück faszinierende Natur zu erleben. Gary würde zu dieser Zeit zu Hause am Schreibtisch sitzen und Klausuren prüfen oder am Computer nach interessanten Themen Ausschau halten …
Unsere Stadt ist nicht halb so attraktiv wie diese da draußen vor der Tür - eingebettet in Schweizer Berge. Heimstatt der Reichen und Schönen. Meine Stadt hat keinen so vielfach besungenen See vor ihrer Haustür und doch ist sie mir tausendmal lieber …
Körperlich verfolgte ich jede Minute, die der große Zeiger der klackenden Uhr auf ein ganz bestimmtes Ziel dieses Tages vorantrieb. Gedanklich rief mich alles nach Hause.
Ich könnte derweil mit der Frau reden, dachte ich, die vom Sterbehilfe-Verein bestimmt wurde, die Aufgabe vor Ort zu lösen. Ehrenhalber. Ich wusste, dass niemand zur Zeit des Todes anwesend sein darf, der dafür entlohnt wird. So will es das Gesetzt auch in der Schweiz.
Die Frau brachte dem Sterbekandidaten, der noch in seinem Rollstuhl saß, ein Glas mit einem Getränk. Dr. Arnold sah meine fragenden Augen und bewegte seinen Kopf, verneinend, beruhigend, ohne zu wissen was ich dachte. Es war nur ein Getränk, das dem bald folgenden die Bitternis nehmen sollte.
Ich unterließ es, der Frau einen Wink zu geben. Dr. Arnold war offenbar gleicher Meinung. Nicht, dass wir in dem Moment darüber gesprochen hätten - wir sprachen in diesem Haus bisher kaum mehr als zehn Worte - er hatte es an meinem Blick gespürt und langsam den Kopf geschüttelt.
Nebenan saß - ein letztes Mal um den Vater geschart - die Familie des Mannes. Seine Frau, seine Tochter und deren Mann. Und sein Sohn, der die Angelegenheit für seinen Vater geregelt hatte und der auch zustimmen musste, dass ich - bis zu einem gewissen Moment - dabei sein durfte. Dieser Moment würde mir rechtzeitig mitgeteilt, sagte er.
Soweit ich das Geschehen hinter einer Wand aus vielen kleinen Scheiben richtig interpretierte, lag die Aufmunterung der Familie allein beim Sterbenden. Irgendeine Episode über einen wilden Keiler im heimischen Schweinestall zauberte ein Lächeln in das gequälte Gesicht des Mannes. Sogar seine überaus betrübte Frau steuerte unter Tränen bei: Was dann passierte – man schweige recht still … Bis dass die Sau dann ferkeln will. Ein jeder sah – es waren seine, die Ableger vom wilden Schweine.
Sie lachten alle und man konnte sehen, wie jeder die Lage ausnutzte, rasch seine Augen zu trocknen. Dem Vater hatte die Krankheit jede Geschmeidigkeit aus der Stimme gezupft. Er lachte, als wäre der Humor sein letztes Lebenselixier, aber es klang brüchig, kraftlos.
Dr. Arnold war wieder in das Zimmer gegangen, das nur eine dünne Holzwand, oberhalb mit viel Glas, von der Veranda trennte, wo ich mich nicht von meinem Platz rührte. Von der Familie sei die Anwesenheit Dr. Arnolds als langjähriger Hausarzt ausdrücklich erwünscht worden und er habe schlecht ablehnen können. Das Vertrauen wäre für immer gestört gewesen. Das hatte er mir schon auf der langen Fahrt bis hierher erzählt. Dr. Arnold sagte auch, und ich erinnere mich an diesen Satz genau: Menschen, die ihre freie Entscheidung auf einem sicheren Weg umsetzen wollen, haben oft keine andere Möglichkeit, als es in der Schweiz zu tun. Das habe nichts mit Sterbetourismus zu tun. Das läge einzig daran, was Deutschland den Menschen und vor allem den Ärzten zumute.
Der sichere Weg war für mich das erste Argument, dem ich ohne inneren Zwiespalt folgen konnte. Wie schnell kann ein Laie mit der falschen Dosis oder dem falschen Medikament noch größeren Schaden anrichten. Vielleicht würde sein Leiden dann erst recht unerträglich werden, körperlich wie mental.
In dieser knappen Stunde des Wartens hatte ich gelernt, dass es keine einfache Antwort auf all meine Fragen geben würde, auch wenn es mir die Familie versprochen hatte. Selbst wenn diese Menschen ihre Lösung gefunden hatten, allgemeingültig konnte sie nicht sein.
Die Frau kam zurück ins Zimmer und fragte den Mann mit sanfter Stimme, ob sein Wille noch immer derselbe sei. Als er bejahte fragte sie, ob er noch beten möchte oder einen weiteren Wunsch noch nicht geäußert habe.
»Nein«, sagte der Mann. Gebetet habe er sein Leben lang nicht, nur gehofft, dass er in Frieden leben und sein Dasein genau so beenden könne. Dass er nun seiner Familie einen solchen Tag nicht ersparen könne, mache ihn traurig.
Sohn und Schwiegersohn halfen dem Vater vom Rollstuhl auf die Liege, ehe der Mann darum bat, ein paar Worte mit Dr. Arnold zu sprechen. Zu guter Letzt suchte er die Hand seiner Frau.
Dr. Arnold hatte mir auch gesagt, dass er vor Eintritt des Todes gehen werde, um als Arzt nicht in den Verdacht aktiver Sterbehilfe zu geraten. Ich machte mich darauf gefasst, mit ihm gemeinsam das Haus zu verlassen. In den Stunden des Abschieds wollte ich nicht der fremde Dorn in der offenen Wunde dieser Menschen sein. Doch Dr. Arnold kam zurück auf die Veranda, oder was der Raum auch darstellen sollte, und blieb bei mir stehen.
»Wir bleiben hier«, sagte er kurz und das klang, als habe er es schon vorher gewusst. »Man möchte uns als unabhängige Zeugen.«
In diesem Moment fühlte ich mich übergangen, ausgenutzt, hinters Licht geführt. Doch ich hatte ja selbst davon gelesen, dass jeder Freitod in der Schweiz als außergewöhnlicher Todesfall gilt, über den die Polizei informiert werden muss. Die zuständige Kantons-Polizei untersucht dann zusammen mit einem Staatsanwalt die Todesumstände und die Begleiterscheinungen – aber soweit war es noch nicht.
Im Nebenraum war bald stille Bewegung. Jeder der Anwesenden trat dicht an das Bett des Vaters heran, sprach ein paar Worte mit ihm und küsste seine Stirn, die Wange oder den Mund. Erst als die Frau vom Verein erneut den Raum betrat, gingen sie ein Stück zurück. Allein die Ehefrau blieb am Bett und hielt die Hand des Mannes, der noch keine siebzig Jahre alt war, der fest im Leben gestanden, der aktiv gelebt und intensiv geliebt hatte. So hat es Dr. Arnold versichert. Als die Frau das Glas auf das kleine Tischchen stellte, weinten alle. Nur der Mann sagte: »Macht 's kurz Kinder.« Allein konnte er das Glas nicht sicher halten. Die Frau vom Verein nickte dem Sohn zu und ging aus dem Zimmer.
Dr. Arnold drehte unmerklich seinen Kopf nach rechts und ich sah, wie die Flüssigkeit im Glas immer weniger wurde. Meine Beine versagten mir den Dienst. Ich kannte den Mann vorher nicht und keinen seiner Familie. Ich sah mich plötzlich am Sterbebett von Gary stehen und zusehen, wie er mich trotz ewigen Treueschwurs vorzeitig allein lässt. Sogar im Wissen um seinen innigen Wunsch hätte ich bis zum Schluss gehofft, dass er den letzten Schritt nicht wirklich gehen würde.
Die Formalitäten mit der Polizei waren nicht angenehm, aber das war ich letztlich der Familie schuldig.