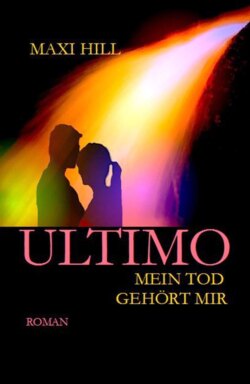Читать книгу Ultimo - Maxi Hill - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Buch
ОглавлениеGanz gegen meine Gewohnheit war ich nach dem Akt des Sterbens allein durch die fremde Stadt gelaufen. In keinen der vielen Schickeria-Shops zog es mich. Mein Kopf war noch nicht frei dafür. In einem kleinen Park unter Pinien atmete ich die Luft, die vom See herüber kam. Rhododendron und üppige Blumenrabatten an gut gepflegten Rasenflächen sollten mich aufbauen. Es gelang mir nicht. Stattdessen erinnerte ich mich daran, worüber wir manchmal mit Gary reden. Wenn ich einst sterbe und die Wahl hätte, als ein anderes Geschöpf zurück auf die Welt zu kommen, ich würde ein Adler sein wollen. Vogelfrei unter dem Himmel schweben, die Welt mit klarem Blick von oben sehen ohne all die Trugschlüsse, die aus der Perspektive kommen. Ich könnte den See überfliegen, auf dem San Salvadore landen und wieder starten zum Monte Bré hinüber – so oft ich wollte. Der See leuchtete ungewöhnlich blau durch das Grün am Ufer. Drüben auf der anderen Seite stieß eine Wasserfontäne in den Himmel und zerstäubte den Strahl zu kühlender Luft.
Auf der Straße am Ufer entlang fuhr eine kleine Touristenbahn mit einigen Waggons bis hinüber zum Fuße des Berges. Man konnte überall ein- und wieder aussteigen. Wie ferngesteuert löste ich ein Ticket, stieg ein und fuhr bis zu jener Fontäne. In deren Nähe gab es die Bergbahn zum San Salvadore hinauf. Ein schöner Gedanke. Bis ich die Dame vom Verein treffen sollte, hatte ich beinahe noch drei Stunden Zeit. Es wurden die lichtesten Stunden der beiden Tage, die ich auf Anraten Dr. Arnolds auf diesem göttlichen Flecken Erde verbringen sollte.
Oben angekommen hatte ich das Kreuz hinter dem Aussichtsgebäude schnell gefunden. Auf einer Steinplatte verharrte ich lange und schaute unentwegt in die Tiefe - auch in meine eigenen Abgründe.
Warum schreibst du ein solches Buch, wenn dir schon allein bei der Recherche das Herz zu brechen droht, wenn du im Widerstreit mit dir selbst keine Antwort findest, wenn du nach all dem Wissen erst recht nicht mehr weißt, wie du dich selbst entscheiden würdest und worin die Würde des Menschen beruht: Im freien Willen, die Welt zu verlassen, um eigenes Leid zu ersparen und anderen die Last? Oder in der Kraft, seinem Geschick zu trotzen?
Wäre der Ausblick vom San Salvadore nicht gewesen und hätte ich nicht das Haus am anderen Ufer des Sees wiedererkannt, das unscheinbar in der Zeile prachtvoller Bauten eigens dem Zweck des Vergehens diente, hätte der Tag, hätten die Dinge vielleicht eine Wendung genommen. »Das Vergehen«, sprach ich immer wieder zu mir selbst, so doppeldeutig es auch klang. »Wird das körperliche Vergehen des Einen durch das menschliche des Anderen befördert? Kann Hilfe ein Vergehen sein?«
Worte meines Lieblingsrezensenten kamen in meinen Sinn. »Es macht das Buch so besonders, weil es weder strahlende Helden noch düstere Bösewichter gibt.« Damals ging es im Buch nicht ums Sterben. Es ging um die Abgründe in sehr vitalen Menschen mit einer fast kriminellen Pflichtvergessenheit. Vielleicht würde derselbe Mann heute, wüsste er von meinen Recherchen, von Jagdinstinkt schreiben, von Todesneugier oder abartiger Faszination, von Dramatisierung des weibliches Mutes, so nah am Freitod zu sein.
Aber war das, was ich dank Dr. Arnold miterleben durfte, wirklich dem freien Willen des Mannes geschuldet? Dachte er angesichts des nahen Todes noch immer, es sei Zeit zu sterben?
Was wollte ich so weit entfernt von der Heimat an diesem Ort, dem der Schöpfer alles gegeben hat, was das Herz eines Menschen erfreuen kann, gerade darum nichts, was den letzten Gang zur endlichen Erlösung werden lässt. Steckt nicht immer das Unvereinbare in den Perspektiven auf den Tod, so wie es objektive und subjektive Sichtweisen auf das Leben gibt? Ich wusste, es ging mir nicht um die Sensation des Sterbehilfe-Todes, wie man es vermutlich annehmen werde. Noch weniger um meine eigene Zeugenschaft. Wenn es mir um etwas ging, dann waren es die Gefühle der Menschen, die sich der beste Autor nicht würde ausdenken können. Gefühle der Sterbenden und die der Hinterbliebenen. Wie verhält sich jemand, der seinen Abschied als Erlösung sieht? Wie geht es den Angehörigen, die ihn im Leben geliebt und in der Krankheit bedauert haben? Reicht ihre Kraft für Worte des Beistandes? Was davon ist ehrlich und wer zürnt in Wahrheit dem Sterbenden, weil er ihm Unerträgliches zumutet?
Wohin driftet unsere Welt, wenn selbst der Freitod aus der Anonymität gehoben wird, aus der Intimität. Wenn er zum Vorzeigeobjekt wird.
Weder da unten in diesem Haus, auch nicht beim Blick vom San Salvadore, dessen steinernes Kreuz zum Monte Brè hinüber zeigte, hatte ich eine Ahnung, welche Abgründe mir noch begegnen sollten und welche Zwiespälte ich selbst ertragen musste, um dieses, mein Buch über das besondere Sterben zu schreiben. Seit ich die Welt von hier oben betrachtete, war aus meiner Überzeugung von der Intimität des Freitodes nur Argwohn geblieben. Ist der Freitod zu einem Genre geworden, das ganz verschiedene Interessen bedient? In meiner Vorstellung reichten sie vom Egoismus des Sterbenden, über den Kommerz des Helfenden bis zum Unterhaltungswert der Medienwelt, die bei Büchern, wie ich eines vorhatte zu schreiben, noch lange kein Ende nehmen würde. Vielleicht ging es bald schon darum, das Sterben live und fernsehmedial verfolgen zu können. Zu keinem der Genres – nicht einmal zu meinem geplanten Buch - kann ich mich heute guten Gewissens bekennen, weil ich weiß, was passieren kann …
Gleichwohl kann ich einem Lebensüberdrüssigen das Recht nicht absprechen, sich frei zu entscheiden. Wer selbstbestimmt lebt, muss auch selbstbestimmt sterben dürfen. Das Wie wird nicht erst durch mich und mein Buch aus der Tabu-Zone gehoben. Was früher jemand ganz für sich allein entschied, wird heute auf uns alle abgeladen, ob wir Angehörige sind oder die Gesellschaft um uns. Die Haltung dazu ist so vielfältig, wie wir Menschen vielfältig sind.
Die scheinbar friedliche Welt tief unter mir versöhnte meine Zweifel. Ich fand die Erklärung, die mein Vorhaben rechtfertigt: Ich will nichts beklagen, ich will auch keinem Menschen sein vermeintliches Recht absprechen, ich will nur mein eigenes Recht einfordern, die Dinge bei dem Namen zu nennen, den ich selbst diesen Dingen geben möchte.
Die Dame vom Sterbehilfeverein – Frau Mansoni - favorisierte den freien Willen eines jeden, der zu ihnen kommt. Wie konnte ich anderes erwarten. Und sie hielt mir Zahlen vor, die nicht zu entkräften waren. Mit jedem Sterbewilligen würden mindestens zwei Gespräche geführt, um abzuklären, ob der Sterbewunsch einem urteilsfähigen Menschen entspringt und sein einzig erklärter Wille ist. Nach den vorliegenden Zahlen seien diese Gespräche sogar eine sehr erfolgreiche Suizidprophylaxe, die bei über achtzig Prozent liege. Siebzig Prozent der einst Sterbewilligen würden sich nach diesen Gesprächen, die auch Alternativen zum schmerzfreien Leben aufzeigten, nicht mehr melden. Der Rest melde sich zwar noch einmal, letztlich aber würden weitere 15 Prozent die Freitodbegleitung nicht in Anspruch nehmen.
Ich hatte keinen Grund, der Darlegung nicht zu glauben, aber Mühe, die genaue Anzahl der Begleitungen zu erfahren. Das intensivste Jahr sei 2006 gewesen, sagte Frau Mansoni ausweichend mit schlecht unterdrücktem zufriedenem Schmunzeln. Von über 200 Freitodkandidaten seien mehr als 170 Ausländer gewesen, die meisten kämen aus Deutschland.
»Was wird den Sterbewilligen verabreicht und wie sicher ist das Zeug? «
Sie schaute mich an. Ihr Kopf zuckte empört, doch die Stimme blieb gefasst: „Sie können sicher sein, dass wir verlässlich arbeiten. Der Arzt, der die Krankenunterlagen des Mitglieds gründlich studiert, muss sich schließlich nicht bereit erklären, ein Rezept auszustellen, wenn es seinem Gewissen widerspricht. In den meisten Fällen aber wird er ein Rezept über eine sichere Dosierung des tödlichen Medikaments Pentobarbital ausstellen.«
»Sie sagen Mitglied?«
»Jeder, der von uns betreut werden möchte, muss Mitglied im Verein werden ...« Frau Mansoni sah mir an, wie eine Frage in mir reifte. Sie unterbrach sich, holte tief Luft und redete plötzlich vom eindeutigen Volksentscheid im Jahre 2011, mit dem man zu 85 Prozent gegen das Verbot der Freitodhilfe votiert habe. Sogar in Sachen Beschränkung auf die eigene Bürgerschaft – die sie Eidgenossen nannte - ging das Votum pro Freitodhilfe aus, wovon nun auch die Deutschen, wie Herr Mangold, profitierten. Beinahe triumphierte ihre Stimme: »Der Souverän entscheidet.«
Auch am Tag nach dem Sterben ging es noch nicht zurück in die Heimat. Dr. Arnold hatte noch eine Mission. Welche, davon sprach er nicht und ich fragte nicht danach. Obwohl es mich vehement zurückzog, genoss ich den sonnigen Morgen. Helligkeit überflutete schon das Ufer des Sees, kühler Schatten verblieb in den Gassen und meine Sinne richteten sich endlich wieder auf das Jetzt und Hier, weg vom Unbill des Lebens und des Sterbens.
In einer quirligen Einkaufspassage hatte die Sonne an diesem Morgen noch keine Chance. Das schien die bummelnden Menschen nicht zu stören. Mitten im Gewimmel fand ich mich vor einem der Schaufenster wieder und fragte mich, wer des Übermaßes an Waren bedurfte und was den Preis dafür rechtfertigte. Es war die Zeit der heuchlerisch warnenden Finger gegen das Unrecht auf dieser Welt. Der Tod vieler Fabrikarbeiterinnen in Bangladesch, die in maroden Fabriken für Hungerlöhne schuften und in schäbigen Wohnhütten ihr Dasein kaum Leben nennen konnten, hatte gerade die Welt beschäftigt, die Hüter der Gerechtigkeit. Dieser warnende Finger erhebt sich stets nach einer Katastrophe, zu der nicht schweigen darf, wer zum Überleben die Stimmen des Volkes braucht. Es scheint das gottgegebene Gesetz zu sein: Die Reichen nehmen 's von den krummen Rücken der Armen, für die Armen krümmt ein Reicher nicht einmal den kleinen Finger. Gesetze sind immer der Spiegel der Macht.
Als mein Blick vor dem nächsten Shop über blanke Glasvitrinen strich, über goldene Ketten und brillante Steine, schob hinter mir ein kleiner Schatten vorbei, langsam, fast ruckartig. Ein Mütterchen in dunkle Kleider gehüllt, den Rücken gekrümmt, die Arme gestützt auf die rollende Gehhilfe. Das weiße Haupt war trotz Sommerhitze von einer dunklen Kappe bedeckt. Beim Anblick der krummen Frau hob sich mein Körper um Zentimeter in die Gerade - nichts als eine Gewissensfrage. Seit langem hatte ich Respekt vor dem Altern und nahm mir vor, mit Disziplin gegen die ersten Anzeichen zu kämpfen. Je näher sich das Mütterchen an mir vorbei schob, desto mehr ließ meine Anspannung wieder nach. Der erhabene Rücken stand mir nicht, wie auch Hochmut nicht zu mir gehörte. Hier aber konnte er meinen längeren Abstand zum Lebensende verdeutlichen, größer als der des Mütterchens noch sein konnte. Ich sah, wie das Blut aus den Adern der faltigen Hände gewichen war, wie sie kraftlos die Griffe umklammerten. Und ich spürte die Täuschung meines Gefühls vom armen Mütterchen. Prächtige Stücke vom Überfluss aus jenem Schaufenster prangten auch an den blutleeren Alabasterfingern, mächtiger und zahlreicher als es der alternden Würde noch gut tat. Die Alte hob nach ein paar Schritten ihren Kopf und ich sah auch das teure Geschmeide unterm Blusenkragen.
Mochte es der blaue Streifen des Himmels über der schmalen Gasse gewesen sein, mochte meine angeschlagene Seele den letzten Tag noch in sich spüren – ich konnte den selbstzerfleischenden Gerechtigkeitssinn, der seit Jahren zu mir gehörte, nicht zur Ruhe zwingen. Diese Frau – vom Leben verwöhnt und nun vom Alter geschlagen – ließ ihren Blick hin und her schweifen, hilflos, ratlos zwischen mir und dem Gewirr in der Gasse. Vielleicht einen Moment zu spät bemerkte ich den Grund ihres Verweilens. Ein winziger Absatz, kaum Stufe zu nennen, bremste das Gefährt, ein Umstand, dem sie allein nicht mehr Herr wurde. Hatte mich der Reichtum geblendet, der die Not überspielte. Was ist all das Gold wert, wenn es die Seelen fernhält?
Ein kleines Herabbeugen, ein winziger Ruck, nicht viel, um die Not der Kraftlosen zu lindern.
So wie das Mütterchen dankbar dem freien Platz zustrebte, kamen meine Gedanken zurück: Was, wenn der Mammon schuld am Trennenden war? Wenn er Schutzwall war, wenn er Einsamkeit und Fremdheit gebar? Wenn die Kraft des Mammons schwindet, bleibt endlich die Hoffnung auf Menschlichkeit. Versündigen wir uns nicht längst an der Menschheit? Lehren wir unsere Kinder noch, den Wert einer Sache zu schätzen? Wir lehren sie, den Preis zu erkennen?
Vor der langen Fahrt nach Hause, die am nächsten Morgen bevorstand, lag ich wach in meinem Hotelbett und dachte an die Familie Mangold und daran, ob sie den noch unerfüllten Teil vom Willen des Vaters beherzigen wird …