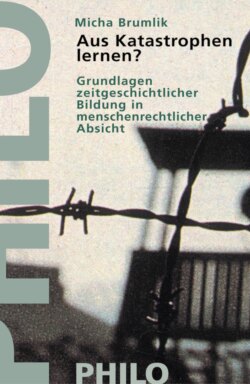Читать книгу Aus Katastrophen lernen? - Micha Brumlik - Страница 7
Anmerkungen
Оглавление1Vgl. E. Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945, Berlin 1987, S. 114.
2I. Kershaw, Hitler 1889-1936, München 2002, S. 241.
3Ebd., S. 253.
4A. Schaefgen, Der Völkermord an den Armeniern als Thema in der deutschen Politik nach 1949, in: H.-L. Kieser/D. J. Schaller (Hg.), Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah, Zürich 2002, bes. S. 567.
5F. Werfel, Die vierzig Tage des Musa Dagh, Frankfurt/Main 1953, S. 90.
6Ebd.
7Hitlers Äußerung ist in verschiedenen Varianten überliefert, und es ist eher unwahrscheinlich, daß er sich damit – wie eine spätere Deutung es nahelegt – zum Schicksal der europäischen Juden äußern wollte. Die neuere Forschung geht eher davon aus, daß Hitler damit auf die Bevölkerung Polens im Ganzen Bezug nahm. Vgl. W. Baumgart, Zur Ansprache Hitlers vor den Führern der Wehrmacht am 22. August 1939. Eine quellenkritische Untersuchung, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 16 (1968), S. 120-129; V. N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from the Balcans to Anatolia to the Caucasus, New York/Oxford 2003, S. 403.
8E. Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 1995, S. 17 f. Zum 20. Jahrhundert siehe auch D. Diner, Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung, München 1999.
9R. J. Rummel, Demozid – der befohlene Tod. Massenmorde im 20. Jahrhundert, Münster 2003, S. 29.
10H. Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, München 1986, S. 308 f.
11S. Courtois u. a., Das Schwarzbuch des Kommunismus, München/Zürich 1997, S. 133.
12Ebd.
13J. Kotek/P. Rigoulot, Das Jahrhundert der Lager. Gefangenschaft, Zwangsarbeit, Vernichtung, Berlin/München 2001, S. 129.
14G. Krüger, Kriegsbewältigung und Geschichtsbewußtsein. Realität, Deutung und Verarbeitung des deutschen Kolonialkriegs in Namibia 1904 bis 1907, Göttingen 1999. Vgl. aber auch den belletristischen Versuch von Uwe Timm, Morenga, München 2000.
15Y. Bauer, Die dunkle Seite der Geschichte, Frankfurt/Main 2001, S. 75.
16A. Hochschild, Schatten über dem Kongo. Die Geschichte eines der großen, fast vergessenen Menschheitsverbrechen, Stuttgart 2000.
17E. Traverso, Moderne und Gewalt. Eine europäische Genealogie des Nazi-Terrors, Köln 2003.
18H.-L. Kieser, D. J. Schaller (Hg.), Der Völkermord an den Armeniern und die Shoah, a. a. O.; T. Hoffmann, Deutsche Quellen und Augenzeugenberichte zum Völkermord an den Armeniern 1915/16, in: Gesellschaft für bedrohte Völker (Hg.), Das Verbrechen des Schweigens, Göttingen o. J., S. 92-124; A. Ohandjanian, Armenien. Der verschwiegene Völkermord, Wien/Köln/Graz 1989, S. 95 f.
19J. Kotek/P. Rigoulot, Das Jahrhundert der Lager, a. a. O., S. 81 f.; G. Krüger, Kriegsbewältigung und Geschichtsbewußtsein, a. a. O., S. 126 f.
20P. Schmitt-Egner, Kolonialismus und Faschismus. Eine Studie zur historischen und begrifflichen Genesis faschistischer Bewußtseinsformen am deutschen Beispiel, Gießen 1975.
21J. Kotek/P. Rigoulot, Das Jahrhundert der Lager, a. a. O., S. 84 f.; J. Zimmerer/J. Zeller (Hg.), Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Der Kolonialkrieg (1904-1908) in Namibia und seine Folgen, Berlin 2003; T. v. Trotha, Genozidaler Pazifizierungskrieg. Soziologische Anmerkungen zum Konzept des Genozids am Beispiel des Kolonalkriegs in Deutsch-Südwestafrika, in: Zeitschrift für Genozidforschung 2/2003, S. 30-57; W. U. Eckart, Medizin und Kolonialimperialismus. Deutschland 1884-1945, Paderborn 1997, bes. S. 273-290.
22J. Conrad, Herz der Finsternis, Zürich 1992, S. 33.
23A. Hochschild, Schatten über dem Kongo, a. a. O., S. 320 f.
24D. Th. Goldberg, The Racial State, Oxford 2002.
25M. Dorigny, The Abolitions of Slavery (1793, 1794, 1848). Overwiev of a Symposium, in: D. Diène (Hg.), From Chains to Bonds. The Slave Trade Revisited, New York 2001, S. 278.
26G. Agamben, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt/Main 2002, S. 177.
27Das christliche Abendland, in dieser Frage von der seefahrenden portugiesischen Nation geführt, übernahm zunächst die im muslimischen Herrschaftsbereich in Bezug auf Nichtmuslime selbstverständliche Praxis der Sklaverei und konnte sich dabei auf die Jahrhunderte währende Billigung der Sklaverei durch die katholische Kirche stützen. Zudem aber suchte es für die aktuelle Praxis sukzessive von der höchsten moralischen und juristischen Autorität, dem Papsttum, neue Legitimation zu erhalten. Die stärkste Rechtfertigung von katholischer Seite bestand in einer 1452 erlassenen päpstlichen Bulle, die im Kampf gegen den Islam das dauernde Versklaven von Sarazenen, Heiden und anderen Ungläubigen ausdrücklich gestattete. Damit berief sich die Kirche aufs neue auf die antike, unter anderem von Aristoteles formulierte Lehre, daß eine Niederlage im Kampf, die in Kriegsgefangenschaft ende, Grund eines legitimen Freiheitsverlusts darstelle. Insoweit steht die Befürwortung der Sklaverei ganz in der abendländischen Tradition politischen Denkens und ist im engeren Sinne noch nicht rassistisch, da die Möglichkeit der Niederlage grundsätzlich allen Menschen zugeschrieben wird.
28A. Selg und R. Wieland (Hg.), Die Welt der Encyclopédie, Frankfurt/Main 2001, S. 366.
29Ebd., S. 277.
30Siehe etwa: Eine Petition von Kolonisten in Georgia für die Einführung der Sklaverei (1738), in: E. Schmitt (Hg.), Wirtschaft und Handel der Kolonialreiche. Dokumente zur Geschichte der europäischen Expansion, Bd. 4, München 1988, S. 563-568; N. Finzsch u. a., Von Benin nach Baltimore. Die Geschichte der African Americans, Hamburg 1999, bes. S. 52 f.
32V. N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide, a. a. O., S. 219 f.
33W. Sofsky, Traktat über die Gewalt, Frankfurt/Main 1996.
34Zitiert nach J. Kotek/P. Rigoulot, Das Jahrhundert der Lager, a. a. O., S. 112.
35A. Gehlen, Moral und Hypermoral, Frankfurt/Main 1969; H. M. Enzensberger, Aussichten auf den Bürgerkrieg, Frankfurt/Main 1995.
36M. Horkheimer/Th. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt/ Main 1981, S. 7.
37N. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt/Main 1997, S. 145-170; ders., Das Paradox der Menschenrechte und drei Formen seiner Entfaltung, in: ders., Soziologische Aufklärung 6, Opladen 1995, S. 229-236.
38J. B. Thompson, Die Globalisierung der Kommunikation, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 6/1997, S. 881-894; G. Koch, Die neue Drahtlosigkeit. Globalisierung der Massenmedien, in: ebd., S. 919-926.
39Damit wäre die Kluft zwischen einem kurzschlüssigen Universalismus allgemein unverbindlicher Moral und einem iterativen Universalismus der partikularen Kontexte geschlossen, da die entstehenden Großräume, zumal die in den Menschenrechten und der UN-Mitgliedschaft politisch verfaßte Weltgesellschaft, universal und partikular in einem sind.
40Diese Tendenz scheint dem Begriff von Anfang an innezuwohnen. Abgesehen von den vielfältigen biblischen Bezügen in der 200 v. Chr. entstandenen griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der sogenannten Septuaginta und der lateinischen Bibel, der „Vulgata“, in denen Begriffe der hebräischen Bibel für Opfer mit „Holocaustoma“ übersetzt werden, wird der Begriff „Holocaust“ im Zusammenhang mit Judenverfolgungen wohl zuerst im 12. Jahrhundert erwähnt. Am Krönungstag Richards I. 1189 in London richtete die Bevölkerung von London – wie der Chronist Richard von Duizes berichtet – unter den Juden einen blutigen Pogrom an: „Am Tag der Krönung des Königs, ungefähr zu der Stunde, da der Sohn dem Vater geopfert worden war, begann man in der Stadt die Juden ihrem Vater, dem Teufel zu opfern; und so lange dauerte die Feier dieses Mysteriums, daß der Holocaust erst am folgenden Tag vollendet werden konnte. Und die anderen Städte und Dörfer der Gegend eiferten den Londonern in ihrem Glauben nach und schickten mit ebensolcher frommer Hingabe ihre Blutsauger blutig zur Hölle.“ (Zitiert nach G. Agamben, Was von Auschwitz bleibt, Frankfurt/Main 2003, S. 27.)
Theodor W. Adorno und Max Horkheimer haben in ihrer erstmals 1947 erschienenen Schrift Dialektik der Aufklärung die Behauptung aufgestellt, daß Mythos in Aufklärung und Aufklärung in Mythos umschlage. Das erweist sich auch beim Begriff „Holocaust“. In Denis Diderots und d’Alemberts Enzyklopädie von 1751 finden wir unter „Holocauste“ folgenden Eintrag: „Opferung, bei der das Opfertier gänzlich verbrannt wurde, ohne daß etwas von ihm übrig blieb, um der Gottheit zu zeigen, daß man ihr völlig ergeben war…“ Nur vierzig Jahre später, im Herbst 1792, schrieb der Jakobiner Fabre d’Eglantine auf einem in der Hauptstadt Paris geklebten Plakat, das zum Kampf gegen die Aristokratie und die Royalisten aufrief: „Einmal mehr, ihr Bürger, zu den Waffen. Möge sich ganz Frankreich mit Piken, Bajonetten, Kanonen und Dolchen rüsten, auf daß jeder ein Soldat werde; laßt uns die Reihen jener bösartigen Tyrannenknechte aufrollen. Laßt das Blut der Verräter in den Städten zum ersten Holocaust der Freiheit werden… so daß wir, wenn wir auf den gemeinsamen Feind stoßen, nichts Beunruhigendes hinter uns lassen.“ (Zitiert nach S. Schama, Citizens, New York 1989, S. 630.)
Es wäre unsinnig, die Massenvernichtung der europäischen Juden in irgendeiner Weise den Jakobinern und ihrem Denken anzulasten; daß aber Aufklärung und Moderne Schrecken, Krieg und Vernichtung mindestens im Denken entgrenzt und damit später grenzenlosem Töten den Weg gebahnt haben, ist nicht zu bezweifeln.
41D. Levy/N. Sznaider, Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust, Frankfurt/Main 2001, S. 180.
42Ebd., S. 180.
43Zitiert nach D. Levy/N. Sznaider, Erinnerung im globalen Zeitalter, a. a. O., S. 213.
44Vgl. M. Angvik/B. v. Borries, Youth and History, Hamburg 1997.
45M. Jeismann, Auf Wiedersehen Gestern. Die deutsche Vergangenheit und die Politik von morgen, Berlin 2000.
46D. Levy/N. Sznaider, Erinnerung im globalen Zeitalter, a. a. O., S. 212.
47B. Fechler u. a. (Hg.), „Erziehung nach Auschwitz“ in der multikulturellen Gesellschaft, Weinheim/München 2000.
48V. Lenhart, Pädagogik der Menschenrechte, Opladen 2003; Bildung und Menschenrechte, Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 4/2002; H. P. Mahnke/A. K. Treml (Hg.), Total global. Weltbürgerliche Erziehung als Überforderung der Ethik, edition ethik kontrovers 8/2000; S. Dunn u. a. (Hg.), Tolerance Matters. International Educational Approaches, Gütersloh 2003.
49V. Lenhart/K. Savolainen, Editorial Introduction, in: International Review of Education, Special Issue on Education and Human Rights, 3-4/2002, S. 145.
50M. Brumlik, Nationale Erziehung oder weltbürgerliche Bildung, in: 29. Beiheft der Zeitschrift für Pädagogik, Weinheim/Basel 1992, S. 54-58.
51A. Lingis, The Community of Those Who Have Nothing in Common, Bloomington 1994; N. Dower, World Ethics. The New Agenda, Edinburgh 1998; M. Brumlik, Gerechtigkeit zwischen den Generationen, Berlin 1995, S. 89 f.; M. Brumlik, Bildung und Glück. Versuch einer Theorie der Tugenden, Berlin 2002, S. 82 f.
52K. R. Monroe, The Heart of Altruism. Perception of a Common Humanity, Princeton 1996.
53O. Höffe, Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, München 1999.
54A. Scheunpflug, Stichwort: Globalisierung und Erziehungswissenschaft, in: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 2/2003, S. 159-172.
55A. Horstmann, Kosmopolit, in: J. Ritter/K. Gründer (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 4, Basel 1976, S. 1155.
56F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in: ders., Kritische Studienausgabe, hg. v. G. Colli u. M. Montinari, Bd. 4, München 1988, S. 77 f.
57H. v. Hofmansthal, Gesammelte Werke, Gedichte/Dramen I, Frankfurt/Main 1979, S. 26.
58I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, in: ders., Werke, Bd. 7, Darmstadt 1968, S. 526.
59A. Margalit, Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung. Berlin 1997, S. 72.
60Siehe dazu ausführlich: M. Brumlik, Bildung und Glück, a. a. O., S. 65 f.
61P. Levi, Ist das ein Mensch?, darin: Die Atempause, München 1986, S. 164.
62Vgl J. Kotek/P. Rigoulot, Das Jahrhundert der Lager, a. a. O.; N. M. Naimark, Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe, Cambridge 2001; G. Agamben, Homo sacer, a. a. O.; R. Rummel, Demozid – der befohlene Tod, a. a. O.
63Statut des Internationalen Gerichts für das ehemalige Jugoslawien, in: MenschR, München 1998, S. 109.
64J. M. Chaumont, Die Konkurrenz der Opfer. Genozid, Identität und Anerkennung, Lüneburg 2001.
65C. West, On Black-Jewish Relations, in: ders., Race Matters, New York 1994.
66G. Bhattacharyya u. a., Race and Power. Global Racism in the Twenty-First Century, London 2002.
67L. Schumacher, Sklaverei in der Antike. Alltag und Schicksal der Unfreien, München 2001.
68Vgl. M. Brumlik, Bildung und Glück, a. a. O., S. 244 f.
69E. D. Weitz, A Century of Genocide. Utopias of Race and Nation, Princeton 2003, S. 24 f.; R. Blackburn, The Making of New World Slavery, London 1997, S. 64 f.; S. Peabody, „There Are No Slaves in France“. The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime, Oxford 1996; I. Hannaford, Race. The History of an Idea in the West, Washington 1996, S. 270 f.
70H. Thomas, The Slave Trade. The Story of the Atlantic Slave Trade: 1440-1870, New York 1997, S. 804 f.; B. Davidson, The African Slave Trade, Boston 1980; vgl. auch N. Finzsch u. a., Von Benin nach Baltimore, a. a. O.; E. Ball, Die Plantagen am Cooper River. Eine Südstaaten-Dynastie und ihre Sklaven, Frankfurt/Main 1999.
71H. Lübbe, „Ich entschuldige mich“, Bonn 2000.