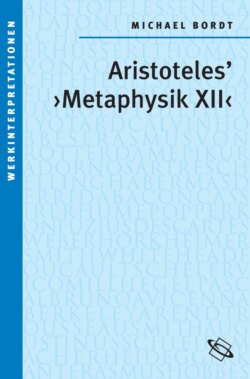Читать книгу Aristoteles'' "Metaphysik XII" - Michael Bordt - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2 Die Veränderung – Teil I
Оглавление1. Der Text
„(2.1) [1069b3] Die sinnlich wahrnehmbare ousia ist der Veränderung unterworfen.
(2.2) [b3] (2.2.1)Wenn nun die Veränderung von den Gegensätzen oder den Dingen, die in der Mitte liegen, ausgeht, aber nicht von allen Gegensätzen (denn auch die Stimme ist etwas Nicht-Weißes), sondern von dem Konträren: so muss notwendig etwas zugrunde liegen, das sich in den konträren Gegensatz verändert, denn die konträren Gegensätze verändern sich nicht. (2.2.2) [b7] Ferner, <bei der Veränderung> beharrt etwas, die konträren Gegensätze aber beharren nicht. (2.2.3) [b8] Also gibt es noch etwas Drittes neben den konträren Gegensätzen, die Materie.
(2.3) [b9] Wenn es nun also vier Arten von Veränderungen gibt, nämlich in Bezug auf (i) das Was, in Bezug auf (ii) das Wie-Beschaffen, (iii) das Wieviel und (iv) das Wo, und (i*) uneingeschränktes Entstehen und Vergehen <die Veränderung> in Bezug auf ein Dieses ist, (iii*) Vermehrung aber und Verminderung in Bezug auf das Wieviel, (ii*) Umwandlung aber in Bezug auf die Affektion, (iv*) Ortsbewegung aber in Bezug auf den Ort ist: so dürfte demnach die Veränderung bei jeder Art ein Übergang in den jeweiligen konträren Gegensatz sein.
(2.4) [b14] (2.4.1) Notwendig muss sich also die Materie verändern, indem sie zu beiden Gegensätzen die Möglichkeit hat. Da aber ja das Seiende zweierlei ist, so verändert sich alles aus dem, was der Möglichkeit nach seiend ist, in das, was der Wirklichkeit nach seiend ist, z. B. aus dem Weißen der Möglichkeit nach in das Weiße der Wirklichkeit nach. In gleicher Weise verhält es sich bei der Vermehrung und Verminderung, (2.4.2) [b18] so dass etwas nicht nur aus Nichtseiendem in akzidentellem Sinne werden kann, sondern alles auch aus Seiendem wird, nämlich aus solchem, was der Möglichkeit nach ist, der Wirklichkeit nach aber nicht ist. (2.4.3) [b20] Dies ist gemeint mit dem Einen des Anaxagoras – denn besser wird es so ausgedrückt als ,es war alles beisammen‘ – sowie mit der Mischung des Empedokles und des Anaximander, wie auch mit der Lehre des Demokrit: ,Es war alles beisammen‘, nämlich der Möglichkeit nach, nicht aber der Wirklichkeit nach. Sie dürften also im Grunde die Materie gemeint haben.
(2.5) [b24] Alle Dinge aber, die sich verändern, haben eine Materie, nur jeweils verschiedene; auch die ewigen ousiai, welche nicht dem Entstehen, wohl aber der Bewegung unterworfen sind, haben eine Materie, nicht aber für Entstehung, sondern nur für ein Woher – Wohin.
(2.6) [b26] Man könnte eine Schwierigkeit <in der Frage> sehen, aus welchem Nichtseienden die Entstehung hervorgeht, da das Nichtseiende in drei verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird. Wenn also etwas der Möglichkeit nach ist, ist es aber dennoch nicht aus dem ersten besten, sondern Verschiedenes aus Verschiedenem. Und es reicht nicht zu entgegnen: ,Alle Dinge waren beisammen‘; denn sie unterscheiden sich in Bezug auf die Materie. Weshalb sind denn sonst unendlich viele Dinge entstanden und nicht bloß eines? Denn die Vernunft ist nur eine, so dass wenn die Materie auch nur eine einzige wäre, jenes in Wirklichkeit würde, was die Materie der Möglichkeit nach ist.
(2.7) [b32] Es gibt also drei Ursachen und drei Prinzipien: zwei bilden den konträren Gegensatz, von denen der eine ein Begriff und eine Form, der andere Beraubung <der Form>, ist, das dritte ist Materie.“
2. Überblick
Ohne es näher zu begründen, beginnt Aristoteles sein im ersten Kapitel skizziertes Projekt der theoretischen Untersuchung der ousia mit einer Untersuchung der sinnlich wahrnehmbaren ousia. Die Analyse der wahrnehmbaren ousia mit ihren zwei Arten, den vergänglichen und den ewigen ousiai, erstreckt sich über die Kapitel 2 – 5. Während im zweiten und dritten Kapitel gefragt wird, was die Prinzipien sind, die wir annehmen müssen, um die wahrnehmbaren ousiai zu verstehen, steht in dem vierten und fünften Kapitel die Frage nach der Identität und der Verschiedenheit der in den Kapiteln zwei und drei diskutierten Prinzipien wahrnehmbarer ousiai zur Diskussion.
Ein Grund dafür, eine Untersuchung der ousia mit der wahrnehmbaren ousia zu beginnen, dürfte darin liegen, dass unstrittig ist, dass wahrnehmbaren Dingen der Status einer ousia zukommt [vgl. (1.4.1)]. Weiter ist unstrittig, dass es eine wesentliche Bestimmung dieser ousiai ist, der Bewegung bzw. der Veränderung unterworfen zu sein [vgl. (1.4.2)]. Weil es für sinnlich wahrnehmbare Einzeldinge wesentlich ist, der Veränderung unterworfen zu sein, muss man, wenn man die sinnlich wahrnehmbaren ousiai verstehen möchte, Veränderung verstehen und folglich fragen, welche Prinzipien man annehmen muss, um Veränderung verstehen zu können. Eine derartige Analyse der Veränderung hat also vornehmlich das Ziel, die Prinzipien der wahrnehmbaren ousiai zu ermitteln. Dass man eine Untersuchung der wahrnehmbaren ousiai so führen muss, dass man nach den Prinzipien der ousiai fragt, ist zwischen den Philosophen auch nicht weiter kontrovers: Im ersten Kapitel hatte Aristoteles darauf hingewiesen, dass die Elemente, d. h. die Prinzipien dieser ousia gefunden werden müssen [vgl. (1.4.1)]. Das zweite und dritte Kapitel verfolgen das Ziel, diese Prinzipien der wahrnehmbaren ousiai durch eine Analyse der Veränderung zu bestimmen. Eine erste Zusammenfassung dieser Untersuchung findet sich im letzten Satz des Kapitels [vgl. (2.7)], wenn Aristoteles sagt, dass zum Verständnis der sinnlich wahrnehmbaren ousia drei Ursachen und Prinzipien angenommen werden müssten: die Form, der Mangel an Form (d. h. die Formberaubung37) und die Materie.
Das zweite Kapitel beginnt mit der Feststellung, dass die sinnlich wahrnehmbare ousia der Veränderung unterworfen ist (2.1). Damit ist das Thema für das zweite und dritte Kapitel vorgegeben. Es folgen zwei größere Teile, ein Teil mit den Abschnitten (2.2) und (2.3), und ein zweiter Teil mit den Abschnitten (2.4)–(2.6). Eine Zusammenfassung der Diskussion in (2.7) leitet zum dritten Kapitel über.
In dem ersten Teil [(2.2) und (2.3)] wird für eine kategorienübergreifende Grundstruktur von Veränderung argumentiert. In (2.2) zeigt Aristoteles, dass drei Prinzipien zum Verständnis von Veränderung angenommen werden müssen: Zwei konträre Gegensätze und die Materie. Einerseits muss sich im Prozess der Veränderung etwas verändern, andererseits muss etwas beharren. Das, was sich verändert und was beharrt, kann nicht das Gegensatzpaar selbst, sondern nur die Materie sein. In (2.3) stellt Aristoteles die vier möglichen Arten von Veränderung vor, nämlich in der Kategorie der ousia, der Qualität, der Quantität und des Ortes. In jedem dieser Fälle ist die Veränderung als ein Übergang in den jeweiligen konträren Gegensatz zu verstehen. Ein Problem der Interpretation besteht darin, dass Aristoteles mit zwei unterschiedlichen Begriffen der Materie arbeitet. Im Fall der Veränderung der ousia, dem Entstehen oder Vergehen eines Einzeldings, ist es die Materie des aus Form und Materie konstituierten Einzeldings selbst, die sich verändert bzw. beharrt. Im Fall der Veränderung innerhalb der drei anderen Kategorien (Qualität, Quantität, Ort) ist die Materie demgegenüber identisch mit dem Einzelding selbst und nicht lediglich mit dessen Materie.
Der zweite Teil [(2.4)–(2.6)] behandelt die Materie als eines der drei Prinzipien ausführlicher. Dazu wird ein neues Modell, Veränderung zu verstehen, eingeführt, das nicht mehr mit den Problemen des zweifachen Materiebegriffs belastet ist. Veränderung ist in allen vier Kategorien der Übergang von etwas, das der Möglichkeit nach etwas ist, in etwas, das der Wirklichkeit nach etwas ist. Aus Seiendem der Möglichkeit nach, d. h. aus Materie, wird Seiendes der Wirklichkeit nach. Aristoteles untersucht hierbei mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad Probleme des Materiebegriffes. Während die Analyse von (2.4) für alle vier Arten der Veränderung gültig ist, gilt (2.5) einem speziellen Fall der Ortsveränderung, nämlich der Bewegung der ewigen Himmelskörper. Die Besonderheit der Himmelskörper besteht darin, dass diese ausschließlich der Ortsveränderung unterliegen.
Von (2.6) an wird bis zum Ende des dritten Kapitels die Veränderung innerhalb der ersten Kategorie, der ousia, thematisiert. Aristoteles fragt, aus welcher Art von Nichtseiendem das Entstehen einer ousia möglich ist. Diese Frage zielt auf die Materie als dem Nichtseienden der Wirklichkeit nach ab. Ausgeführt wird ferner, dass nicht alle Dinge ein und dieselbe Materie haben können oder aus einer solchen entstanden sind, sondern dass die verschiedenen Dinge in unserer Welt im Regelfall aus verschiedener Materie entstehen.
Das Schlusssatz (2.7) ist mehr als eine einfache Zusammenfassung, weil Aristoteles für die beiden konträren Gegensätze genauere Bezeichnungen einführt. Der erste Gegensatz wird als Begriff und Form bestimmt, der zweite als Formberaubung. Diese Bezeichnungen gelten im eigentlichen Sinn jedoch nur für die im weiteren Verlauf der Diskussion im dritten Kapitel entscheidende erste Art von Veränderung, die Veränderung der ousia. In einem weiten Sinn lassen sich die drei Begriffe aber auch auf alle anderen Arten der Veränderung anwenden.
3. Interpretation
(2.1) Der erste Satz des Kapitels nennt den Ausgangspunkt der Untersuchung, die sich über das zweite und dritte Kapitel erstreckt: Die sinnlich wahrnehmbare ousia ist der Veränderung unterworfen. Der Veränderung unterworfen zu sein, ist eine wesentliche Eigenschaft der sinnlich wahrnehmbaren ousia. Dass die wahrnehmbaren ousiai wahrnehmbar sind, ist keine Eigenschaft, die den wahrnehmbaren ousiai an sich zukommt, sondern eine Eigenschaft, die ihnen nur zukommt, insofern es, zumindest prinzipiell, Wahrnehmungssubjekte (z. B. Menschen) gibt, die diese ousiai wahrnehmen können. Wenn Aristoteles daran interessiert ist, eine wesentliche Eigenschaft aller wahrnehmbaren ousiai zu untersuchen, (d. h. nicht nur eine Eigenschaft zu untersuchen, die allen wahrnehmbaren ousiai faktisch zukommt, sondern eine Eigenschaft zu untersuchen, die etwas über das Wesen der wahrnehmbaren ousiai aussagt,) dann kann seine Untersuchung nicht die Tatsache, dass diese ousiai wahrnehmbar sind, zum Gegenstand haben.
Damit die wahrnehmbaren ousiai Wahrnehmungsobjekte für mögliche Wahrnehmungssubjekte sind, müssen die ousiai an sich bestimmte Bedingungen erfüllen. Eine wesentliche Bedingung ist dabei, einen materiellen Körper zu haben. Ein erster, noch eher intuitiver Zugang zum notwendigen Zusammenhang zwischen einem Wahrnehmungsobjekt und der Veränderung ist folgender: Unsere Welt ist so beschaffen, dass alles, was man wahrnehmen kann, einen im Raum ausgedehnten Körper hat. Nichts von dem, was einen Körper, der räumlich ausgedehnt ist, hat, ist aber unveränderlich, denn das Material, aus dem die Körper bestehen, verändert sich (selbst dann, wenn es mit bloßen Augen nicht immer zu beobachten ist). Für Aristoteles ist, wie später deutlich werden wird, der Zusammenhang zwischen Wahrnehmbarkeit und Veränderung noch etwas abstrakter: Jede sinnlich wahrnehmbare ousia ist aus Materie und Form konstituiert. Die Materie ist dabei das Prinzip der Möglichkeit der aus Form und Materie konstituierten ousia. Somit verfügt jede wahrnehmbare ousia notwendig über ein Prinzip der Möglichkeit, d. h. es ist der Möglichkeit nach etwas anderes als es zu einem gegebenen Zeitpunkt faktisch ist. Das bedeutet aber, dass die Materie dafür verantwortlich ist, dass sich die wahrnehmbare ousia verändert. Eine Untersuchung der Prinzipien der Veränderung ist also keine Untersuchung, die lediglich eine unbedeutende Eigenschaft der wahrnehmbaren ousia erfasst, sondern Aristoteles zufolge die Art von Untersuchung, die geführt werden muss, wenn wir die wahrnehmbare ousia verstehen wollen. Dennoch bleibt ein Problem bei Aristoteles, und zwar nicht nur in Buch Lambda, leider ganz ungeklärt. Warum ist er der Auffassung, dass die Prinzipien der Veränderung einer wahrnehmbaren ousia die Prinzipien dieser ousia selbst sind?
(2.2) Das Ziel der beiden folgenden Argumente (2.2.1) und (2.2.2) ist es zu zeigen, dass wir drei Prinzipien annehmen müssen, wenn wir Veränderung verstehen wollen. Aus dem zehnten Kapitel wird deutlich [vgl. (10.2.2)], dass sich Aristoteles damit gegen die Auffassung richtet, Veränderung ließe sich durch die Angabe von lediglich zwei Prinzipien verstehen. Dieser von ihm kritisierten Auffassung zufolge ist es ausreichend, die jeweiligen Gegensätze anzugeben, innerhalb derer sich die Veränderung vollzieht. Wenn beispielsweise grüne Blätter im Herbst braun werden, lässt sich Aristoteles zufolge diese Veränderung nicht einfach dadurch beschreiben, dass Grünes zum Braunen wird. Wir müssen etwas drittes, die Materie, angeben, die zu Beginn des Veränderungsprozesses grün und am Ende des Veränderungsprozesses braun ist. Eine Schwierigkeit des Abschnittes besteht darin zu verstehen, warum Aristoteles in (2.2.1) sagen kann, dass sich die Materie verändert [vgl. auch (2.4.1)], in (2.2.2) aber sagt, dass sie beharrt.
(2.2.1) Bevor Aristoteles sein Argument gegen die Annahme von zwei Prinzipien vorträgt, präzisiert er den Begriff des Gegensatzes. Nicht jeder mögliche Gegensatz kommt als ein Gegensatz, innerhalb dessen sich Veränderung vollziehen kann, in Frage. So steht die Stimme beispielsweise zwar in einem Gegensatz zum Weißen, denn die Stimme ist nicht weiß (also etwas Nicht-Weißes). Aber es kann nichts geben, das sich vom Weißen zur Stimme hin verändert. Veränderung kann es nur innerhalb von konträren Gegensätzen einer Gattung geben. Gegensätze sind dann konträr, wenn sie, etwas ungenau gesprochen, die extremen Gegensätze innerhalb einer Gattung sind. Eine solche Gattung bilden beispielsweise die Farben. Die konträren Gegensätze innerhalb der Gattung der Farben sind für Aristoteles weiß und schwarz. Sie sind die Extreme des Farbspektrums, und alle anderen Farben liegen zwischen diesen Extremen. Wenn Aristoteles davon spricht, dass eine Veränderung auch von „den Dingen, die in der Mitte liegen“, ausgehen kann, dann differenziert er seine Behauptung, dass Veränderung ausschließlich zwischen konträren Gegensätzen möglich ist; in dem Farbspektrum gehören die Farben grün, rot und gelb beispielsweise zu den Farben, die „in der Mitte“, d. h. im Zwischenraum zwischen den Extremen schwarz und weiß, liegen. Aristoteles’ Analyse umfasst also auch Veränderungen von gelb zu schwarz oder, wie wir ergänzen können, von gelb zu rot.
Das Argument in (2.2.1) für die Annahme eines dritten Prinzips, der Materie, beruht auf folgender Überlegung. Wenn beispielsweise ein grünes Blatt braun wird, dann verändern sich nicht eigentlich die Gegensätze selbst, d. h. die Farben Grün und Braun. Die Farben bleiben dieselben, auch nach der Veränderung der Farbe des Blattes. Es muss also etwas Drittes über die beiden Gegensätze hinaus geben, das sich verändert. In unserem Beispiel ist es das Blatt selbst. Das Blatt ist zu einem Zeitpunkt t1 grün gewesen und ist nun zu einem späteren Zeitpunktt1+n braun geworden.
(2.2.2) Das Argument in (2.2.2) für die Annahme eines dritten Prinzips ist zunächst verwirrend. Während Aristoteles in (2.2.1) behauptet hat, dass es etwas geben muss, das sich im Prozess der Veränderung verändert, behauptet er nun in (2.2.2), dass es im Veränderungsprozess etwas geben muss, das beharrt. Die Konklusion beider Argumente in (2.2.3) lässt zudem keinen Zweifel daran, dass es in beiden Fällen um ein und dieselbe Sache, nämlich die Materie, geht, von der es im ersten Argument heißt, sie verändere sich, und von der im zweiten Argument angenommen wird, sie beharre.
Das Problem löst sich, wenn wir beachten, dass das zweite Argument (2.2.2) den Prozess der Veränderung aus einer anderen Perspektive betrachtet.38 Während das erste Argument die Veränderung unter der Rücksicht betrachtet hat, dass sich etwas, in unserem Beispiel das Blatt, tatsächlich verändert hat, obwohl sich die Gegensätze selbst nicht verändert haben, betrachtet das zweite Argument die Veränderung unter der umgekehrten Rücksicht, dass etwas, in unserem Beispiel das Blatt, beharrt und sich im Veränderungsprozess gerade nicht verändert. Dass das Blatt beharrt und sich nicht verändert, kann man leicht verstehen: Das Blatt bleibt durch den Veränderungsprozess hindurch das, was es ist, nämlich ein Blatt. Dass die Gegensätze nicht beharren bedeutet, dass das Grüne am Blatt tatsächlich verschwindet und das Braune erscheint. Beide Perspektiven, die Veränderung zu beschreiben, ergänzen sich gegenseitig.39
Die Einführung der beiden Perspektiven provoziert die Frage, ob Aristoteles mit zwei unterschiedlichen Begriffen der Materie arbeitet, und wir werden in der Interpretation des nächsten Abschnitts sehen, dass sich dieselbe Frage auch noch aus einem weiteren Grund stellt. In der ersten Perspektive ist die Materie identisch mit dem offenbar nicht weiter differenzierten Einzelding. Es ist das Blatt, das sich verändert. In der zweiten Perspektive ist die Materie nicht mehr identisch mit dem Einzelding, sondern mit dem, was wir als einen Träger dieser Eigenschaften bestimmen könnten. Beides, das nicht weiter differenzierte Einzelding in der ersten, und der Träger der Eigenschaften, die sich verändern, in der zweiten Perspektive, wird von Aristoteles ,Materie‘ genannt. Dass Aristoteles diese beiden Materiebegriffe, allerdings in Bezug auf einen anderen Kontext, tatsächlich unterschieden hat, sei im Zusammenhang mit der Interpretation des nächsten Abschnitts erläutert. Bezogen auf (2.2) stellt sich aber die Frage, was Aristoteles der Sache nach veranlasst haben mag, überhaupt die beiden Perspektiven einzuführen, unter denen Veränderung beschrieben werden kann.
Ein Grund dürfte vielleicht darin liegen, dass jeweils eine Perspektive für sich allein genommen zu unerwünschten ontologischen Konsequenzen führt. Wenn man lediglich die erste Perspektive einnimmt, dann wäre eine Welt, in der sich alles, was wahrnehmbar ist, in steter Veränderung befindet, die Konsequenz. In einer solchen Welt hätte man streng genommen gar nicht mehr die Möglichkeit, davon zu sprechen, dass sich ein Blatt verändert, weil diese Ausdrucksweise bereits voraussetzt, dass das Blatt eine gewisse Beharrlichkeit und Konstanz besitzt und vor und nach der Veränderung dasselbe ist. Wenn man lediglich die zweite Perspektive einnimmt, dann wäre die Konsequenz eine Ontologie, in der die Veränderung in keinem Fall als eine Veränderung des Dinges selbst, sondern nur seiner Eigenschaften verstanden werden kann. Ein Einzelding besteht dann aus einem unveränderlichen Träger und seinen wechselnden Eigenschaften. Eine derartige Annahme provoziert aber die Frage, was denn überhaupt ein solcher unveränderlicher Träger sein soll. Und was würde dafür sprechen, überhaupt noch von einem Träger und seinen Eigenschaften zu sprechen, als vielmehr die Dinge selbst nur noch als eine Kombination verschiedener Eigenschaften aufzufassen?
(2.3) Aristoteles untersucht in (2.3) zunächst, innerhalb welcher Kategorien es überhaupt Veränderung geben kann. Seine Behauptung ist, dass es Veränderung nur in der Kategorie der ousia, der Qualität, der Quantität und des Ortes gibt.40 Die erste Art der Veränderung, die Veränderung der ousia, besteht im Entstehen und Vergehen eines Einzeldings, z. B. eines bestimmten Menschen. Wie alle vier Arten von Veränderung und überhaupt alle Kategorien [vgl. die Interpretation zu (1.2.1)], so wird auch diese Veränderung mit einem Fragepronomen eingeführt: Das Entstehen und Vergehen ist eine Veränderung des Was. Damit ist folgendes gemeint. Aristoteles geht von einer Frage aus, in der das Fragepronomen ,was‘ vorkommt. Eine solche Frage ist die Frage , Was ist das?‘. Die Frage zielt darauf, was etwas seinem Wesen nach ist. Was als eine mögliche Antwort auf diese Frage gegeben werden kann, ist weniger einfach zu sagen. Deutlich ist, dass Aristoteles in seinen frühen Schriften, vor allem in der Topik41 und in den Kategorien42 , diese Frage mit einem Ausdruck beantwortet, der für ein Einzelding oder aber dessen Art bzw. Gattung steht: ,Das ist Sokrates‘ oder ,Das ist ein Mensch‘43. Aus den frühen Schriften geht deutlich hervor, dass wir die , Was ist das?‘-Frage sowohl mit einem Namen für ein Individuum als auch mit einem Art- oder Gattungsbegriff beantworten dürfen. Was für Typen von Antworten Aristoteles auf die , Was ist das?‘-Frage in der Metaphysik zulässt, ist umstritten. Es gibt Interpreten, die der Auffassung sind, in der Metaphysik nähere sich Aristoteles einer platonischen Position an und vertrete, dass im eigentlichen Sinn nur Art- und Gattungsbegriffe als Antworten auf die , Was ist das?‘-Frage genannt werden können. Diese Position bedeutet der Sache nach, dass das, was ein Einzelding seinem Wesen nach ist, durch einen Art- oder Gattungsbegriff adäquat beantwortet wird. Andere Interpreten nehmen die gegenteilige Position ein und meinen, dass eigentlich ausschließlich Namen von konkreten Einzeldingen mögliche Antworten auf die , Was ist das?‘-Frage sein können.44 Wir werden im vierten und fünften Kapitel sehen, dass in Bezug auf das Buch Lambda die zweite Interpretation dem Text gerechter wird. Damit ist natürlich nicht schon ausgemacht, dass diejenige Position, die Aristoteles in Lambda vertritt, auch diejenige Position ist, die den anderen Büchern der Metaphysik zugrunde liegt. Schon im Kontext des zweiten Kapitels ist aber deutlich, dass die zweite Antwort mehr für sich hat, denn die richtige Antwort auf die Frage , Was ist das?‘ gibt in (2.3) genau dasjenige an, was dem Entstehen und Vergehen unterworfen ist. Nun sind aber nur konkrete Einzeldinge dem Entstehen und Vergehen unterworfen; Arten und Gattungen lassen sich zwar in einer Darwinschen, nicht aber in einer Aristotelischen Welt, in der Arten und Gattungen ewig sind, als etwas verstehen, das entsteht oder vergeht. Analog zu der , Was ist das?‘-Frage werden auch die drei weiteren Arten der Veränderung mit Fragepronomen eingeführt. Die Veränderungen der Qualität erfragt man mit , Wie beschaffen ist es?‘, die Veränderung der Quantität mit , Wieviel (oder wie groß) ist es?‘, die des Ortes mit , Wo ist es?‘.
In Bezug auf diese vier Arten der Veränderung wiederholt sich nun das Problem, das uns schon bei der Interpretation des Materiebegriffs in (2.2) begegnet ist. Um dieses Problem detaillierter nachvollziehen zu können, muss man sich vergegenwärtigen, dass der Begriff der Materie in der Aristotelischen Metaphysik ein Begriff ist, der in den meisten Kontexten komplementär zum Begriff der Form gebraucht wird. Ein konkreter Einzelgegenstand ist Aristoteles zufolge vor allem durch zwei konstituierende Prinzipien bestimmt: Form und Materie. Die Form gibt das Sein des konkreten Einzelgegenstands an. Die Form des Sokrates ist beispielsweise das Sokratessein, die Form einer Kugel aus Erz das Kugelsein. Die Materie eines konkreten Einzelgegenstandes ist das dem Einzelgegenstand inhärente Prinzip der Veränderung dieses Einzelgegenstandes.
Das Problem ist nun folgendes. Je nachdem, ob es sich bei einer Veränderung um eine Veränderung der ousia oder um eine Veränderung innerhalb der drei anderen Kategorien, d. h. der Qualität, Quantität oder des Ortes, handelt, ändert sich das, was unter der Materie zu verstehen ist. Im Fall einer Veränderung der Qualität, der Quantität oder des Ortes ist die Materie identisch mit dem Einzelgegenstand selbst. Unser Beispiel vom Blatt, das seine Farbe verändert, kann dieses deutlich machen. In dem Beispiel ist das dritte Prinzip der Veränderung, die Materie, ja nichts anderes als der Einzelgegenstand selbst, der sich verändert (bzw., aus der zweiten Perspektive von (2.2.2) betrachtet, der beharrt und an dem sich die Veränderung vollzieht). Die Materie ist hier also nicht ein konstituierender Teil des Einzelgegenstandes, des Blattes, sondern das Blatt selbst, d. h. das aus Form und Materie konstituierte Einzelding.
Anders ist es aber im Fall der ersten Art von Veränderung, dem uneingeschränkten Entstehen und Vergehen eines Einzelgegenstandes. Aristoteles nennt das Entstehen hier ,uneingeschränkt‘, um es von dem Entstehen beispielsweise einer neuen Farbe an einem Gegenstand abzugrenzen. Beim Entstehen und Vergehen vollzieht sich die Veränderung nicht an dem Einzelgegenstand, sondern tatsächlich ausschließlich an der Materie eines Einzelgegenstandes, der neben dieser Materie auch durch das Prinzip der Form konstituiert ist.
Wir müssen also, je nach Art der Veränderung, einen engen und einen weiten Begriff der Materie unterscheiden. Beim engen Begriff der Materie, mit dem wir bei der Veränderung der ousia arbeiten, ist der Begriff der Materie identisch mit der Materie eines aus eben dieser Materie und Form zusammengesetzten Einzelgegenstandes. Beim weiten Begriff der Materie, mit dem wir in den übrigen drei Arten der Veränderung arbeiten, ist die Materie identisch mit dem Einzelgegenstand selbst.
Neben Passagen im Werk von Aristoteles, in denen er ebenso wie im zweiten Kapitel von Lambda die der Sache nach notwendige Unterscheidung im Materiebegriff nicht ausdrücklich macht, gibt es andere Passagen, in denen er die beiden Begriffe der Materie genau unterscheidet.45 Dass diese Unterscheidung in Lambda nicht gemacht wird, muss nicht bedeuten, dass Aristoteles sie nicht der Sache nach für wichtig gehalten oder dass er zu der Zeit, in der er Lambda geschrieben hat, noch nicht die Notwendigkeit dieser Unterscheidung gesehen hat. Wir können auch vermuten, dass er wegen der Kürze des Traktats in Lambda 2 – 5 nur diejenigen Differenzierungen ausdrücklich machen wollte, die für seine Untersuchung unbedingt notwendig sind.
(2.4) (2.4.1) Vielleicht auf Grund der in (2.2) angesprochenen Schwierigkeit des Materiebegriffs vertieft Aristoteles seine Analyse dessen, was die Materie ist, im Folgenden durch die Einführung des Begriffs der Möglichkeit. Ganz unabhängig davon, was für eine Art von Veränderung vorliegt (d. h. unabhängig davon, ob die Materie identisch mit dem Einzelgegenstand oder mit einem konstituierenden Teil des Einzelgegenstandes ist), ist die Materie das Prinzip der Möglichkeit zur Veränderung. Wenn Aristoteles schreibt, dass das Seiende zweierlei ist, dann meint er damit, dass es das Seiende entweder der Möglichkeit oder der Wirklichkeit nach gibt. Die Veränderung besteht dann darin, dass etwas, das zu einem Zeitpunktt1 der Möglichkeit nach F ist, zu einem späteren Zeitpunkt t1+n der Wirklichkeit nach F ist. So ist ein Blatt zum Zeitpunktt1 der Möglichkeit nach braun (weil es noch grün ist) und zum Zeitpunkt t1+n dann der Wirklichkeit nach braun. Dass die Materie zu beiden Gegensätzen die Möglichkeit hat bedeutet, dass ein Gegenstand, der zum Zeitpunktt1 die Eigenschaft F hat, der Möglichkeit nach zum selben Zeitpunkt die Eigenschaft nicht-F hat, und wenn er zum Zeitpunkt t1+n die Eigenschaft nicht-F hat, zu diesem Zeitpunkt der Möglichkeit nach die Eigenschaft F hat.
(2.4.2) Mit der Einführung der Begriffe der Möglichkeit und der Wirklichkeit löst Aristoteles eine Schwierigkeit, mit der sich, vor allem durch Parmenides provoziert, einige Vorsokratiker und auch Platon herumgeschlagen haben. Wie ist es überhaupt möglich, dass etwas wird? Wenn etwas Seiendes wird, dann wird es entweder aus Seiendem oder aus Nichtseiendem. Aus Seiendem kann es nicht werden, denn es ist ja immer schon, aus Nichtseiendem kann es nicht werden, denn aus Nichts wird nichts.46 Aristoteles kann demgegenüber erstens behaupten, dass etwas aus Seiendem wird, nämlich aus Seiendem der Möglichkeit nach, als auch, dass etwas aus Nichtseiendem wird, nämlich Nichtseiendem der Wirklichkeit nach. Etwas, das zum Zeitpunktt1 der Wirklichkeit nach nicht F ist, ist zum Zeitpunkt t1+n der Wirklichkeit nach F.
Auch dann, wenn Aristoteles in (2.4.2) lediglich ein Argument andeutet, ist es wahrscheinlich, den in Frage stehenden Satz im Sinne der doppelten Unterscheidung von Seiendem und Nichtseiendem auf der einen Seite und Wirklichkeit und Möglichkeit auf der anderen Seite zu interpretieren. Der Schluss von (2.4.2) ist dabei klarer als der Anfang. Dass etwas aus Seiendem wird, bedeutet, dass es aus etwas wird, was der Möglichkeit nach ist. Warum Aristoteles aber meint aus (2.4.1) schließen zu können, dass etwas nicht nur aus Nichtseiendem in akzidentellem Sinn wird, ist nicht deutlich. Vielleicht meint Aristoteles mit dem Ausdruck ,Nichtseiendes in akzidentellem Sinn‘, dass ein a, das zum Zeitpunkt t1+n F ist, zum Zeitpunkt t1 nicht F (d. h. nicht-F seiend) ist, und dass es a zum Zeitpunktt1 zukommt, auf akzidentelle Weise nicht F zu sein.47
Von systematischem Interesse ist, dass wir zwei Möglichkeiten haben, die Veränderung mit Hilfe der Begriffe ,Möglichkeit‘ und , Wirklichkeit‘ zu beschreiben. Die erste Möglichkeit besteht darin zu sagen, dass alles vom Seienden (der Möglichkeit nach), die zweite, dass alles vom Nichtseienden (der Wirklichkeit nach) ausgeht. Deswegen meint Aristoteles auch, dass alles „auch aus Seiendem“ (nämlich der Möglichkeit nach) wird.48
(2.4.3) Aristoteles sichert die Analyse von (2.4.1) und (2.4.2) dadurch ab, dass er sich auf vier prominente Vorsokratiker beruft. Die vier Vorsokratiker lösen Aristoteles zufolge das Problem, das nichts aus nichts entstehen kann, durch die Annahme, es sei alles beisammen. Das bedeutet, dass sie der Auffassung sind, irgendwie sei alles immer schon da, müsse aber erst noch in Erscheinung treten. Zwar haben weder Anaxagoras noch Empedokles noch Anaximander noch Demokrit wörtlich von der Materie gesprochen, aber Aristoteles ist offenbar der Meinung, dass wenn man ihre Gedanken klarer ausdrücken wollte zu dem Ergebnis kommen müsste, dass sie die Materie, die das Prinzip der Möglichkeit ist, angenommen haben.49
(2.5) Aristoteles diskutiert hier ein Spezialproblem seiner Veränderungslehre, das sich in Bezug auf die ewigen Himmelskörper stellt. Bei denjenigen sinnlich wahrnehmbaren ousiai, die nicht ewig sind (die also entstehen und vergehen), lässt sich sowohl eine Materie, die dem Entstehen und Vergehen zugrunde liegt (d. h. die Materie im engen Sinn), als auch eine Materie, die den anderen Formen der Veränderung zugrunde liegt (d. h. die Materie im weiten Sinn) unterscheiden. Bei den Himmelskörpern ist das in relevanter Hinsicht anders. Weil sie ewig sind, entstehen und vergehen sie nicht. Sie können keine Materie haben, die dem Entstehen und Vergehen zugrunde liegt. Sie haben aber auch keine Materie, die der Veränderung der Qualität oder der Quantität zugrunde liegt, weil ihre einzige Form der Veränderung die Ortsveränderung ist, d. h. die Bewegung, mit der sie am Himmel ihre Bahnen entlang ziehen. Folglich haben sie nur eine bestimmte Art von Materie, nämlich eine Materie, die der Ortsbewegung zugrunde liegt.50 Für den Gesamtzusammenhang in Lambda ist an diesem Abschnitt die Tatsache wichtig, dass Aristoteles offensichtlich seine Analyse im zweiten Kapitel (und damit auch seine gesamte Analyse der sinnlich wahrnehmbaren ousiai in den Kapiteln 2 – 5) nicht nur für vergänglichen, sondern auch für die ewigen wahrnehmbaren ousiai führt.51
(2.6) Der erste Satz von (2.6) bereitet zwei Schwierigkeiten. Erstens wird nicht gesagt, welche drei Arten des Nichtseienden gemeint sind. Aristoteles unterscheidet an anderen Stellen der Metaphysik52 zwischen erstens Nichtseiendem der Formen der Kategorien nach, zweitens Nichtseiendem der Möglichkeit bzw. der Wirklichkeit nach, und drittens dem nicht wahr Seienden, d. h. dem Falschen. Zweitens ist unklar, warum dieser erste Satz überhaupt an dieser Stelle im zweiten Kapitel steht, und ob er nicht vielmehr zum Abschnitt (2.4.2) gehört, in dem ja bereits von dem Nichtseienden die Rede gewesen ist. Einige Interpreten haben vorgeschlagen, den Satz zu streichen53 oder haben gemeint, er sei durch die Schreiber der Manuskripte versehentlich an eine falsche Stelle gesetzt worden und gehöre eigentlich zu (2.4.2). Nun ist in (2.4.2) tatsächlich von Nichtseiendem die Rede, allerdings nur von Nichtseiendem in akzidentellem Sinn.
Gegenüber (2.4) fällt in (2.6) aber auf, dass nicht mehr von allen vier Arten der Veränderung, sondern ausschließlich vom Entstehen und Vergehen einer ousia die Rede ist. Der erste Satz des Kapitels [vgl. (2.1)] kündigt ja die Veränderung der wahrnehmbaren ousia als Thema das Kapitels an. Nur in diesem Fall der Veränderung sind die dabei beteiligen Prinzipien tatsächlich die Prinzipien einer ousia, die zu klären Aristoteles angetreten ist. Mit (2.6) beginnt Aristoteles offenbar, sich ausschließlich dem Entstehen und Vergehen, d. h. der Veränderung des Einzeldings, der ousia, zuzuwenden, und dieses Thema behandelt er bis zum Ende des dritten Kapitels. Während in (2.4.2) also vom Nichtseienden in Bezug auf alle vier Arten der Veränderung die Rede war, ist in (2.6) ausschließlich von der Veränderung der ousia, d. h. vom Entstehen und Vergehen, die Rede.
Wenn man sich diese Interpretation zu Eigen macht, kann auch erklärt werden, warum Aristoteles ein bestimmtes Argument, das er in (2.4.3) schon einmal aufgeführt hatte, nun noch ein zweites Mal, allerdings in einer bezeichnenderweise anderen Formulierung, anführt. In (2.4.3) war sowohl in Bezug auf Anaxagoras als auch in Bezug auf Demokrit davon die Rede, dass alles beisammen war. In (2.6) heißt es demgegenüber bezeichnenderweise, dass alle Dinge (gr. chrēmata) beisammen waren. Es geht Aristoteles also offenbar in (2.6) ausschließlich um die Veränderung der Dinge selbst. Der erste Satz von (2.6) steht also tatsächlich aus einem bestimmten Grund an genau dieser Stelle im zweiten Kapitel.
Damit ist aber noch nicht beantwortet, aus welchem Nichtseienden die Entstehung hervorgeht. Innerhalb von Lambda findet man auf diese Frage keine Antwort, aber wie die Antwort auf die Frage lauten muss, lässt sich aus einer parallelen Stelle im letzten Buch der Metaphysik erschließen.54 Es ist das Nichtseiende der Wirklichkeit nach. Aristoteles schreibt an der besagten Stelle, dass das Entstehen aus dem der Möglichkeit nach Seienden, aber der Wirklichkeit nach nicht Seienden hervorgeht. Der Mensch werde beispielsweise aus dem, was nicht der Wirklichkeit nach, aber doch der Möglichkeit nach ein Mensch sei. Damit gilt die Analyse, die Aristoteles in (2.4.2) für die Veränderung der akzidentellen Eigenschaften eingeführt hat, ausdrücklich auch für die ousia.
Eine weitere Aussage in (2.6) ist, dass die Materie als Ursache und Prinzip des Entstehens einer ousia nicht ein unqualifizierter Urstoff, ein erstes Bestes, ist, so dass alles, was es gibt, aus dieser einen Materie hervorgeht, sondern vielmehr alles, was entsteht bzw. vergeht, aus einer bestimmten Materie hervorgeht.55 Was Aristoteles damit meint, wird deutlicher, wenn man ein Beispiel aus dem siebten Kapitel des neunten Buch der Metaphysik hinzunimmt. Aristoteles führt dort aus, dass etwas, das der Möglichkeit nach etwas ist, bestimmten Kriterien genügen muss. Er fragt, wann etwas der Möglichkeit nach ein Mensch ist, und kommt zu dem Ergebnis, dass weder die Erde noch das Sperma der Möglichkeit nach ein Mensch ist. Es ist erst der Fötus, dem es zukommt, der Möglichkeit nach ein Mensch zu sein. Die Materie des Menschen ist also weder die Erde noch das Sperma, sondern der Fötus des Menschen.56
Mit der These, dass eine Materie als Prinzip angenommen werden muss, kritisiert Aristoteles den schon in (2.4.3) erwähnten Anaxagoras. Anaxagoras hatte angenommen, dass die Vernunft das Prinzip ist, das erklärt, warum alle Dinge so sind, wie sie sind. Diese Vernunft ist eine Einzige. Anaxagoras übersieht, dass man die Vielfalt der Dinge nicht aus einem einzigen Prinzip erklären kann. Deswegen kann die Vielfalt nicht aus der Vernunft erklärt werden. Wir brauchen also ein anderes Prinzip, das (evtl. zusammen mit der Vernunft) die Vielfalt der Dinge erklären kann. Dieses Prinzip ist die Materie. Anderenfalls, wenn die Materie, wie Aristoteles schreibt, auch nur eine Einzige wäre, würde alles, was der Möglichkeit nach ist, der Wirklichkeit nach sein, so dass es gar keine Unterscheidung zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit mehr gäbe.
(2.7) Die Konklusion, die Aristoteles aus der Untersuchung des zweiten Kapitels zieht, ist in einer Hinsicht überraschend. Dass das dritte Prinzip die Materie ist, ist unproblematisch. Dass die beiden konträren Gegensätze nun aber einerseits als Begriff bzw. Form, andererseits als Formberaubung bestimmt werden, kommt für uns unerwartet. Nun gibt es eine Art der Veränderung, in der die konträren Gegensätze tatsächlich die Form und die Formberaubung im eigentlichen Sinn sind, nämlich die erste Art der Veränderung, das Entstehen und Vergehen. Aristoteles konzentriert sich offenbar auf das Einzelding, das dem Entstehen und Vergehen unterworfen ist. Diese Orientierung am Einzelding ist durch (2.6) vorbereitet und ist auch innerhalb des Projekts, das Aristoteles in Lambda verfolgt, sinnvoll. Immerhin sind die Einzeldinge die unumstrittenen Kandidaten für die ousia.
Allerdings kann in einem weiteren Sinn auch von Materie, Form und Formberaubung in den anderen Kategorien gesprochen werden. So ist Aristoteles beispielsweise in Bezug auf die Farben der Auffassung, dass die Form das Weiße, die Formberaubung das Schwarze und die Materie der Körper57 ist. In Bezug auf die Gesundheit ist die Form das Gesunde, die Formberaubung das Kranke und die Materie der Körper [vgl. (4.4) und (4.5.2)]. Mit diesem weiten Verständnis von Form, Formberaubung und Materie sind allerdings Schwierigkeiten verbunden, denn es ist nicht immer plausibel, was sinnvollerweise als Form und was als Formberaubung gelten kann. Im Beispiel der Gesundheit ist es verständlich, das Gesunde als die Form und das Kranke als die Formberaubung zu verstehen. Ob man aber beispielsweise ,in Oxford sein‘ als Form oder Formberaubung auffassen kann, wird eher von persönlichen Präferenzen abhängen.
Um zu verstehen, warum Form und Formberaubung die konträren Gegensätze bei der Entstehung und dem Vergehen sind, muss man sich von der Vorstellung lösen, dass die Form eines Einzeldings nichts weiter als das ist, was ein konkretes Einzelding seinem Sein nach jeweils ist. Nehmen wir als Beispiel einen jungen Mann, Martin. Lassen wir ihn Philosophie studieren und ihn sich mit den schwierigen Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach seinem Beruf und seiner Zukunft herumschlagen. Die Form von Martin beschreibt nun nicht das, was Martin jetzt gerade ist, sondern das, was Martin einmal sein wird, wenn er sein Martinsein vollkommen entfaltet hat. Martin befindet sich also noch in der Veränderung von der Formberaubung (denn noch hat er ja nicht die Form erreicht, ihm fehlt noch etwas an der Form) hin zum Erreichen seiner Form. Dabei entwickelt sich auch nicht die Form, denn die Form steht von Anfang an fest: Sie ist das, was Martin eigentlich seinem Wesen nach ist und was sich erst noch zeigen wird.58 Es ist Martin, der sich entwickelt, von der Formberaubung hin zu seiner Form.
Das Beispiel von Martin kann noch ein Zweites deutlich machen. Man hat manchmal gefragt, warum Aristoteles in Lambda eigentlich nicht die Zielursache mit in seine Untersuchung der Prinzipien und Ursachen aufgenommen hat. In anderen Kontexten, am ausführlichsten in der Physik, ist stets von vier Ursachen die Rede, der Form, der Materie, der Zielursache und der Bewegungsursache. Die Bewegungsursache wird ausführlich im dritten Kapitel behandelt. Dass die Zielursache aber nicht erwähnt wird, liegt zum einen daran, dass durch die Formursache in wichtiger Hinsicht die Zielursache mitgegeben ist. Bei Lebewesen sind die Form und die Zielursache identisch. Die Form von Martin beschreibt das Ziel, auf das hin er sich entwickelt. Es mag noch einen wichtigen zweiten Grund dafür geben, dass Aristoteles die Zielursache nicht eigens aufführt. Der zweite Teil der Untersuchung in Lambda wird ergeben, dass es eine einzige letzte Zielursache für jede Art der Veränderung gibt, nämlich die unbewegte, erste, ewige ousia. Man kann vermuten, dass Aristoteles die Einführung der Zielursache nicht vorwegnehmen wollte (zumal er sie, wie wir gesehen haben, der Sache nach gar nicht einführen muss), um sie dann neu im zweiten Teil von Lambda einführen zu können.