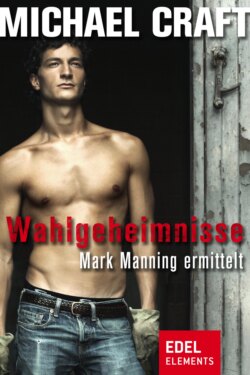Читать книгу Wahlgeheimnisse - Michael Craft - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Freitag, 15. September
ОглавлениеHäuslichkeit hatte in meinem Leben nie eine große Rolle gespielt. In meinen früheren Jahren als junger Reporter, der sich eine Karriere beim Chicago Journal aufbaute, hatte ich zum Nestbau wenig Zeit und war auch nicht sehr daran interessiert. Zwei Ereignisse jedoch – echte Wendepunkte – führten dazu, dass sich mein Desinteresse an Haus und Heim tiefgreifend änderte.
Zuerst lernte ich Neil kennen. Ich war noch nie wirklich verliebt gewesen und dann, mit neununddreißig, war es passiert – mit einem Mann (man bedenke), der zufällig noch Architekt war. Dadurch löste sich auch eine spezielle Identitätskrise, an der ich lange zu kauen gehabt hatte (ich konnte den Verdacht, ich könnte schwul sein, nicht länger beiseite wischen), und genauso lehrte es mich, eine schöne Innenausstattung neu schätzen. Ich hatte eine Eigentumswohnung in Chicagos schickem Viertel Near North gekauft, aber erst Neil, der aus Phoenix gekommen war, um mit mir zusammen zu leben, hatte sein ganzes Talent aufgewendet, um die Wohnung umzubauen und einzurichten. Als wir damit fertig waren, hatten wir ein zeitschriftenreifes Modell hingestellt; und wir hatten uns ein ›Heim‹ geschaffen.
Dann, vor nicht einem Jahr, hatte sich in der Woche meines Umzugs nach Dumont Thad Quatrains Leben mit meinem verbunden. Es war eine wenig glückverheißende Kombination, um es milde auszudrücken. Mein Neffe (technisch gesehen, eigentlich ein Cousin zweiten Grades) verhielt sich Neil und mir gegenüber wie ein absoluter Rotzlöffel, mit all dem Charme und Liebreiz eines jugendlichen, homophoben Spießers, der er, an dem Tag, als wir uns kennen lernten, tatsächlich auch war. Man kann sich seine Bestürzung ausmalen, als an eben jenem Tag seine Mutter jung starb und in ihrem Testament mich dazu bestimmt hatte, für ihn zu sorgen.
Ich hatte mich inzwischen mit der Rolle eines „berufstätigen Stadtschwulen“ angefreundet und es auch nicht einen Augenblick lang für möglich gehalten, einmal ein Kind aufzuziehen, aber jetzt stand ich urplötzlich vor genau dieser unerwarteten Aufgabe. Sich an den seltsamen Alltag mit einem Teenager zu gewöhnen, war schon Herausforderung genug; viel mehr zu schaffen machte mir die erzwungene geistige Umorientierung, die Identitätskrise. Als was sollte ich mich selbst sehen? Verfügte mein Vokabular überhaupt über die Worte, die dieses neue Ich bezeichnen konnten? Schwuler Vater, Onkel Mark, Neils Liebhaber, Thads Vater …
Aber wir schafften es, uns zusammenzuraufen – Thad und ich, und Neil auch. Während Neil mir beibrachte, wie man zur einen Hälfte eines Paares wurde, hat Thad mir beigebracht, Mitglied einer Familie zu werden. Häuslichkeit spielt inzwischen eine große Rolle in meinem Leben. Und entsprechend hat sich der Schwerpunkt meines Tagesablaufs verlagert.
Vor noch gar nicht langer Zeit war der Inbegriff der höchsten täglichen Belohnung die abendliche Cocktailstunde gewesen – eine kurze, kultivierte Zeit des Innehaltens, der Erholung und des Gesprächs mit ihren charakteristischen tröstlichen Ritualen – dem auf Hochglanz Polieren der Kristallgläser, dem Klirren von Eis, dem Anstoßen und dem ersten gemeinsamen Schluck. Neil und ich hatten am Abend unseres Kennenlernens eine raffinierte Mixtur zu ›unserem‹ Drink erklärt und seither an jedem Abend (das heißt, an jedem Abend, den wir gemeinsam verbrachten) japanischen Wodka über Eis gegossen und ihn mit Orangenschale garniert und dann die Mühen des Tages vergessen.
Dieses Ritual ist jetzt unterbrochen und hat einen neuen Schwerpunkt erhalten. Die Unterbrechung hatte ich selbst herbeigeführt, indem ich nach Norden nach Wisconsin umgezogen war, um mich als Verleger zu versuchen. Da Neils Beruf als Architekt ihn in Chicago festhielt, hatte er sich mit einem Plan abwechselnder Wochenendbesuche einverstanden erklärt. Unser ›Arrangement‹ hatte kaum eingesetzt, als der unerwartete Tod in der Familie Quatrain mich zum Testamentsvollstrecker eines riesigen Vermögens machte, das Quatro Press, Dumonts größtes Unternehmen, einschloss. Da ich jetzt im Aufsichtsrat von Quatro sitze, fiel es mir nicht schwer, Neil einen Vertrag über die Planung einer bedeutenden Erweiterung der Druckerei zuzuschanzen. Das Projekt hat ihn mehrere Monate lang durchgehend in Dumont beschäftigt und wir fühlen uns wieder als Paar und teilen allnächtlich das Bett. Und unsere Abende haben wieder eine Stunde, in der wir regelmäßig und voraussagbar das bescheidene Vergnügen der Cocktails zu Hause genießen.
Aber ›Zuhause‹ hat eine neue Bedeutung für uns. Unter unserem Dach lebt jetzt ein Sechzehnjähriger, und dieses Dach stellt nun auch sein Zuhause dar. Auch wenn Neil und ich immer noch unseren Drink vor dem Abendessen genießen, kann dies Thad unmöglich einschließen. Er ist natürlich zu jung, um mit uns zu bechern, und selbst wenn wir es erlauben würden, könnte er das Vergnügen, die Bedeutung und den Wert der Cocktailstunde nicht voll erfassen. Mit der Zeit wird er diese Dinge lernen. Aber so weit ist es noch nicht.
Der Schwerpunkt meiner Tage hat sich also von sieben Uhr abends auf sieben Uhr morgens verlagert. Das Frühstück – wer hätte das gedacht? – war zum zentralen Ereignis unseres gemeinsamen Familienlebens geworden. Wir wissen, dass es zu dieser Zeit keine anderen Aktivitäten gibt, die uns auseinanderreißen können. Wir können die Zeit nutzen, um Verbindung zu halten. Wir können reden.
»Wir brauchen Erdnussbutter«, sagte Thad, der mit dem Messer in dem fast leeren Glas stocherte und den letzten Rest der gelben Paste herausschabte, den er auf einem heißen Toast verteilte. Er trug einen dieser langen, ausgebeulten Pullover, die einen halben Meter über die Hüfte hängen.
»Steht auf dem Einkaufszettel«, sagte Neil, der von der Trendseite der Freitagsausgabe des Dumont Daily Register aufblickte. »Ich gehe morgen einkaufen.«
»Das ist ätzend.« Thad saß am Küchentisch zwischen Neil und mir – wir saßen uns an den Enden gegenüber. Wir waren für die Arbeit gekleidet, ich mit Krawatte, Neil in einem weichen, engen Rollkragenpullover, der seine breite Brust zur Geltung kommen ließ, die zu verbergen dumm gewesen wäre. Gegenüber von Thad war mit einer Serviette und einem leeren Becher ein vierter Platz eingedeckt, falls wie gewöhnlich Sheriff Pierce sich zu uns setzen sollte.
Trotz der wenig typischen Besetzung war es ein gemütlicher Kreis. Auch der Ort hatte etwas Atypisches. Das von meinem Onkel, dem Bruder meiner Mutter, erbaute Haus, war von einem Studenten von Frank Lloyd Wright in Taliesin entworfen worden. Es war im Prairie-School-Stil erbaut, der, obwohl eindeutig amerikanisch, in seiner reinsten Form nur selten anzutreffen ist. Die Küche war vor meinem Einzug renoviert worden, aber auf sorgfältige Weise in Wrights Stil, so dass kein Zweifel war, dass wir ein ›bedeutendes‹ Bauwerk bewohnten. Wände aus länglichen waagrechten Backsteinen trennten elegant Einbauschränke aus hellem Holz. In die Außenwand war eine Reihe hoher Fenster eingelassen, die den strahlenden Septemberhimmel in gleichmäßige Rechtecke aufteilte. Die Hintertür stand offen, damit die kühle Morgenbrise durch das Fliegengitter dringen und sich mit dem Duft des heißen Kaffees mischen konnte.
Thad mampfte seinen Toast und schluckte seine Milch hinunter. Ich schaute ihn über die Titelseite der Zeitung an. »Was ist ätzend?«, fragte ich ihn.
Thad warf Neil einen mitfühlenden Blick zu. »Einkaufen am Samstag.« Thad erschauerte beim Gedanken an den überfüllten Supermarkt und den verschwendeten Wochenendmorgen. »Hazel hat immer unter der Woche eingekauft.«
»Hazel sitzt irgendwo in Florida«, erinnerte ich ihn. Die Rede war von Hazel Healy, der langjährigen Haushälterin der Familie Quatrain mit dem unmöglichen Namen, die jetzt nicht mehr arbeitete. Wir waren noch alle damit beschäftigt, uns an unser neues Leben in der Prairie Street zu gewöhnen, und so hatten wir die Suche nach einer Haushaltshilfe aufgeschoben. Bei der Aussicht, jemand Fremdes in unser Heim zu lassen, war uns allen nicht wohl, obgleich wir uns der logistischen Vorteile, die sich aus der Anstellung einer Nachfolgerin von Hazel ergeben würden, durchaus bewusst waren.
»Das macht mir nichts aus«, sagte Neil in Anspielung auf das Einkaufen. »Wirklich.« Er war zu liebenswürdig – allein beim Gedanken daran, mit einem ratternden, verbeulten Einkaufswagen durch die vollgestopften Reihen zu zockeln, wurde mir flau.
Ich wechselte das Thema. »Na, wie fühlt man sich nach zwei Wochen als Oberstufler?«, fragte ich Thad. Er hatte gerade mit seinem vorletzten Jahr begonnen.
»Ganz okay. Die meisten der Kurse gefallen mir, nur Chemie ist ätzend.«
Neil, dem schmerzhafte Erinnerungen hochkamen, wimmerte. »Chemie war auch nie mein Ding. Ich hab mir immer eingeredet, dass es sowas wie Kochen wäre – dass die chemischen Gleichungen einfach ›Rezepte‹ wären – aber eines Tages im Labor wurde das Gebräu in meinem Tiegel durch einen Schuss Ammoniak so giftig, dass der gesamte Flügel der Schule evakuiert werden musste. Die Mixtur hatte Chlorgas produziert, ein ganz besonders giftiges Zeug.« Er stieß ein lahmes Lachen aus.
Thads Gelächter war herzlich. »Und was ist dann passiert?«
»Mein Studienberater sah endlich ein, dass Chemie für einen hoffnungsvollen Architekten keinen Wert hatte, und ich durfte direkt auf Physik umsteigen. Die Laborkurse waren dort bedeutend weniger gefährlich, aber Spaß gemacht hat es auch nicht.«
Thad dachte einen Moment nach. »Neil? Was hat dir eigentlich Spaß gemacht?«
Neil warf mir einen Blick zu. In der vorangegangenen Nacht hatten wir darüber gesprochen, welche Sorgen es uns machte, dass Thad in seinem Studium zwar ziemlich fleißig war, aber offenbar keine sonstigen Interessen hatte. Sport bedeutete ihm überhaupt nichts, trotz unserer behutsamen Bemühungen, ihn zum Laufen zu bewegen, was wir selber gerne tun. Mit Mädchen hatte er auch noch nichts am Hut, obwohl das nur eine Frage der Zeit war. Vereine und Bands oder sonst etwas reizten ihn einfach nicht. Und obwohl er nie darüber sprach, hatten wir den Verdacht, dass er heimlich immer noch um seine Mutter trauerte. Wir waren uns einig, dass es für Thad wichtig war, irgendetwas zu finden, sonst würde seine Langeweile zu Schwierigkeiten führen.
»Ich habe Querfeldeinläufe gemacht«, antwortete Neil. »Und an künstlerischen Projekten außerhalb des Unterrichts teilgenommen – Kulissenbau für Schulaufführungen. Bei ein oder zwei Stücken hab ich sogar mitgespielt.« Er hätte auch erwähnen können, dass er Vorsitzender des Komitees zur Dekoration seiner Abschlussfeier gewesen war, aber wohl gedacht, dass seine Erfahrungen mit Girlanden und Maschendraht auf Thad etwas zu tuckig wirken würden.
Thad verzog nachdenklich das Gesicht und wischte sich Erdnussbutter aus dem Mundwinkel. »Und du, Mark?«, fragte er mich, »Was hast du in der Schule gemacht -außer zu lernen, meine ich?«
Ich legte die Zeitung auf den Tisch und faltete sie zusammen. »Naja, ich bin gelaufen, querfeldein und Aschenbahn. Und ich habe am Jahrbuch und an der Schulzeitung mitgearbeitet.«
Thad nickte nachdenklich. Dann wandte er sich wieder an Neil. »In der Schule soll bald eine Aufführung stattfinden. Aber da muss man sich zuerst mit Schauspielen und so auskennen, oder?«
»Nein, sagten Neil und ich wie aus einem Mund und beugten uns zu dem Jungen hin.
»Irgendwo muss man ja mal anfangen und dazu ist die Schule da«, sagte Neil.
»Den Versuch ist es wert«, fügte ich hinzu. »Wann ist das Vorsprechen?«
»Was für ein Stück ist es?«, fragte Neil.
Thads Kopf ging bei den Fragen zwischen uns hin und her. »Ich weiß nicht genau«, sagte er mit einem halben Lachen. »Aber ich werd mich erkundigen.«
»Deine Englischlehrerin müsste Bescheid wissen«, schlug ich vor.
»Ich werd mich erkundigen«, wiederholte er, womit er andeutete, dass wir ihn nicht weiter drängen sollten, nicht heute. Er stand auf, ging zum Kühlschrank und goss sich noch ein Glas Milch ein. »Jemand noch Kaffee?«, fragte er, bevor er zurückkam.
»Klar«, antworteten wir. »Danke.«
Während Thad Neil Kaffee einschenkte, schaute er ihm über die Schulter auf die „Trendseite“, auf der wieder ein Artikel von Glee Savage stand. Mit DER KÖNIG IST EINGETROFFEN überschrieben, berichtete er von unserem Besuch bei Grace Lord am gestrigen Morgen, bei dem Glee und ich Carrol Cantrell, den König der Miniaturen kennen gelernt hatten. Beim Überfliegen der Story hätte Thad fast den Kaffee verschüttet. »Hoppla, tut mir Leid.« Er stellte die Kanne auf den Tisch. »Die Leute scheinen ja ‘n bisschen schräg drauf zu sein.«
Obwohl ich seine Einschätzung teilte, versuchte ich, diplomatisch zu sein. »Sagen wir mal, sie haben gewisse exzentrische Neigungen.« Ich grinste und griff nach dem Kaffee.
»Keineswegs«, sagte Neil und legte die Zeitung hin. Sein tadelnder Unterton verriet Erstaunen über meine Ansicht. »Die Kunst des Modellbaus hat eine illustre Geschichte, die seit langem mit meinem Metier verknüpft ist. Ich habe selbst verschiedene Modelle gebaut und habe den allerhöchsten Respekt vor den wahren Meistern dieses Handwerks.«
Neil stand auf, um weiterzusprechen – er war jetzt in Fahrt. »Denkt an die Thornezimmer im Art Institute von Chicago. Die Serie von achtundsechzig Schachtelzimmern wurde von Mrs. James Ward Thorne in Auftrag gegeben und von dem Meisterminiaturbauer Eugene Kupjack konstruiert, vor allem in den 30er Jahren. Sie stellen vier Jahrhunderte europäischer und amerikanischer Innenarchitektur dar – und das alles auf der Fläche eines abgedunkelten Korridors. Sie sind wunderbar.«
»Das ist richtig«, stimmte ich zu. Die Thornezimmer hatte ich vergessen, aber nun, da Neil sie erwähnte, erinnerte ich mich, wie sie ich als Kind bestaunt hatte. »Irgendwann demnächst«, sagte ich zu Thad, »können wir ja mal ein Wochenende in unserer Loft in Chicago verbringen. Dann nehmen wir dich mit ins Art Institute, und da kannst du dir die Thornezimmer selbst anschauen – die sind einen Besuch echt wert.«
»Cool.« Es hörte sich gelassen und nicht sonderlich begeistert an, aber wenigstens reagierte er nicht mit diesem genervt süffisanten Grinsen, das Jugendliche so draufhaben. Obgleich ich davon ausging, dass er sich für die Thornezimmer nur wenig interessierte, war mir klar, dass ihm ein Ausflug in die Stadt unter jedem Vorwand gefallen würde.
»Diese Schaustücke stellen den handwerklichen Höhepunkt dar«, erinnerte ich Neil. »Irgendwie hab ich so meine Zweifel, dass der Wettbewerb von Grace Lord da mitkommt.«
Er lachte, während er mit seinem Becher und dem Teller mit den Krümeln zur Spüle ging. »Sei dir da nicht so sicher. Wenn Carrol Cantrell und Bruno Hérisson beide dabei sind, liegt die Messlatte bedeutend höher.«
Mir fiel auf, dass Neil den Namen Hérisson fehlerfrei aussprach. »Hast du von den Kerlen etwa schon mal gehört?«
»Sie sind mir … ein ›Begriff‹.« Er schüttete den restlichen Kaffee in den Ausguss und öffnete den Geschirrspüler, um die Tasse und den Teller hineinzustellen. Thad trug sein eigenes Geschirr hin und stellte es dazu.
»Wo bleibt eigentlich Sheriff Pierce«, wunderte sich Thad. »Der hat doch die ganze Woche kein Frühstück verpasst.« Dann nahm er seinen Bücherstapel von der Anrichte. »Ich muss los – muss vor dem Unterricht noch mal die Hausaufgaben durchsehen.« Er drückte uns beiden die Schulter. »Ciao, Jungs. Bis heut Abend.«
Wir wünschten ihm einen guten Tag in der Schule und sahen zu, wie er durch den Hintereingang stürzte. Ich wollte Neil gerade sagen, dass ich anfing, mich an unsere neue, unkonventionelle Rolle als Eltern zu gewöhnen, als meine Gedanken von Thads Stimme unterbrochen wurden. »Morgen, Sheriff«, sagte er von der Auffahrt. »Sie werden schon erwartet.«
Kurz darauf klopfte Doug Pierce ans Fliegengitter. »Noch Kaffee übrig?«, fragte er beim Eintreten. Er bemerkte unser neugieriges Grinsen. »Bin einfach spät dran heute. Hatte nicht mal Zeit zum Training.«
Als er näher an den Küchentisch kam, stellte ich fest, dass er nicht einmal Zeit gehabt hatte, sich zu rasieren, was ihm ein ungepflegtes Aussehen verlieh, das überhaupt nicht sein Stil war. Und mehr noch, er trug das gleiche rostrote Tweedjacket, das ich am Tag zuvor gesehen hatte, und die Bügelfalten seiner grauen Flanellhose waren nicht mehr scharf. Das genügte, um in mir den Verdacht zu erwecken, dass er heute Nacht nicht nach Hause gekommen war. Allerdings war eindeutig alles in Ordnung – sein Schritt war ungewöhnlich elastisch, als er sich einen Stuhl nahm und sich neben mir hinsetzte. Er griff nach der leeren Tasse, die wir auf der anderen Seite des Tischs für ihn hingestellt hatten, und wiederholte seine Frage. »Noch Kaffee übrig?« Breites Grinsen.
Am liebsten hätte ich gefragt, Wo waren Sie denn letzte Nacht? Sie und Carrol Cantrell...? Aber es erschien mir nicht angebracht, ihn darauf anzusprechen, und außerdem ging es mich nichts an. »Sie haben Glück«, sagte ich zu ihm, hob die Kanne und goss ihm ein. »Wir wollten ihn gerade wegschütten.«
Neil, der meine Gedanken erriet, kam an den Tisch zurück. Auf eine saftige Story gefasst, hockte er sich auf einen Stuhl und beugte sich, auf die Ellbogen gestützt, neugierig vor.
Wenn Pierce ahnte, was wir dachten, ließ er es sich nicht anmerken. »Thad hat heute munterer gewirkt. Er scheint sich langsam an … alles zu gewöhnen.«
Mit ›alles‹ spielte Pierce nicht nur auf Thads Verlust der Mutter an, sondern auch auf sein neues Leben mit zwei schwulen Papas. »Wir lernen alle, damit zurechtzukommen«, erklärte ich Pierce. »Am Anfang hat sich Thad zwar schon gegen meine reine Existenz aufgelehnt, aber dann hat er schnell gemerkt, dass das Leben mit Onkel Mark und Onkel Neil dem Leben mit dieser bescheuerten ›Feministin‹ weit vorzuziehen ist.« Ich lachte trotz der üblen Auftritte, die ich mit Miriam Westerman gehabt hatte – diesem Drachen, dieser Schreckschraube, diesem ausgebrannten Hippieweib – der Gründerin des örtlichen (und einzigen) Zweigs der Feminist Society for the New Age of Cosmopolitical Holism oder unter ihren Gegnern auch FSNACH, zu denen zweifellos auch wir drei an diesem Morgen in der Küche Versammelten zählten.
»Miriam hatte nie die geringste Chance«, versicherte mir Pierce. Mit der einen Hand hob er die Tasse und schlürfte seinen Kaffee; mit der anderen wedelte er abschätzig zu Miriams vergeblichen Bemühungen, die Gerichte davon zu überzeugen, ihr das Sorgerecht für Thad zuzusprechen.
In der Anfangszeit der Society hatte Thads ledige Mutter, Suzanne Quatrain, mit Miriams militanter Feministenbewegung sympathisiert. Als Suzanne Mutter wurde, hatte Miriam das Baby als Gemeinschaftskind der Society beansprucht und ihn Ariel genannt. Das war Suzanne zu viel gewesen und sie hatte mit der Society gebrochen und Thad alleine aufgezogen – was bestimmt keine finanzielle Belastung für sie war, da sie Haupterbin der riesigen Druckerei Quatro Press geworden war. Dann, als Suzanne im letzten Jahr gestorben war, hatte Miriam ihre Bemühungen, Thad unter ihre Fuchtel zu bekommen, wieder aufgenommen und behauptet, ich sei nicht geeignet, ihn zu erziehen. Aber dann hatte doch die Vernunft gesiegt.
»Pass bloß auf«, warnte Neil mich scherzhaft. »Ms. Fem-Snach ist immer noch sauer.«
»Ich aber auch«, erinnerte ich ihn. Ich stand auf. »Möchten Sie einen Doughnut oder sonst etwas?«, fragte ich Pierce. Er nickte und ich ging zur Anrichte und suchte in den Schubladen nach etwas Gebäck, das Neil weggelegt hatte.
»Glücklicherweise«, nahm Pierce das Gespräch wieder auf, »hat Miriam zur Zeit alle Hände voll mit der Eröffnung ihrer neuen Schule zu tun – ich wundere mich, dass sie’s überhaupt geschafft hat. Die ist viel zu beschäftigt, um vergangenen Schlachten nachzuhängen, geschweige denn verlorenen.«
»Sie dürfen nicht vergessen« – ich wandte mich ihm zu – »dass sie nicht zu beschäftigt war, um ihrer alten Antipornoschlacht nachzuhängen. Die ist fähig und wirft Ihnen bei Ihrer Wiederwahl noch Knüppel zwischen die Beine.«
»Was soll das eigentlich?«, fragte Neil verwundert, bevor Pierce antworten konnte. »Die meisten Feministinnen sind liberal bis ins Mark. Was meckert die eigentlich herum?«
Pierce trommelte grinsend mit den Fingern. »Sie ist der Meinung, Pornografie sei ›Gewalt gegen Frauen‹. Ende des Arguments.«
»Leider«, fügte ich hinzu, »hat sie es geschafft, Harley Kaiser, unseren hochgeschätzten Bezirksstaatsanwalt, auf ihre Seite zu ziehen, und der hat ihr vor einer Weile geholfen, die Bezirksregierung dazu zu drängen, eine sogenannte ›Sittlichkeitssverordnung‹ zu erlassen. Jetzt will sie eine striktere Durchsetzung und hofft, dass ein paar Buchläden für Erwachsene – Pornoläden – am Stadtrand geschlossen werden.«
Neil blinzelte. »Aber ich habe Pornografie immer irgendwie ...genossen, so ab und zu ein Video«, sagte er naiv.
»Ganz schlecht«, sagte ich. »Miriam ist für die freie Wahl bis zum Anschlag, aber nicht, was deine Seh- oder Lesegewohnheiten betrifft.« Dann stellte ich einen Teller Gebäckstücke vor Pierce auf den Tisch. »Sind Sie nicht mit den Figuren auf die Schule gegangen?«
»Tja. Miriam und Harley und ich sind alle zusammen groß geworden; wir sind im gleichen Alter, fünfundvierzig. Miriam war schon immer Ideologin, nie zufrieden, wenn sie nicht an der Spitze eines Kreuzzugs stand, von da her ist ihre Antipornokampagne nicht verwunderlich. Miriam ist halt so. Aber Harley Kaiser ist eigentlich ganz anders. Er ist praktisch, intelligent, ein Politiker. Obwohl er Familie hat, ist er mir nie wie einer vorgekommen, der Spießerwerte hochhält. Er hat in Miriams Sittlichkeitskampagne einfach eine politische Goldader gerochen und ist auf den Zug aufgesprungen. Die sind schon ein komisches Gespann.«
»Seltsame Bettgenossen.« Ich hatte mich wieder an den Tisch gesetzt und lachte über das Bild, das meine Metapher heraufbeschworen hatte.
»Ich nehme an, Sie finden keinen Geschmack an dieser Zensurkampagne«, sagte Neil zu Pierce.
»Überhaupt keinen« – Pierce schüttelte fest den Kopf – »aber als der Polizeichef des County sind meine Freiheiten beschränkt. Wenn der Bezirksstaatsanwalt Beamte anfordert, um ›Beweise‹ – Pornovideos – zu sammeln, bin ich dafür zuständig. Harley hat in ein paar Fällen schon Anklage erhoben, aber er hatte nicht viel Glück damit, den Geschworenen klar zu machen, was genau ›unsittlich‹ eigentlich ist.«
»Aha«, warf ich ein, »der gesunde Menschenverstand des einfachen Mannes.«
»Genau. Aber jetzt bereitet sich Harley darauf vor, einen weiteren Fall vor Gericht zu bringen. Diesmal hat er seine Hausaufgaben wirklich gemacht und hat vor, eine Busladung von Sachverständigen anzukarren. Aus seiner Sicht ist es ein Fall, den er gar nicht verlieren kann. Das Geld für den Assistenzstaatsanwalt, der diese Fälle bearbeiten soll, geht langsam aus, und die Bezirksregierung verliert die Geduld. Wenn er nicht bald mal gewinnt, ziehen die die Notbremse – und Kaiser verliert Personal, Budget und sein politisches Ansehen.«
»Rox sagt, er ist ein Schleimer.« Neil meinte Roxanne Exner, eine Anwältin aus Chicago, die nach Dumont gekommen war, um mir bei der Angelegenheit mit dem Sorgerecht für Thad zu helfen. Sie war außerdem die Freundin, die Neil und mich vor drei Jahren miteinander bekannt gemacht hatte.
»Da hat sie Recht«, stimmte Pierce zu, »aber das habt ihr nicht von mir gehört. In nicht mal acht Wochen steht meine Wiederwahl an und Miriam fühlt sich schon durch meine schleppende Mitarbeit bei Harleys Pornorazzien verarscht. Und wenn ich mir ihn auch noch zum Feind mache, dann hab ich wirklich Ärger.«
Ich nickte. »Auftritt Deputy Dan.«
»Wer?«, fragte Neil.
»Dan Kerr«, erklärte Pierce. »Einer meiner Deputys, der sich einbildet, er hätte eine Beförderung verdient, und sich deshalb um meinen Job bewirbt. Da es eigentlich keine wirklich strittigen Themen gibt, macht er großes Aufhebens um die strengere Durchsetzung der Sittlichkeittsgesetze. Überflüssig zu sagen, dass Miriam fest hinter ihm steht – zu was auch immer das gut sein soll. Aber ich glaube, dass auch der Staatsanwalt auf Kerrs Seite ist. Wenn Harley ihn offen unterstützt, dann steht mir ein echt harter Kampf bevor.«
Ich streckte die Hand aus und klopfte Pierce beruhigend auf die Schulter. »Keine Angst. Ich habe keine Ahnung, ob Harley Kaiser tatsächlich jemanden unterstützen will, aber ich bin mir sicher, dass der Dumont Daily Register es tut. Und ich sag Ihnen eins: Deputy Dan ist nicht glaubwürdig.«
»Zugegeben.« Pierce nickte und schaute mir direkt in die Augen. »Aber Dr. Tenelli dafür umso mehr.«
Jetzt musste ich nachfragen. »Wer?«
»Dr. Benjamin Tenelli, der Vorsitzende der County Planungskommission, steht kurz davor, die Stellungnahme seiner Kommission zu der Sittlichkeitsfrage im Hinblick auf die ökonomischen Auswirkungen auf Dumont zu veröffentlichen.«
»Das ist ein neuer Gesichtspunkt«, gab ich zu. »Aber wer ist das?«
»Ein pensionierter Gynäkologe, er hat vierzig Jahre lang fast jedes Kind in dieser Stadt auf die Welt gebracht. Dr. Tenelli einen beliebten und angesehenen Bürger zu nennen, wäre eine Untertreibung. Er ist jetzt fast siebzig und widmet einen großen Teil seiner Zeit dem Dienst an der Öffentlichkeit.«
Während Pierce sich über den makellosen Ruf und die Menschenfreundlichkeit des guten Doktors ausließ, steckte ich die Hand in die Innentasche meines Blazers, der über der Stuhllehne hing. Namen – ich schien an diesem Morgen von Namen überschwemmt zu werden, und dass ich sie nicht kannte, erinnerte mich daran, dass ich immer noch ein Außenseiter in Dumont war. Obwohl ich inzwischen die Pflichten eines Herausgebers erfüllte, konnte ich nie meine Wurzeln als Reporter abschütteln und hatte stets zwei wesentliche Werkzeuge in Reichweite. Ich zog den Notizblock und den Füller aus der Jacke, schraubte den Montblanc auf und notierte mir ein paar wesentliche Fakten Dr. Tenelli betreffend.
»Er ist einer der wenigen Männer«, schloss Pierce, »die keinen Feind auf der Welt haben. Wenn er entscheidet, es sei gut für Dumont County, bei der Pornografie hart durchzugreifen – aus moralischen, wirtschaftlichen oder anderen Gründen –, können Sie drauf wetten, dass die Bürger denjenigen Kandidaten zum Sheriff wählen, der energisch – dagegen Stellung bezogen hat. Und an einem grauen Mittwochmorgen im November könnte Dan Kerr sich mit seinem Arsch hinter meinen Schreibtisch setzen.«
Er schwenkte seinen letzten Schluck Kaffee in der Tasse, brach ab und schaute auf die Uhr. »Apropos Schreibtisch, ich mach mich jetzt besser auf – ich komm jetzt schon zu spät.« Er stand auf.
Ich stand mit ihm auf. »Sollten Sie sich nicht vorher rasieren?«, frotzelte ich.
Er kratzte sich am Kinn. »Ich hab einen Rasierer im Büro.«
Neil erhob sich. »Noch einen ›Abschiedskaffee‹?«
»Nee.« Pierce ging zur Tür. »Danke, Jungs. Bis später.«
»Tschüss, Doug«, sagten wir. Und weg war er.
Neil räumte die letzten Reste vom Tisch, brachte sie zur Spüle und lud sie in den Geschirrspüler. »Ich muss auch los. Hab noch viel zu tun heute.«
Ich trat hinter ihn und schlang die Arme um seine Brust. »Jetzt haben wir einmal das Haus für uns. Keine Kinder, keine Cops –«
»Nichts zu machen«, unterbrach er mich und drehte sich lachend zu mir um. »Einfach keine Zeit. Außerdem sind wir schon beide geduscht und angezogen.«
»Du bist ja so praktisch«, bemerkte ich trocken.
»Ich dachte, deshalb hast du mich so attraktiv gefunden.«
»Das ist ein Bonus. Aber da gibt’s noch viel mehr.« Ich küsste ihn.
Es war ein ausgiebiger Kuss, länger als ein beiläufiger Schmatz, aber nicht lang genug, um als Vorspiel zu taugen. Manchmal denke ich, das sind meine glücklichsten Momente mit ihm, wenn wir die schlichte Intimität eines Kusses teilen. Ich liebe alles daran, alles an ihm – die Fülle seiner Lippen, die Glätte seiner Zähne an meiner Zunge, sogar den Geruch nach Kaffee in seinem Atem.
Sinn ergibt das keinen. Es liegt nichts Rationales darin.
Es muss etwas Pheromonales sein.
Am späteren Vormittag hatte die Betriebsamkeit in der Redaktion des Register im ersten Stock ihren wöchentlichen Höhepunkt erreicht. Redaktionsschluss war zwar erst abends, aber Freitage waren immer den ganzen Tag über hektisch, da die Wochenendartikel und die Sonntagsbeilage im Voraus unter Dach und Fach gebracht werden mussten. In früheren Zeiten wäre das Gequassel vom Klackern der Schreibmaschinen und vom Rattern der Fernschreiber übertönt worden, aber heutzutage werden die zum Druck bestimmten Worte natürlich mit einem leisen elektronischen Surren verarbeitet. Einige Dinge haben sich allerdings nicht geändert: Telefone bimmeln nach wie vor, Redakteure schreien sich immer noch über Tische hinweg an.
Glee Savage stürmte an den Glasscheiben des Vorzimmers meines Büros vorbei und fing meinen Blick auf, als ich vom Schreibtisch aufschaute. Da sie zwar einen breitkrempigen Hut trug, aber keine ihrer ausladenden Einkaufshandtaschen mit sich führte, wusste ich, dass sie das Haus nicht verlassen würde. Kurz darauf kam sie zurück – mit keinem Geringeren als Bruno Hérisson im Schlepptau. Groß und korpulent wie er war, keuchte er von der Anstrengung des Aufstiegs über die Treppe aus der Lobby im Erdgeschoss.
»Schauen Sie, wer da ist, Mark«, rief Glee vom Eingang aus in mein Büro.
Ich kam hinter dem Schreibtisch hervor, um Bruno im Vorzimmer zu begrüßen. Es war eigentlich für eine Sekretärin gedacht, aber anders als der frühere Herausgeber, Barret Logan, verließ ich mich einfach auf die Empfangsdame an der Hauptrezeption, so dass nun der gesparte Platz als Raum für spontane Konferenzen diente. Die Dekoration war geschmackvoll aber nicht ungewöhnlich, und ich fragte mich erneut, wie diese Räumlichkeiten wohl aussehen würden, wenn ich Neil mit seinen Talenten darauf loslassen würde – aber der hatte gerade andere Prioritäten. Neugierig, was der Anlass seines Besuchs wohl war, wandte ich meine Aufmerksamkeit Bruno zu und bat ihn und Glee, Platz zu nehmen. Ich schloss die Tür zur Redaktion und setzte mich zu ihnen.
Wir ließen uns auf den gepolsterten Stühlen an einem kleinen Tisch nieder. »Das ist ja ein unverhofftes Vergnügen, Mr. Hérisson«, sagte ich, wobei ich seinen Nachnamen falsch betonte, so dass er wie ›Harrison‹ herauskam. Liebenswürdig forderte er Glee und mich auf, ihn beim Vornamen zu nennen, eine bei Franzosen seltene Vertraulichkeit, die darauf hindeutete, dass er bereits beträchtliche Zeit in Amerika verbracht hatte. Wir revanchierten uns natürlich.
»Bruno hat vorhin angerufen«, berichtete mir Glee, »und gesagt, er müsse ›reden‹. Überflüssig zu sagen, dass meine Antennen sich aufstellten.« Dem Franzosen zugewandt, drückte sie auf ihren Kugelschreiber. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, halten wir zuerst ein paar Grunddaten fest. Ihr Name ist Hérisson mit dem scharfen Akzent auf dem E, richtig?«
»Accent aigu« – er zeichnete das Zeichen mit dem Finger in die Luft. »Richtig.«
»Und Ihr ständiger Wohnsitz ist Frankreich?«
»Ja, Paris.«
»Darf ich fragen, wie alt Sie sind?«
Er zierte sich ein bisschen und wickelte die Spitze seines goldenen Seidenschals um den Zeigefinger. »Ich bin achtundvierzig Jahre alt«, gestand er.
Glee schaute von ihrem Block auf, schob die Brille über die Nase und starrte ihn über den Rand hinweg an. »Mein Gott, Bruno, Sie gingen für achtunddreißig durch. Das bleibt unser kleines Geheimnis.« Sie zwinkerte ihm vertraulich zu – ein absoluter Profi.
Der Mann leuchtete bei ihrer Schmeichelei sichtlich auf. »Sie sind zu liebenswürdig.«
»Keineswegs.« Sie verlor keine Sekunde. »Verheiratet?«
Bruno räusperte sich. »Geschieden – meine Frau«, fügte er langsam sprechend hinzu, »meinte, meine Arbeit habe all meine Liebe aufgezehrt. Wir waren zwanzig Jahre zusammen, aber sie wollte ein neues Leben. Das konnte ich ihr nicht abschlagen, oder? Wir haben keine Kinder.« Er verstummte.
»Ich verstehe«, sagte Glee, ohne diese Einzelheiten zu notieren. Sie änderte die Richtung ihrer Fragen. »Wäre es zutreffend, Bruno, wenn ich meinen Lesern berichten würde, Sie seien der weltweit angesehenste Hersteller von Miniaturstilmöbeln?«
»Aber natürlich.« Es klang überhaupt nicht selbstgefällig; er sagte es völlig objektiv. Dann hob er einen Finger. »Um genau zu sein, chère Glee, könnten Sie mich einen angesehenen ›Kunsthandwerker‹ nennen. Mit diesem Begriff bezeichnet man häufig diejenigen unter uns, die Miniaturmöbel höchster Qualität herstellen.«
»Wunderbar. Danke sehr«, sagte sie und notierte sich die Feinheit.
»Und aus welchem Grund sind Sie zum Kongress der Midwest Miniatures Society gekommen – wollen Sie Ihre Stücke ausstellen oder sie verkaufen?«
»Beides. Ich werde auch Workshops leiten. Es gibt viele, die begierig sind, meine Methoden zu lernen, meine ›Tricks und Kniffe‹, wie Sie zu sagen pflegen.« Er schmunzelte.
Glee beugte sich vor und legte den Finger ans Kinn. »Ich habe keine Ahnung, Bruno, und bin neugierig: In welcher Preisspanne bewegen sich Ihre Möbel?«
»Ach« – er warf die Arme in die Luft – »das kommt darauf an. Das hängt davon ab, ob es sich bei dem Stück um einen einfachen Lehnstuhl oder einen komplizierten Zylindersekretär handelt, wobei beide auf Ihrer Handfläche Platz finden würden.«
»Was ist ein Zylindersekretär?«, fragte ich.
Glee wandte sich zu mir und erklärte es mir. »Das ist eine Art Schreibtisch mit Rollverschluss. Die bewegliche Lade aus Hartholz besteht dabei aus einem festen Zylinder anstatt aus einzelnen Latten.«
»Der Preis«, fuhr Bruno fort, »hängt des weiteren davon ab, wer das Stück verkauft, ob ich es bin … oder … oder Cantrell!« Seine Augen traten aus den Höhlen und er wurde unvermutet lebhaft, als er den Namen des Königs der Miniaturen aussprach.
»Zum Beispiel«, beharrte Glee. »Wie hoch wäre der Preis für einen Ihrer wundervollen Zylindersekretäre im Stil Louis Quinze?«
Bruno rechnete mit den Fingern Francs in Dollars um. »Dafür würde ich etwa sechstausend Dollar berechnen. Seine Majestät Cantrell hingegen würde zwölf –, vielleicht sogar bis zu fünfzehn dafür verlangen.«
»Tausend?«, fragte Glee, der der Stift aus der Hand fiel.
»Dollar?«, platzte ich heraus.
»So ist es«, sagte er gelassen und richtete sich in seinem Stuhl auf.
»Ich hatte ja keine Ahnung …«, murmelte Glee, während sie ihren Stift wieder aufhob und die Zahlen auf ihren Block kritzelte.
»Einen verdammt schönen großen Schreibtisch würde man für weit weniger Geld bekommen«, meinte ich scherzend.
»Ja«, räumte er ein, »aber das wäre dann keiner von meinen Sekretären.« Zack.
»Sind solche Gewinnspannen – hundert Prozent und mehr – typisch für Carrol Cantrells Einnahmen?«, fragte Glee.
»Immer.« Er rümpfte die Nase.
Mir lag ein Kommentar auf der Zunge: Gut für König Carrol – was immer der Markt hergibt. Aber diesen Gedanken behielt ich für mich.
»Cantrell«, fuhr Bruno fort, »kann selbst nicht die einfachste Miniatur … schachtel bauen, er ist nichts weiter als ein Händler, ein ›Mittelsmann‹. Seiner Arroganz kommt nur noch sein Mangel an Talent gleich, es sei denn natürlich, man betrachtet es als Talent, einfach die Arbeit anderer zu verkaufen. Er hat von meinen Bemühungen mehr profitiert als ich selbst. Seine Profite sind obszön!«
Ich fragte mich ironisch, ob obszöne Profite wohl auch unter die Obszönitätsverordnung von Dumont County fielen. Unser Schleimer von Bezirksstaatsanwalt konnte Schlagzeilen machen, wenn er beim Miniaturenkongress eine Razzia veranstalten und eine Gruppe in Fesseln gelegter Kunsthandwerker wegen obszöner Preise für Spielzeugschreibtische vor Gericht zerren würde. Während ich mich noch abmühte, einen witzigen Text für das Foto auf der Titelseite, die vor meinem geistigen Auge entstand, zu erfinden, verlieh Bruno seinen eigenen Schlussfolgerungen Ausdruck:
»Cantrell ist nicht der König der Miniaturen, oh nein! In Wirklichkeit ist er der regierende Schmarotzer unserer kostbaren kleinen Welt. Es ist an der Zeit, ihm die Maske vom Gesicht zu reißen« – er hieb mit der geballten Faust donnernd auf den Tisch – »und ihn zu stürzen!«
Glee und ich wechselten einen Blick und beherrschten uns. In tadelloser Haltung studierte sie ihre Notizen. »In welchem Sinn, Bruno, möchten Sie Ihren Rivalen ›stürzen‹?«, fragte sie.
»In professionellem Sinn natürlich.« Er lächelte, mit einem Mal ruhiger, als er erkannte, dass er seine Rolle überzogen hatte. »Ich beabsichtige, Cantrell zu bezwingen – und zwar in aller Öffentlichkeit.« Sein Lächeln wurde tückisch. »Und ich habe schon einen Plan«, knurrte er.
Glee gab ihm sein süffisantes Lächeln zurück und senkte die Stimme. »Möchten Sie uns Ihren Plan verraten?« Das Zucken ihres Stifts verriet, dass sie eine Bombenstory witterte. Sie beugte sich ihm entgegen und schürzte ihre roten Lippen.
Er lehnte sich ganz entspannt in seinem Stuhl zurück, da ihm bewusst war, dass er sie am Haken hatte. Er machte eine Kunstpause und zupfte am Knoten seines Seidenschals. »Ich hätte Sie nicht aufgesucht, chère Glee, wenn ich nicht ganz offen hätte sprechen wollen. Ich dachte mir, Sie würden einen – wie nennen sie es? – Knüller zu schätzen wissen.«
»Und wieso kommen Sie zu mir?«, schnurrte sie. Das Geräusch ihrer Stimme wurde vom Kratzen des Stifts untermalt. »Die Fachpresse wird jeden Moment in Dumont eintreffen. Ich bin sicher, der Nutshell Digest wäre begierig, Ihre Exklusivstory zu drucken.«
»Dessen bin ich gewiss.« Er lächelte. »Aber ich ziehe es vor, mit Ihnen zu sprechen.« Sein Tonfall deutete ein Interesse an Glee an, das nichts mit Journalismus zu tun hatte.
»Ich bin ganz Ohr, Bruno.« Ihr sinnlicher Ton glich seinem; falls sie ihn vortäuschte, waren schon miserablere Leistungen mit einem Oscar prämiert worden. Ich kam mir mit einem Mal wie ein Voyeur vor und war versucht, den Raum zu verlassen. Aber ich blieb – schließlich saßen wir in meinem Büro. Das Rascheln ihres Stifts brach ab, während sie abwartete.
Bruno räusperte sich. »Ich beabsichtige, die bevorstehende Eröffnung meines eigenen amerikanischen Workshops, Ausstellungsraums und Museums zu verkünden, der Petite Galerie Hérisson, die die Hall of Miniatures – König Carrols monopolistisches Unternehmen – an Größe und Vielfalt der Exponate in den Schatten stellen wird.«
Glee notierte eifrig mit. »Wo wird ihr Standort sein?«, fragte sie, obwohl wir beide die Antwort ahnten.
»In Los Angeles natürlich – keinen Block entfernt von Cantrell. Die Verhandlungen über die Liegenschaft stehen kurz vor dem Abschluss. Der Aufbau beginnt, wenn alle Dokumente unterzeichnet sind.«
Glees Ton war jetzt ganz geschäftsmäßig. »Sie erwähnten die ›Vielfalt der Exponate‹ in ihrem Ausstellungsraum. Könnten Sie da etwas genauer werden?«
»Die Galerie Hérisson wird zweifellos die exklusive Verkaufsstelle meiner eigenen Werke auf dem amerikanischen Markt sein – Cantrell wird keinen einzigen weiteren Sou aus dem Schweiß meiner Arbeit ziehen. In den Augen vieler würde allein das genügen, um meinem Ausstellungsraum die allerhöchste Reputation zu sichern. Aber es gibt noch mehr, viel mehr. Ich habe bereits Vereinbarungen mit vielen der weltweit angesehensten Kunsthandwerker abgeschlossen, die durch meine Petite Galerie vertreten sein werden. Cantrell wird seine renommiertesten Lieferanten verlieren.«
Glee und ich schauten uns wieder mit hochgezogenen Augenbrauen an. Uns war die brisante Situation, die sich hier in Dumont ergeben hatte, wohl bewusst. Da Glee vorübergehend sprachlos zu sein schien, stellte ich die nächste logische Frage. »Weiß Carrol Cantrell schon von Ihren Plänen?«
»Ich hatte die Absicht, sie gestern auf der Fahrt vom Flughafen mit ihm zu diskutieren«, erklärte Bruno leichthin. »Leider schien Seine Majestät es vorzuziehen, meine Fahrweise zu kritisieren.« Er lächelte, als ihm ein Gedanke kam. »Vielleicht ist es ja gar nicht nötig, dass ich das Thema anschneide – vielleicht liest er es ja in Ihrer Zeitung.«
»Es wäre wirklich besser, wenn er es von Ihnen erfahren würde«, schlug Glee vor. »Es ihm selbst zu sagen, wäre höflicher.«
»Ah, ja.« Er dachte darüber nach. »Politesse.«
In diesem Augenblick wurde das Gespräch von einem Klopfen an der Glasscheibe zur Redaktion unterbrochen. Vor der Tür stand Lucille Haring, die Chefredakteurin, habacht – das grelle Rot ihrer kurzgeschorenen Haare, das in so starkem Gegensatz zu ihrer unifarbenen Kleidung stand, einem von mehreren Kostümen, die sie immer trug, war unverkennbar. Ich winkte sie herein.
Als sie eintrat, stand Bruno auf und wartete darauf, vorgestellt zu werden. Ich stand ebenfalls auf, um die Formalitäten zu übernehmen. Diesmal sprach ich den Namen des Franzosen einigermaßen anständig aus und beschrieb kurz, wer er war. »Bruno«, sagte ich darauf, »das ist Lucille Haring, die Chefredakteurin des Register.« Er schien die Bezeichnung nicht recht verstanden zu haben. »Lucy hat hier nach mir das Sagen.« Er quittierte es mit einem verstehenden Lächeln.
Ich war der einzige lebende Mensch, der sie mit Lucy ansprach, was ihr nichts auszumachen schien. Trotzdem nannte sie sonst, mit Ausnahme einiger älterer Redaktionsveteranen, die einfach Haring sagten, jeder Lucille oder Miss Haring. Grund für diese Namensspiele, für die Zurückhaltung meiner Mannschaft, mit ihr warm zu werden, war die Tatsache, dass sie die steifste Frau war, die je eine Story zu Papier gebracht hatte.
»Enchanté«, sagte Bruno mit einem Kopfnicken. An seinem Ausdruck konnte ich erkennen, dass er versuchte, sie einzuschätzen, vielleicht ihr Alter zu erraten. Sie trug kein Make-up, was es noch schwerer machte. Als ihr Arbeitgeber kannte ich ihre Akte und erinnerte mich, dass sie etwas über dreißig war, aber Genaueres ließ sich nur vermuten.
»Ganz meinerseits«, antwortete Lucy, ohne mit der Wimper zu zucken, streckte die Hand aus und pumpte seine einmal kurz und kräftig. Sie hätte auch die Hacken zusammenknallen können.
Bruno schien ihre militärischen Art einzuschüchtern, ich hatte jedoch gelernt, nicht weiter darauf zu achten. Ich hatte sie vor etwa fünfzehn Monaten kennen gelernt, als ich an der größten Story meiner Laufbahn beim Chicago Journal gearbeitet hatte. Getreu ihrem Auftreten hatte sie tatsächlich Beziehungen zum Pentagon und war von einem Armyspezi unseres geschätzten Herausgebers damit beauftragt worden, ein großes Upgrade der Computer bei JournalCorp zu leiten. Sie hatte sich als eine wichtige Verbündete erwiesen, als ich damals im Sommer meine Story hatte herausbringen wollen, und dabei ein Talent für einwandfreie Recherchen und eine angeborene Witterung für Nachrichten gezeigt. Als ich dann als Herausgeber des Register nach Dumont umgezogen war, hatte sie sich überraschend um den Posten des Chefredakteurs beworben. Nach anfänglichem Zögern (ich wollte die Mannschaft des Register nicht vor den Kopf stoßen, und ihre Mängel beim ›Umgang mit Menschen‹ waren zumindest bedenklich) hatten die Umstände mich davon überzeugt, dass sie tatsächlich die richtige Person für den Job war. Ich habe meine Entscheidung nicht ein einziges Mal bereut.
»Tut mir Leid, zu stören«, sagte sie. »Mark, da ist etwas im Busch. Ich dachte, das würde Sie interessieren.« Sie blieb stehen und schaute sich mit ruckartigen Kopfbewegungen um, als ob sie mit mir allein sein wollte.
Bruno entzifferte dieses Signal mühelos. »Ich muss mich auf den Weg machen, liebe Freunde. Ich bin übrigens fertig – von meinen Plänen habe ich Ihnen berichtet.«
Glee, deren Interview ein abruptes Ende gefunden hatte, stand auf und klappte ihren Notizblock zu. »Kann ich Sie in Ihrem Motel erreichen, falls ich noch ein paar Zitate für meinen Artikel brauche?«, fragte sie Bruno.
»Aber natürlich, chère Glee.« Er ging zur Tür und nickte uns zum Abschied zu. Dann fiel ihm etwas ein und er blieb stehen. »Am Wochenende allerdings werde ich nach Milwaukee fahren – in der Angelegenheit, die wir besprochen haben. Aber am Montag können Sie mich erreichen.« Und damit verließ er das Büro, um den Rückweg durch die Redaktion anzutreten.
»Gute Reise, Bruno«, rief Glee ihm von der Tür aus winkend nach. »Viel Glück.«
»Der braucht alles Glück, das er kriegen kann«, murmelte ich. Angesichts seiner Fahrkünste, deren Zeuge ich am gestrigen Morgen vor Grace Lords Haus geworden war, hätte ich nicht auf der gleichen Straße fahren mögen.
»Durchaus ein Charakter«, kommentierte Glee.
Bei dieser Untertreibung musste ich lachen.
»Aber hat er auch Nachrichtenwert?«, fragte Lucy sich laut.
»Unbedingt«, antwortete Glee mit gespielter Ernsthaftigkeit. »Er und Carrol Cantrell sind die beiden bedeutendsten Figuren innerhalb der kleinen Welt der Miniaturen. Wenigstens wenn man den Experten vom Nutshell Digest glauben darf.«
Lucy schaute Glee an, als hätte diese einen Witz gemacht.
Aus den Papieren, die sie unter ihren Notizen hatte, zog Glee eine Nummer der besagten Zeitschrift heraus und zeigte uns die Titelseite. Die Schlagzeile unter dem Impressum des Nutshell Digest lautete: VORSCHAU DUMONT: KONGRESS DER MIDWEST MINIATURES SOCIETY. Lucys Mundwinkel verzogen sich zur Andeutung eines Lächelns. »Der Name passt«, knurrte sie. Der Kommentar kam trocken, aber von Lucy kommend bedeutete er das gleiche, als habe sie sich auf die Schenkel geschlagen.
Beim Zuschauen fiel mir auf, wie überaus unterschiedlich die beiden Frauen waren. Glee Savage: zweiundfünfzig, immer noch mannstoll, super gekleidet, scharfzüngig, Kulturredakteurin (›weiche‹ Nachrichten). Lucille Haring: etwa zwanzig Jahre jünger, kein Interesse an Männern (lesbisch, genauer gesagt, aber meines Wissens kein Sexualleben), eher schweigsam, Chefredakteurin (harte, knallharte Nachrichten). In vieler Hinsicht waren sie polare Gegensätze, und dennoch war ihre Arbeitsbeziehung freundschaftlich und herzlich, da sie die Fähigkeiten der anderen respektierten und gegenseitig ihren Erfolg in einem Beruf, der früher von Männern beherrscht wurde, bewunderten.
Glee setzte das Gespräch über den Nutshell Digest fort und blätterte auf eine Seite, die sie eingeknickt hatte. »Die Titelgeschichte berichtet eingehend über die Unstimmigkeiten zwischen Carrol und Bruno. Offenbar ist es ihnen jahrelang gelungen, sich aus dem Weg zu gehen, obwohl ihr Erfolg jeweils von dem anderen abhing. Der Artikel schließt mit einer unbeantworteten Frage: ›Wird es im kommenden September, wenn die Wege dieser feindlichen Titanen sich kreuzen, zu einem Feuerwerk kommen?‹«
»Sturm im Wasserglas«, sagte Lucy abschätzig und wandte sich an mich. »Bei der Planungskommission des County braut sich eine wirkliche Kontroverse zusammen, und die könnte sehr gut in einem Feuerwerk enden.«
Das machte mich neugierig. Ich hatte so eine Ahnung, dass ich gleich zum zweiten Mal an diesem Morgen etwas über Dr. Benjamin Tenelli zu hören bekommen würde. »Geht es um den Pornobericht?«, fragte ich meine Redakteurin.
»Gerade rausgekommen. Der Kommissionsbericht, erstellt von einem Dr. Tenelli, kommt zu dem Schluss, dass die Erotikbuchläden am Stadtrand die wirtschaftliche Entwicklung entlang des Highways behindern. Darüber hinaus«, schnaubte sie, »wird behauptet, dass die Pornoläden ›die Touristen abschrecken‹.«
»Ich Dummerle«, zwitscherte Glee, »ich dachte immer, es läge an den brutalen Wintern.«
»Ganz zu schweigen von Dumonts Mangel an Casinos und Einkaufszentren«, fügte ich hinzu.
»Der Bericht gibt keine spezifischen Empfehlungen hinsichtlich der Durchsetzung der Sittlichkeitsverordnung, aber die Botschaft ist klar: Dumont County wäre mit einem Vorgehen gegen den Schund gut gedient«, sagte Lucy.
Ich dachte einen Moment lang nach. »Steht der Leitartikel für morgen schon?«
»Nicht, wenn Sie sagen, dass nicht«, erinnerte mich Lucy.
Ich machte eine erneute Pause. »Ladies, wenn Sie mich entschuldigen wollen. Ich muss noch etwas Schreibarbeit erledigen.«
Während sie mein Sekretariat verließen, zog ich mich hinter meinen Schreibtisch zurück.