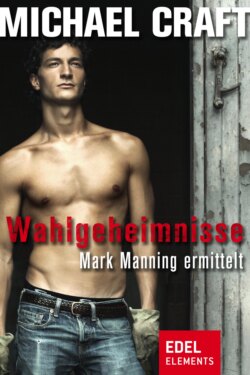Читать книгу Wahlgeheimnisse - Michael Craft - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Samstag, 16. September
ОглавлениеNamen zu nennen, ist Teil meines Berufs. Während meiner Laufbahn als Reporter lernte ich schnell, dass der Name im ersten Satz der entscheidendste Teil des Artikel ist: Wer war es? Als Herausgeber meiner eigenen Zeitung leite ich die Berichterstattung meiner Leute, mein eigenes Schreiben beschränkt sich jedoch im allgemeinen auf den gelegentlichen Leitartikel. Wenn in Dumont ein Artikel unter meinem Namen erscheint, wissen die Leser, dass meine Worte nicht nur objektive Fakten wiedergeben. Vielmehr bewege ich mich inzwischen kühn auf dem Gebiet der Meinungsbildung – und ich nenne immer noch Namen.
Als Herausgeber halte ich die Unterstützung von Kandidaten bei Wahlen für eine meiner verantwortungsvollsten Aufgaben. Ich gehe damit auch die größten Risiken ein. Selbst in einer eher kleineren Stadt wie Dumont, wo nicht allzu viel auf dem Spiel steht, bilden die Wahlen zu den öffentlichen Ämtern den Pulsschlag der Demokratie; für die meisten Menschen beginnt und endet die Teilhabe an der Regierung in der Wahlkabine. Und bei Kommunalwahlen fühlen die Wähler, ob wirklich oder eingebildet, am ehesten eine Bindung zu den Namen auf dem Wahlzettel. Wenn ich also meinen Leser nahelege, so oder so zu wählen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Hälfte von ihnen sauer ist.
»Wieso so früh?«, fragte Neil beim Frühstück an diesem Samstag. Er legte die Zeitung mit dem Leitartikel nach oben auf den Küchentisch. »Ich bin auch für Doug, aber die Wahl ist erst in gut zwei Monaten. Taktisch gesehen« – er tippte mit dem Finger auf meinen Artikel – »hätte das im November mehr Wirkung.«
Er hatte einen wichtigen Punkt aufgegriffen. »Dem Bericht der Planungskommission«, erklärte ich, während ich an der Anrichte stand und darauf wartete, dass der Toast aus dem Toaster hüpfte, »musste rasch widersprochen werden, da habe ich beschlossen meine Empfehlung für Doug vorzuziehen, da der Wahlkampf sich jetzt auf die Pornosache konzentrieren könnte. Doug verdient, wiedergewählt zu werden, und alle wissen das – warum sollte man also die Öffentlichkeit durch eine Zensurkampagne durcheinanderbringen lassen?«
Neil zog eine Augenbraue hoch. »Zensur?«
Der Toast sprang heraus. »Bei genauer Analyse geht es bei dieser Pornoschlacht um nichts anderes. Egal, mit welch hochtrabenden Argumenten sie gerechtfertigt wird – ob mit öffentlichem Anstand oder aus wirtschaftlichen Gründen – letztlich soll die Staatsmacht dazu benutzt werden, Erwachsenen den Zugang zu Materialien zu verwehren, die als anstößig betrachtet werden. Also für mich ist das Zensur.« Ich schmierte so heftig Butter auf den Toast, dass er zerbröselte und meine Handfläche mir fettigen Krümeln beschmiert war. Obwohl ich mich das Thema und die kleine Sauerei aufregten, musste ich lachen.
»Lass mich«, erbot sich Neil, kam zur Anrichte und nahm mir das Messer aus der sauberen Hand. Er machte sich an die Arbeit, den Toast zu buttern und die Scheiben mit architektonischer Präzision auf einem Teller aufzuschichten. Da keiner von uns beiden an diesem Morgen zur Arbeit hetzen musste, hatten wir uns noch nicht angezogen. In Bademänteln standen wir vor der Anrichte, Flanell wegen des Herbstes. Ich war barfuß, aber Neil trug dicke, graue Wollsocken – er hatte in weiser Voraussicht erkannt, dass der gekachelte Fußboden kalt sein würde.
»Du hast natürlich Recht«, sagte er, immer noch butternd (es war eine Menge Toast, genug für Thad und Sheriff Pierce, falls sie dazustoßen sollten). »Jeder Versuch ›akzeptables‹ Lese-oder Bildmaterial festzulegen ist Zensur, schlicht und einfach.«
Ich wusch mir die Hände an der Spüle und trocknete sie mit einem Handtuch ab. »Jetzt nimm’s nicht zu persönlich«, frotzelte ich.
»Und was soll das jetzt heißen?«
»Das heißt«, erinnerte ich ihn, »dass du schon immer einen Geschmack für Schmutz und Schund hattest.«
»Das streite ich ab.« Seine Entrüstung war nicht echt. »Ich hatte schon immer einen erlesenen Geschmack für Schmutz und Schund.« Obwohl seine Worte sich anscheinend widersprachen, trafen sie genau die Tatsachen. Schon lange bevor ich Neil kennen lernte, hatte er damit begonnen, eine beachtliche Sammlung von Videos anzulegen – genauer gesagt, schwuler Pornovideos. Seltsamerweise war sein Interesse an solchem Material indessen stets mehr akademisch als lüstern gewesen und seine Lieblingsvideos ließen sich eher als intellektuell den als verrucht und versaut beschreiben. Seine Sammlung war in der Loft in Chicago zurückgeblieben; wir waren uns darüber einig, dass wir mit dem Feuer spielten, wenn wir sie in Dumont aufbewahrten, wo ein neugieriger Sechzehnjähriger sie in die Finger bekommen könnte.
Ich brachte das Gespräch wieder auf das Wahlkampfthema. »Ich hoffe nur, dass der Kommissionsbericht nicht so viel öffentliches Aufsehen erregt, dass er Dougs Chancen beeinträchtigen könnte. Dieser Tenelli hat offenbar ziemlichen Einfluss.« Der Kaffee war fertig und ich brachte die Kanne zum Tisch.
Neil folgte mir mit seiner kunstvollen Pyramide gebutterter, golden schimmernder Toasts. »Ich bezweifle, dass Doug sich ernsthafte Sorgen machen muss – die Empfehlung durch den Register müsste die Sache für ihn klar machen.«
»Sei dir da nicht so sicher.« Ich setzte mich. »Empfehlungen können nach hinten losgehen, besonders in Kleinstädten, wo alle nur darauf zu warten scheinen, dem ›örtlichen Klünge‹ eins überzubraten.«
Neil setzte sich neben mich. »Bist du jetzt zynisch?« Er lächelte. »Oder bist du dir nur nicht sicher.«
»Von beidem ein bisschen«, gab ich zu, lächelte zurück und ermahnte mich, mich zu entspannen. Schließlich war es Samstag und noch viel zu früh, um sich über ›Themen‹ aufzuregen. Der frühe Herbstmorgen war eine herrliche Gelegenheit, unsere Zweisamkeit zu genießen. Im letzten Jahr hatten wir nur sehr wenige dieser kostbaren stillen Stunden gehabt.
Ich brach also ab und legte meine Hand auf die von Neil. »Ich bin froh, dass du hier bist – dass du hier in Dumont an dem Quatroprojekt arbeitest, meine ich. Es ist, als würden wir wieder zusammenwohnen.«
»Tun wir auch – wenigstens für ein paar Monate. Und dann kommt wieder das alte ›Arrangement‹«. Damit spielte er auf die abwechselnden Wochenenden in Dumont und Chicago an, die lange Stunden auf der Straße erforderten. Da der Gedanke an die bevorstehende Trennung nicht angenehm war, redete Neil wieder von der Gegenwart. »Ich muss mir wirklich ein Arbeitszimmer hier einrichten. Ich arbeite jetzt die ganze Woche in einem freigemachten Büro bei Quatro, was in Ordnung ist, aber ich komme mir vor wie ein Eindringling. Ich brauche eine ›Basis‹ außerhalb der Firma.«
»Nimm doch eins von den freien Zimmern«, schlug ich vor. Das Haus bot viel Platz. »Oder miete dir irgendwo ein Büro.« In der Innenstadt gab es jede Menge leerstehender Läden; der Einzelhandel in Dumont war, wie überall, der wachsenden Bevölkerung in die Außenbezirke der Stadt gefolgt.
»Ein Büro?« Er schien sich zu wundern, dass ich das vorgeschlagen hatte, und ich wusste, dass ich sein Interesse geweckt hatte. Dann runzelte er die Stirn und verwarf die Idee. »Da lege ich mich zu fest. Ich brauche nur einen Platz für einen Schreibtisch, einen Zeichentisch und meinen Computer.«
Ich zuckte die Achseln. »Ich bin sicher, du könntest irgendwo einen kurzfristigen Mietvertrag bekommen.« Ich tat natürlich nur so. Wenn wir ein Büro für ihn einrichteten, würde er sich vielleicht an den Gedanken gewöhnen, seine Arbeit nach Dumont zu verlegen. Er könnte bei seiner Firma in Chicago kündigen und sich hier etwas eigenes aufbauen. Das würde jedoch heißen, dass er auf die Anerkennungen und die angenehm steile Karriere in der großen Stadt verzichtete, was er sicher nicht gerne tun würde. Darüber hinaus würde seine Arbeit hier anfangs nur langsam anlaufen. Das war immer noch kein Risiko – ich hätte ihn mühelos unterstützen und ihn mit Kapital für sein Geschäft versorgen können. Aber das wagte ich gar nicht auszusprechen. Meine Motive waren ungeschminkt egoistisch und ich wusste, dass er jedes Angebot finanzieller Unterstützung als demütigend ansehen würde. Von Anfang an hatten wir unsere Beziehung als ebenbürtige Partner geführt. Obwohl mein Vermögen größer war als seines, schließlich war ich acht Jahre älter als er, hatte ich nie die Rolle des Chefs oder Versorgers gespielt. Und das hatte ich auch nie gewollt.
»Vielleicht ginge es ja in einem der Zimmer«, dachte er laut nach. »Obwohl das nicht sehr professionell wirkt.«
»Darüber brauchen wir uns ja nicht jetzt den Kopf zu zerbrechen«, sagte ich und schenkte uns Kaffee ein. »Lass uns einfach ein gemütliches Wochenende genießen.«
Er grinste. »Du hast leicht reden. Ich muss mich für die Schlacht im Supermarkt rüsten. Die Erdnussbutter ist ausgegangen, weißt du noch?«
»Thad verputzt das Zeug auch wirklich rasend schnell«, bemerkte ich unschuldig.
Neil schaute mich entgeistert an. »Du selber hast aber auch ‘ne ganze Menge abgestaubt.«
Dagegen konnte ich nicht an. Für Erdnussbutter hatte ich schon als Kind eine Schwäche gehabt. Ich wechselte das Thema. »Vielleicht hatte Miriam Westerman ja doch Recht – wir sind wirklich Rabeneltern, der Kleine muss sich ganz alleine um sein Frühstück kümmern. Eigentlich sollten wir ihm Eier und so Sachen braten.«
Neil lachte. »Die findet er eklig – Gott sei Dank.«
Tatsächlich hatten wir in der ersten Zeit unter dem gleichen Dach mit Thad das alles durchgemacht und versucht, Frühstück für ihn zu ›kochen‹, aber das war ihm einfach egal, er aß alles, was auf den Tisch kam, Milch oder Saft, Toast oder Müsli. An einem Wochenende im letzten Winter hatte Neil unsere Auswahl an Schachteln und Flaschen gemustert, die unser Morgenmahl darstellten, und bemerkt, dass wir das feinste kontinentale Frühstück der Stadt servierten. Thad fand das cool, und ein paar Monate später hörte ich zufällig ein Gespräch mit, das er eines Tages nach der Schule mit einem Freund in der Küche führte. Der andere Junge gab mit den Kochkünsten seiner Mutter an und behauptete, ihre Eier Benedict seien so gut wie Egg McMuffins. »Wir bevorzugen ein kontinentales Frühstück«, hatte Thad ihm, ohne mit der Wimper zu zucken, geantwortet.
Neil schaute über die Schulter zur Wanduhr – es war gut über acht. »Wo wir gerade von dem Lümmel reden – noch kein Lebenszeichen?«
»Das liegt an seinem Alter – der schläft bis Mittag, wenn man ihn lässt.«
»Dann lassen wir ihn.« Neil wischte sich mit der Serviette Butter von den Lippen.
Ich goss ihm Kaffee nach. »Hat Thad irgendwas über die Schulaufführung gesagt?«
Neil schüttelte den Kopf und nahm einen Schluck aus seinem Becher. »Wir haben gestern Abend eigentlich kaum miteinander geredet. Du warst noch bei der Zeitung und er war auf dem Weg zu Freunden. Wir haben das Essen einfach runtergeschlungen. Ich nehme an, er hat mit seiner Lehrerin gesprochen – bis jetzt nichts Neues.« Neil schob seinen Stuhl ein Stück vom Tisch weg und lehnte sich zurück. Den immer noch hoch aufgetürmten Teller mit den Toasts schob er ans andere Tischende. »Dass Thad bis in die Puppen schläft wundert mich ja nicht, aber ich war mir sicher, dass wir Doug heute Morgen sehen würden, besonders nach deiner Empfehlung.«
»Schätze, er hat sie noch gar nicht gesehen.»
Aber Neil hatte Recht – natürlich hatte ich erwartet, dass Pierce schon in aller Frühe die Verandastufen hochstürmen würde, um sich bei mir zu bedanken. Er hatte keine Ahnung gehabt, dass der Leitartikel so früh erscheinen würde, und von unseren zahlreichen früheren Frühstücken wusste ich, dass er nach dem Aufstehen als erstes in die Zeitung zu schauen pflegte. Wo also steckte er?
Neils Gesicht leuchtete auf, als ihm ein Gedanke kam. Er stand auf, trat hinter mich und griff nach meinen Schultern, um mir mit den Daumen den Nacken zu massieren. »Wo wir schon mal ›unter uns‹ sind, wie wär’s mit einem kleinen Lauf? Das Wetter ist ideal und wir haben’s schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht.«
»Tolle Idee«, sagte ich und drehte den Kopf zu ihm um. In Erinnerung an die erotische Rolle, die das Laufen in unserer Beziehung gespielt hatte, lächelten wir uns an. Vor etwa drei Jahren, an einem Weihnachtsmorgen in Phoenix waren Neil und ich zusammen über eine Bergstraße gelaufen, unmittelbar bevor wir zum ersten Mal miteinander geschlafen hatten. Jedesmal seitdem hatten unsere Läufe die Magie eines intimen Rituals angenommen, das häufig als Einstimmung zum Sex diente – ganz im Gewand der Körperertüchtigung. Ach ja, die Freuden einer gesunden Lebensweise. Sitzend, während Neil neben mir stand, griff ich unter seinen Bademantel und streichelte sein Bein. An den straffen Muskeln seiner Wade arbeitete ich mich bis zum Oberschenkel hoch. Ich weiß nicht, ob Neil auf die Berührung reagierte oder auf die erregende gemeinsame Erinnerung, aber er fing an, schwer zu atmen, während die ersten Stadien einer Erektion den Flanell seines Bademantels an meine Schultern hoben. Ich legte den Kopf zurück, um seine Wärme am Ohr zu spüren. Dann beugte er sich über mein Gesicht und küsste mich leidenschaftlich. Mit der freien Hand schob ich meinen Bademantel beiseite, um mich meiner eigenen Erektion zu widmen. Durch die Schlitze meiner Augen sah ich die Stoppeln an seiner unrasierten Kehle, vor meinem geistigen Auge sah ich das unauslöschliche Bild der von Schweiß dunklen Spalte seiner verblichenen grauen Laufshorts von damals, als er mir auf dem Berg vorangelaufen war. Ich hörte die abgelaufenen Sohlen unserer Schuhe, die im Einklang auf den Boden unter unseren Füßen knirschten.
Ein Klopfen an der Tür. Douglas Pierce – Sheriff des ganzen Landes – betrat soeben die Küche. Wäre er eine halbe Minute später gekommen, hätte er wahrscheinlich zwei Männer in den Klauen der Lust erwischt (was ihm womöglich gefallen hätte). Auch so hatten Neil und ich kaum Zeit, uns voneinander zu lösen und verlegen unsere Erregung in den Falten der Bademäntel zu verbergen.
»Hey, Jungs. Toller Tag heute«, sagte Sheriff Pierce, während er mit federnden Schritten zum Tisch trat und eine Tüte Muffins ablieferte, die er offenbar auf dem Weg zu uns besorgt hatte. Falls wir den schuldbewussten Anblick der auf frischer Tat Ertappten boten, bemerkte Pierce, der auf nichts anderes achtete als auf das schöne Wetter, es nicht. Seine gute Laune – sein ›Leuchten‹, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks – war das Ergebnis, wie ich annahm, meiner unerwarteten Unterstützung in der Morgenzeitung.
Wir grüßten ihn, amüsiert über sein Strahlen, und freuten uns trotz seiner Ankunft im falschen Moment über seine Gesellschaft. Neil holte noch einen Becher aus dem Küchenschrank, um dann zu Pierce und mir an den Tisch zu kommen und uns allen Kaffee einzuschenken. Die Muffins waren frisch und rochen wunderbar. Aus dem Teig ragten Hügel feuchter Heidelbeeren, so dass wir beide einen nahmen – scheiß auf den Toast.
Neil, der das Geschirr umdeckte, um unseren Gast unterzubringen, achtete darauf, dass Pierce alles in Reichweite hatte, einschließlich der gefalteten Zeitung, die er quer über den Teller des Sheriffs legte. Wir warteten darauf, dass er einen Kommentar zu der vor ihm ausgebreiteten Wahlempfehlung abgeben würde, aber er schien sie gar nicht zu bemerken, und ich war mir sicher, dass er verlegen war.
»Und ...?«, fragte ich ihn schließlich strahlend.
Er schaute mich an, dann Neil und dann wieder mich. »Was, und?«, fragte er. Sein ratloser Ausdruck verriet mir, dass er nicht verlegen war – er hatte keine Ahnung.
»Doug«, sagte ich und tippte auf den Leitartikel vor ihm, »haben Sie meinen Artikel nicht gesehen?«
»Nein« – er lachte – »hab ich nicht« – er brach ab und las die Überschrift. Er nahm die Zeitung auf und brach in ein breites Grinsen aus, während er sich in den Stuhl zurückfallen ließ, um meine Stellungnahme für ihn zu überfliegen.
Als ich ihm beim Lesen so zuschaute, fragte ich mich, weshalb er wohl früher am Morgen die Seite mit dem Leitartikel übersehen haben konnte – öffentliche Bedienstete schlugen sie mit angehaltenem Atem unweigerlich als erste auf, um zu sehen, ob irgendetwas über sie gebracht wurde. Pierce hatte die Zeitung an diesem Tag eindeutig noch nicht gesehen. Dann fielen mir seine Kleider auf. Obwohl es Samstag war, trug er einen Sportmantel, Anzughosen und ein Button-Down-Hemd wie auf der Arbeit, aber keine Krawatte. Obwohl der Hemdkragen offenstand, verrieten kleine Knitterfalten am obersten Knopf, dass das Hemd schon zuvor, vermutlich gestern, getragen worden war, und zwar mit Krawatte. An seinem Hals konnte ich sehen, dass die tägliche Rasur schon wieder überfällig war. Seine muntere Laune, seine getragenen Kleider, die Tatsache, dass er die Wahlempfehlung nicht gelesen hatte – alles passte zusammen. Ich wollte nicht spekulieren, wo er über Nacht gewesen war, aber es war klar, dass er heute nicht zu Hause aufgewacht war.
»Mark«, sagte er und senkte die Zeitung, »wie kann ich Ihnen danken?«
»Indem Sie Deputy Dan schlagen und wiedergewählt werden.« Ich hob meinen Kaffee und stieß mit ihm an, worauf Neil das gleiche machte – eine dumme Geste vielleicht, aber sie schien mir angebracht.
Pierce wurde nachdenklich. »Ich schätze, diese Wahlempfehlung ist eine Reaktion auf den Bericht der County Planungskommission?«
Ich nickte. »Deshalb habe ich sie jetzt gebracht, aber Sie brauchen keine Minute daran zu zweifeln, dass der Register hinter Ihnen steht, jederzeit.«
Neil zerkrümelte seinen Muffin auf dem Teller und pickte die Beeren heraus, die er sich in den Mund schnippte; seine Fingerspitzen waren tintenblau. »Glauben Sie, dass Dr. Tenelli irgendwelche politischen Ambitionen hat? Ich weiß, Sie haben gesagt, dass er ein beliebter alter Bursche ist, der sein Pensionistendasein dem Dienst an der Öffentlichkeit verschrieben hat, aber ist es nicht ein bisschen anrüchig, im Namen des ›Tourismus‹ eine Pornokampagne zu entfesseln?« Neil hatte die Einzelheiten über den Kommissionsbericht in der Morgenzeitung gelesen und wir hatten beide darüber gelacht.
»Politische Ambitionen …« Pierce dachte über Niels Bemerkung nach. »Ich kann mir nicht vorstellen, welche. Soviel ich weiß, hat Dr. Tenelli keine Verbindung zu meinem Gegner oder zu irgendjemandem von Kerrs Familie. Und ich bin mir sicher, dass er keinen Gefallen an Miriam Westermans moralischem Feldzug findet. Tenelli ist ein Mann mit hohen ethischen Prinzipien – kein Bücherverbrenner.«
»Hm.« Ich fuhr mit dem Finger über den Rand meines Bechers. »Vielleicht wäre es Zeit, ihn kennen zu lernen.«
»Vielleicht«, stimmte Pierce zu. »Ich glaube, Sie werden ihn mögen, trotz der Sittlichkeitsgeschichte. Wenn Sie nächste Woche irgendwann mal nicht so viel zu tun haben, rufen Sie mich an, und ich fahre mit Ihnen zu ihm und stelle Sie vor.«
»Danke. Er klingt, als sei er ein recht interessanter Charakter.«
»Der interessante Charakter, den ichgerne kennen lernen würde«, mischte Neil sich ein, »wäre der Franzose, Bruno Hérisson.« Er wandte sich an Pierce. »Mark sagte, er hätte gestern den Register besucht. In der kleinen feinen Welt der Miniaturen ist die Kacke am dampfen.«
Ich war froh, dass Neil das Gespräch in diese Richtung lenkte, da es Pierce vielleicht dazu bringen würde, eine Andeutung über seine Beziehung zu Carrol Cantrell fallenzulassen, so es denn eine gab.
Neils Bemerkung schien Pierce zu verwirren. »Kacke am dampfen? Was meinen Sie damit?«, fragte er.
»Bruno behauptet, er hätte mit einer ausgesuchten Gruppe von Kunsthandwerkern Vereinbarungen abgeschlossen, um zu ihrem exklusiven Vertreter in Amerika zu werden.
»Glee Savage«, fügte ich hinzu, »hat da eine saftige Story gerochen und ich glaube, Sie hat Recht. Wir werden versuchen, am Wochenende Cantrell zu sprechen, um seine Version zu hören.«
»Aber Carrol sagte« – Pierce brach ab und setzte neu an – »Cantrell sagte, er sei der alleinige Vertreter aller Spitzenhersteller, einschließlich Brunos.«
Ah-ha. »Wann war denn das, Doug?«, fragte ich.
»Erst letzte« – wieder brach Pierce ab – »kürzlich, glaube ich. Klar, am Donnerstag. Am Donnerstagmorgen gleich nach seiner Ankunft. Er erwähnte es mir gegenüber auf der Treppe, als wir ihm beim Einzug in die Remise geholfen haben.«
Ich war natürlich dabeigewesen und erinnerte mich nicht an eine solche Unterhaltung. Sie hatten irgendwann sonst darüber gesprochen, unter vier Augen.
So. Ich wusste Bescheid. Ich war mir sicher: Dumonts Polizeichef, Sheriff Douglas Pierce, den ich gerade öffentlich zur Wiederwahl empfohlen hatte, hatte es dem König der Miniaturen besorgt. Oder umgekehrt. Ob so oder so, mir schwirrte der Kopf.
Als ich später von zu Hause abfuhr, hatte ich vor, ein bis zwei Stunden im Register zu verbringen, die Fernschreiben zu kontrollieren, mich mit Lucille Haring zu treffen, um die Gestaltung der Titelseite der Sonntagszeitung zu regeln und ganz allgemein meinen Schreibtisch aufzuräumen. Als ich von der Prairie Street abbog, um über die Parkstreet zur First Avenue zu fahren, kam ich am Park selbst und einer Reihe von Seitenstraßen vorbei – Durkee, La Salle, Trevor. Meiner Umgebung nicht ganz bewusst, war ich in Gedanken über die Sittlichkeitssache versunken. Blies ich sie zu sehr auf? War meine Besessenheit vom ersten Verfassungszusatz nur akademisch und hatte nichts mit den realen Sorgen der meisten Bürger zu tun? Sollte ich die Zeitung aus der Debatte heraushalten und nur darüber berichten, was andere dazu zu sagen hatten, oder sollte ich mit dem Register einen aggressiven journalistischen Standpunkt zur Verteidigung der bürgerlichen Freiheiten beziehen?
Meine Gedanken wurden unterbrochen, als ich an die Kreuzung zur Tyner Avenue kam, wo Grace Lords Miniaturenladen lag. Ich bremste ab, um in die Straße zu schauen und stellte fest, dass vor dem Laden, vor dem in beiden Richtungen Autos parkten, rege Aktivität herrschte. Meine Reporterinstinkte wurden wach und ich bog von meinem ursprünglichen Weg ab, um nachzusehen.
Der Stau (wenn man diesen Begriff überhaupt für den Verkehr in Dumont anwenden kann), war vor Graces Geschäft, The Nook, am dicksten. Die Miniaturenausstellung sollte erst heute in einer Woche eröffnet werden, aber schon jetzt war eine Meute von Ausstellern eingetroffen, um sich auf den Kongress vorzubereiten und die besten Plätze für die Stände zu ergattern. Autos und Kombis rangelten um Parkplätze vor einem Nebeneingang; ich entdeckte Nummernschilder aus Illinois, Minnesota, Iowa und auch Wisconsin. Die Leute selbst – meist mittleren Alters und in Anoraks – bildeten Schlangen, um ihre Waren von den Fahrzeugen ins Gebäude zu tragen.
The Nook, das mit seiner putzigen Dekoration und seinen winzigen Ausmaßen selbst fast wie ein Puppenhaus wirkte, war viel zu klein, um dieser Invasion Herr zu werden, und die Aufbauarbeiten in den Räumlichkeiten des seit langem leerstehenden Rexall-Ladens nebenan waren in vollem Gange. Ein Aufgebot von freiwilligen Helfern säuberte gerade die Schaufenster, worauf im Innern die emsigen Vorbereitungen sichtbar wurden. Draußen versuchten weitere Arbeiter, ein Transparent an der Stelle aufzuhängen, die früher von dem Rexall-Schriftzug eingenommen worden war, wobei sie jedoch eine kühle Herbstbrise behinderte. Trotz des komischen Anblicks unterdrückte ich ein Lachen, da ich fürchtete, es könne jemand von einer Leiter fallen.
In der Annahme, Grace Lord befände sich mitten im Gewühl, fuhr ich an dem Stau vorbei, konnte ihre untersetzte Gestalt jedoch in der Menge nicht entdecken. Carrol Cantrells schlaksige Figur hätte ich leicht ausmachen können, ihn sah ich aber auch nicht. Meine Neugier war befriedigt und ich fuhr ein Stück weiter auf das Lordhaus zu, um in der Einfahrt zu wenden und zum Register zu fahren.
Als ich mich der Einfahrt näherte, bemerkte ich, dass da, in einigem Abstand von den Autos vor dem Laden, ein weiterer Wagen am Straßenrand parkte. Es handelte sich um eine unifarbene Limousine, wie sie Beamte als Dienstwagen benutzen, verdächtig in ihrer Anonymität wie das Auto einer Zivilstreife – ja, sie trug ›offizielle‹ Kennzeichen. Zuerst dachte ich, es könne sich um Doug Pierce handeln, aber sein Auto hatte einen helleren Beigeton. Am Steuer saß ein Mann und neben ihm saß noch jemand, aber da sich die Sonne in der Windschutzscheibe spiegelte, konnte ich ihre Züge nicht ausmachen. Ich fuhr also an die andere Straßenseite, stellte den Motor ab und machte mir ein paar Notizen, während ich darauf wartete, wer aus dem anderen Auto aussteigen würde.
Die Beifahrerin erkannte ich sofort, als sie den Fuß auf die Straße setzte. Eine Bö erfasste ihr Cape und wehte es ihr über den Kopf, worauf ihre rattengraue Frisur noch mehr durcheinander geriet – sie sah aus wie eine skurrile Hexe, die gerade unbeholfen aus Oz gelandet war. Es war niemand Geringeres als Miriam Westerman, die Gründerin und Anführerin von Fem-Snach. Beim Versuch, ihr Cape zu richten, klapperte sie mit einer wuchtigen primitiven Halskette, die schwer auf ihrem flachen Mieder lastete.
Dann ging die andere Tür auf und der Fahrer stieg aus. Die Sonne glänzte blau auf seinem rabenschwarzen Haar, das zweifellos gefärbt und zu einem altmodischen Schopf aufgetürmt war. Wenn die lästige Brise sich darin verfing, sah er aus wie ein Pudel im Anzug. Das war Harley Kaiser, der ehrenwerte Bezirksstaatsanwalt von Dumont County. Während er die Tür abschloss, versuchte er, sich mit den Fingern die Haare zu kämmen, freilich erfolglos – jetzt sah er aus wie ein Pudel mit Irokesenschnitt.
Zugegeben, meine Betrachtung der beiden Herrschaften war von Vorurteilen getrübt.
Miriam war die Frau, die versucht hatte, mir das Sorgerecht über Thad zu entreißen. Sie war die Frau, die, als ich nach Dumont gekommen war, eine Drohbriefkampagne gegen mich entfesselt hatte, indem sie meine Homosexualität als ›abscheuliche Verirrung gegen Mutter Natur‹ gebrandmarkt hatte – ungeachtet ihres eigenen früheren Flirts mit dem Lesbischsein, das in ihrem Buch nicht weiter auffiel, weil Männer darin nicht vorkamen. Sie war die Frau, die ich eines Abends eigenhändig aus dem Haus geworfen hatte, als sie in ein Familientreffen geplatzt war und Beschimpfungen gegen mich ausgestoßen hatte, einschließlich der ziemlich originellen Beschuldigung, ich sei dem ›Peniskult‹ verfallen. Und sie war die Frau, die versuchte, die bürgerlichen Rechte einer ganzen Gemeinde zu vergewaltigen, da Pornografie ihrer Meinung nach auf gleicher Stufe wie ›Gewalt gegen Frauen‹ stand. Miriam Westerman hasste mich inbrünstig. Angesichts solch irrationaler Abneigung konnte ich das Gefühl nur erwidern.
Mit Kaiser war es etwas anderes. Als gewählter Amtsinhaber besaß er einen Instinkt für die öffentliche Meinung und war allen Wählern, oder zumindest fünfzig Prozent von ihnen, verantwortlich. Außerdem war er klug genug, zu wissen, dass es ihm nichts einbrachte, wenn er sich dem Herausgeber der Lokalzeitung entgegenstellte. Daher versuchte er wenigstens, mir gegenüber, trotz unserer polaren Gegensätze bezüglich der Durchsetzung der Sittlichkeitsverordnung, freundschaftlich zu begegnen. Was mich betraf, so war er einfach auf der falschen Seite gelandet, Punkt, und ich wunderte mich über seinen Mangel an Prinzipien, wenn er für irgendeinen politischen Vorteil bereit war, den Ersten Verfassungszusatz zu verkaufen. Meine Freundin Roxanne Exner hatte mit ihrer bündigen Einschätzung des Bezirksstaatsanwalts den Nagel auf den Kopf getroffen: Harley Kaiser war ein Schleimer.
Ich hatte Kaiser und Miriam in Bezug auf ihre Allianz zur Befreiung Dumonts von Pornografie als ›seltsame Bettgenossen‹ bezeichnet. Nun, da ich sie aus dem Auto heraus beobachtete, fand ich ihr Bündnis noch befremdlicher. Was hatten sie vor? Wieso hier? Wieso jetzt?
Zweifellos stellten sie sich die gleichen Fragen über mich. Sie standen am Straßenrand, redeten über ihre Schultern hinweg miteinander und beäugten meinen Wagen, den jeder in der Stadt erkannt hätte. Ich ließ sie also eine Weile weiterrätseln und hoffte, meine Gegenwart würde sie beunruhigen. Hinter getönten Scheiben machte ich mir noch ein paar Notizen, dann schraubte ich meinen Füllhalter zu und steckte ihn zusammen mit dem Block wieder ins Jackett.
Ich stieg aus und setzte eine Sonnenbrille auf (der herbstliche Glanz des Mittagslichts war nicht besonders störend – genau genommen genoss ich ihn sogar – aber ich dachte mir, mit der dunklen Brille würde ich noch eine Spur bedrohlicher wirken). Ich tat, als würde ich sie erst jetzt bemerken. »Miriam, Harley«, rief ich über die Straße, »was für eine angenehme Überraschung.« Es war gut gespielt, aber im Licht unserer früheren Zusammenstöße konnten sie sich denken, dass ich heuchelte.
Kaiser kam mir bis in die Mitte der Straße entgegen und schüttelte mir die Hand. »Morgen, Mark. Wusste gar nicht, dass Sie sich für Puppenhäuser interessieren.« Man hätte die Bemerkung so verstehen können, dass er meine Männlichkeit in Frage stellen wollte, aber sein Ton wirkte ganz harmlos – er hatte einfach kein Talent zum Smalltalk. Wenn seine Worte einen verborgenen Sinn hatten, dann wollte er eigentlich nur fragen, Was machen Sie denn hier?
Ich schlenderte mit ihm über die Straße zurück. »Wo immer Nachrichten sind, da bin ich auch«, blökte ich.
Da Miriam keine Anstalten machte, von mir Kenntnis zu nehmen, als wir bei ihr ankamen, ließ ich weitere Liebenswürdigkeiten bleiben. »Was machen Sie denn hier«, fragte ich sie direkt.
»Das gleiche könnte ich Sie auch fragen«, blaffte sie zurück und stampfte trotzig mit dem Fuß auf, hatte jedoch kein Glück – ihr Clog zermahlte nur Schotter.
»Eigentlich«, sagte Kaiser, der versuchte die Dinge im zivilisierten Rahmen zu halten, »wollten wir Carrol Cantrell besuchen. Er ist eine bekannte Persönlichkeit und wir wollten ihn beide willkommen heißen.« Er lächelte als hätte er damit alles erklärt, und das war’s gewesen.
»Was für ein Zufall«, flunkerte ich. »Ich war selbst gerade auf dem Weg zu ihm. Wir wollen ein Feature bringen.« Das würde natürlich Glees Artikel werden, aber im Augenblick schadete es nicht, wenn Kaiser glaubte, ich sei beruflich hier. Es kam mir unwahrscheinlich vor, dass er und Miriam gemeinsam aus purer Höflichkeit den roten Teppich für den König der Miniaturen ausrollen wollten. Aber immer noch fiel mir keine bessere Erklärung für ihren Besuch ein. Wenn ich mich an sie hängte, würde mir ihr Motiv vielleicht klar werden. »Dann überfallen wir ihn doch alle zusammen«, schlug ich strahlend vor.
Miriam und Kaiser wechselten unsichere Blicke; in meiner Anwesenheit fühlten sie sich nicht frei, sich über meine Einmischung zu verständigen. Miriam schaute verärgert, Kaiser misstrauisch. Er druckste herum, bevor er schließlich nachgab. »Klar, warum nicht? Meinen Sie, er ist im Laden?«
»Eigentlich nicht.« Ich zeigte mit dem Arm die Straße zurück. »Ich bin aus dieser Richtung gekommen und konnte mir die Meute ganz gut anschauen. Carrol Cantrell ist mindestens einsneunzig groß, da wäre es mir aufgefallen, wenn er dort wäre. Ich glaube, wir versuchen es am besten in der Remise.«
Kaiser und Miriam wussten, wo Carrol untergebracht war, da aber beide keine Ahnung hatten, wo Grace Lords Grundstück lag, erwies sich meine Anwesenheit als nützlich, da ich sie führen konnte. Schweigend gingen wir mit knirschenden Schritten über die Auffahrt neben dem Haus. Wenn ich mir den Staatsanwalt und die Feministin, die da aus mir unbekannten Gründen auf die Remise zugingen, so anschaute, fiel es mir schwer, mir vorzustellen, dass sie zusammen mit Doug Pierce aufgewachsen waren – so radikal verschiedene Richtungen hatten ihre Lebenswege genommen.
Draußen auf der Straße, in all den Aktivitäten der Vorbereitungen auf den Kongress, hatte man das Gefühl eines munteren Durcheinanders gehabt. Hier jedoch, im Schatten des Hauses, war alles still – bis auf uns, bis auf das Rascheln eines Vogels irgendwo im aufragenden Geäst alter Bäume. Der helle Tag hatte eine unheimliche Stimmung angenommen und instinktiv nahm ich die dunkle Brille ab und steckte sie ein. Unser aller Verstummen, bedingt durch nichts weniger als gegenseitige Abneigung, schien jetzt eine aktive Gehässigkeit auszustrahlen.
Ich brach das Schweigen. »Ist Ihre Schule jetzt fertig und in Betrieb?«, fragte ich Miriam.
Ohne ihren Schritt zu verlangsamen, drehte sie sich um. »Das wissen Sie ganz genau. Ihre eigene Zeitung hat darüber berichtet – wenn auch kaum. Das ist eine Nachricht, wissen Sie. Wisconsins – wahrscheinlich Amerikas – erste ganzheitliche, heidnische New Age Schule. Ariel würde von unserem Lehrplan und unserer biodynamischen Kost profitieren.«
Die letzte Bemerkung war nur dazu gedacht, mich zu ärgern. »Die Mutter des Jungen gab ihm den Namen Thad«, erinnerte ich sie kühl.
Sie schickte sich schon an, ausfällig zu werden, als Kaiser sie zum Schweigen brachte. »Jetzt nicht, Miriam. Wir haben Wichtigeres vor.«
Also doch – dieser Besuch hatte seinen besonderen Grund. Beim Versuch, dahinter zu kommen, was dieses Wichtigere wohl sein mochte, ließ ich das Gespräch wieder versiegen.
Bei der zweistöckigen Garage am Ende der Auffahrt angekommen, führte ich sie um das Haus zu der Seite, wo die Stufen zu der überdachten Veranda der Remise hinaufgingen. Ich erklomm die ersten grüngestrichenen Stufen und blickte über den weiten, schattigen Rasen. Blitzartig stieg die stille Szene vor mir auf, die auf dem gerahmten Foto von Graces Neffen festgehalten war. Ward Lord, der seinem Hund eine Frisbeescheibe zuwarf. Die Erinnerung (die keine richtige Erinnerung war, sondern eher der visuelle Eindruck eines jahrealten, in einem Schnappschuss konservierten Geschehnisses) löste ein beunruhigendes Déja-vu-Gefühl in mir aus, bei dem sich mir eine quälende Frage stellte: Glich die Szene, die ich hier vor mir sah, wirklich der, an die ich mich erinnerte, oder wurde meine Erinnerung von dem umgeschrieben, was ich vor mir sah? Es war unmöglich zu unterscheiden – selbst die Bäume erschienen mir dieselben, was, wie ich vom Verstand, wenn auch nicht vom Gefühl her, wusste, nicht sein konnte. Beim Weitergehen suchte ich nach etwas Kleinem, einem übersehenen Hinweis, der mir bewies, dass zwischen Vergangenheit und Gegenwart ein Unterschied bestand. Und dann sah ich es. Als ich auf dem Treppenabsatz umdrehte, bemerkte ich, versteckt unter einem Baum am Ende des Rasens, ein Gartenornament, einen kleinen steinernen Obelisken, den ich zuvor nicht gesehen hatte, weder auf dem Foto noch in Wirklichkeit. Obgleich ich durch diese Entdeckung hätte erleichtert sein sollen – sie vergewisserte mich der Realität – war die Wirkung des Obelisks alles andere als ermutigend. Nein, dieser Sandsteinmonolith sah ganz wie ein Grabstein aus. Das, in Verbindung mit der unbehaglichen Stille (selbst der frische Morgenwind war erstorben, als hielte er den Atem an), schuf das Gefühl einer intensiven Vorahnung und plötzlich fürchtete ich, was ich am Ende der Stufen vorfinden würde.
Carrol Cantrells Schrei zerriss die Stille, zerrte an meinen Gedanken, bestätigte meine Befürchtungen – so nahm ich jedenfalls an. Wir erstarrten, im ersten Moment unsicher, was wir tun sollten. In diesem Augenblick verzögerter Reaktion verlor Miriam den Halt. Einer ihrer plumpen Clogs rutschte von der Stufe und warf einen Geranientopf über den Rand. Gerade als er auf die Erde traf, wurde der Knall von einem weiteren Kreischen aus Carrols Quartier übertönt.
Durch das Fliegengitter erkannten wir, dass er telefonierte, wobei er jetzt atemlos aufheulte – ein schwacher Nachhall seines explosiven Schaut-alle-her-Gelächters.
Ich rügte mich dafür, mich in von einem harmlosen Gartenaccessoir heraufbeschworenen düsteren Vorahnungen zu ergehen, und ermahnte mich, dass ich meine erfolgreiche Karriere zum großen Teil einer strikten Objektivität verdankte, die keinen Aberglauben zuließ. Froh, wieder im Hier und Jetzt zu sein, konzentrierte ich mich auf Carrols Telefongespräch. »Jesses, was für eine Schreckschraube!«, keifte er luftschnappend. »Eine total beschissene Fotze?« Dann jaulte er entzückt über etwas auf, was am anderen Ende gesagt worden war.
Miriam und Kaiser wechselten einen angewiderten Blick und rollten missbilligend die Augen. Ehrlich gesagt, gefiel mir Carrols Vorstellung auch nicht besonders. Seine Worte waren allerdings auch nicht für unsere Ohren bestimmt. Er war sich nicht bewusst, dass sich auf seiner Veranda Publikum eingefunden hatte, und wenn wir ihn ahnungslos weitermachen ließen, machten wir uns des Lauschens schuldig.
Ich ging also an die Tür, um uns bemerkbar zu machen. Unmittelbar bevor ich klopfte, hörten wir eine letzte Bemerkung in weit nüchternerem Tonfall: »Und was ist mit dem Millerstandard?«
Auf diese Frage unvorbereitet und ratlos, was sie bedeuten mochte, hielt ich inne und grübelte über Carrols Worte nach. Wovon redete er da eigentlich … von Bier? Ganz bestimmt nicht. Von der Arbeit eines besonders berühmten Künstlers namens Miller? Möglich. Mit einem Blick zurück auf Miriam und Kaiser, stellte ich fest, dass Miriam keine Notiz von Carrols Frage genommen zu haben schien. Sie kämpfte immer noch mit ihrem Clog. Durchaus ein Anblick – sie sah aus, als würde sie von ihrem Cape aufgefressen. Kaiser jedoch wirkte konzentriert und gespannt, als habe er Carrols Anspielung auf den ›Millerstandard‹ verstanden. War es ein juristischer Begriff? Ich wusste es einfach nicht.
Also klopfte ich. »Carrol? Jemand zu Hause?«, rief ich nach drinnen. Es hatte keinen Sinn, ihm zu verraten, dass wir jedes Wort gehört hatten.
In einem langen seidenen Bademantel und mit einem Handy in der Hand löste er sich aus den Schatten hinter dem Fliegengitter. »Ich habe Besuch«, sagte er. »Muss Schluss machen, Liebes. Bis später.« Damit klappte er das Handy zu.
»Tut mir Leid, dass wir stören«, sagte ich lahm durch das Gitter.
Er erkannte mich und riss weit die Tür auf. »Mark, Süßer!« Dann blinzelte er in die Sonne und sah die anderen. »Oh?« Seine Haare standen in alle Richtungen und er war noch nicht rasiert. Es war spät am Morgen, ich dachte mir, sein Tagesrhythmus bewegte sich immer noch nach kalifornischer Zeit.
»Ich war in der Gegend«, erklärte ich, »und da dachte ich mir, ich könnte mal vorbeischauen und lief – ausgerechnet – zwei Freunden über den Weg, die die gleiche Idee hatten.« Einen Augenblick lang war Stille. Da klar war, dass ihm die Störung ungelegen kam, fuhr ich mit der Vorstellung fort. »Erstens, das hier ist Miriam Westerman, die Gründerin einer örtlichen feministischen Gruppe, die gerade eine New Age Tagesschule eröffnet hat.«
Er steckte das Handy in die Tasche, zog seinen Bademantel fester zusammen und schüttelte ihr von der Schwelle aus die Hand. Nach dem Austausch einiger gezwungener Liebenswürdigkeiten, fragte er: »Sind Sie … Sammlerin?«
Sie schaute ihn ratlos an. »Sammlerin wovon?«
»Von Miniaturen natürlich«, sagte er, als rede er mit einer Idiotin (ich genoss es).
Sie lachte verlegen. »Ach so – nein – eigentlich nicht.« Mehr sagte sie nicht, gab keine Erklärung ihrer Anwesenheit ab.
Verständlicherweise wirkte Carrol jetzt eher verblüfft als verärgert. Ich nahm an, das Kommen seines anderen Besuchers würde ihn ähnlich ratlos machen. »Und das ist Harley Kaiser, der Bezirksstaatsanwalt von Dumont County.«
»Tatsächlich?« Entgegen meiner Erwartungen lag in Carrols Tonfall keine Überraschung, eher ein Erkennen, als habe er erwartet, dass Kaiser vor seiner Tür auftauchen würde. Es war deutlich, dass die beiden sich noch nie gesehen hatten, aber Carrol schien genau zu wissen, wer Kaiser war. Während des Händeschüttelns schaute er Kaiser eindringlich an, als wolle er das Gesicht mit dem Namen verknüpfen. Wenn meine Theorie stimmte, dass Sheriff Pierce und Carrol miteinander geschlafen hatten, hatte dann Pierce Carrol von dem Staatsanwalt erzählt? Solche Unterhaltungen erschienen mir nicht als geeignetes Kopfkissengeflüster.
In augenblicklich liebenswürdigerem Ton fuhr Carrol fort. »Wie unhöflich von mir – Sie hier draußen stehen zu lassen. Kommen Sie doch rein.« Er trat zur Seite, um uns vorbeizulassen. »Aber ich warne Sie: es ist ein fürchterliches Durcheinander. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mich recht einzurichten.« Das war eine Untertreibung. Die Wohnung selbst war bezaubernd. Grace Lords Remise bestand im Wesentlichen aus einem großen Raum unter den Dachbalken der Scheune. Mansardenfenster boten zu beiden Seiten einen Blick auf Baumwipfel, umrahmt von den Spitzengardinen, die ich von unten gesehen hatte. An einem Ende befand sich ein Badezimmer mit einem kleinen Schrank und einer Küchenzeile daneben, aber den größten Teil nahm ein offener Raum ein, der als Wohn-, Speise- und Schlafzimmer diente. Die Möbel hatten einen geschmackvollen ›Landhaustouch‹ und waren mit fröhlichen Chintz- und rustikalen Ginghampolstern bezogen. Die breiten, lackierten Fußbodenbohlen knackten unter den Füßen, was durch verstreut ausgelegte bunte Flickenteppiche gedämpft wurde. Der Raum machte insgesamt einen behaglichen und gepflegten Eindruck.
Der neue Inhaber des Zimmers mochte es zwar behaglich finden, aber es war alles andere als aufgeräumt. Da der Inhalt seines Gepäcks nicht annähernd in den winzigen Schrank passte, hingen seine Kleider überall, wo man einen Kleiderbügel hinhängen konnte – an Dachsparren, Vorhangstangen und Türklinken. Die Koffer selbst standen mit einer Unzahl nicht ausgepackter Sachen offen auf den Stühlen – Schuhe, Zeitschriftenstapel, kleine Pappschachteln, ein Föhn und eine unglaubliche Sammlung an Toilettenartikeln und Kosmetika.
Die Unordnung hatte nichts mit dem offensichtlichen Problem zu tun, dass Carrol zu viel Zeug mitgebracht hatte. Er hatte zwei Tage Zeit gehabt, sich einzurichten, und anstatt das Beste aus der beengten Lage zu machen, hatte er ein heilloses Durcheinander angerichtet. Zerknüllte Bettlaken hingen von der Doppelmatratze zu Boden. Feuchte Handtücher hingen von Stuhllehnen oder lagen in Haufen dort, wo sie hingefallen waren. Zeitschriften und Aktenordner überfluteten einen winzigen Schreibtisch. Der Esstisch war zu einem zusätzlichen Arbeitsplatz umfunktioniert worden, wo Carrols laufender Laptop offenstand, auf dessen leuchtendem Display eine Datei zu sehen war. Um den Computer herum standen inmitten von ausgebreiteten Unterlagen einige der kleinen Pappschachteln. Sie waren geöffnet und enthielten Miniaturmöbel – wundervolle winzige Schreibtische und sonderbare Polsterstühlchen, alle unglaublich detailliert. Waren das etwa Beispiele von Bruno Hérissons Kunstfertigkeit?
Ebenfalls neben dem Computer lagen einige der Zeitschriften, die Carrol ausgepackt hatte, und ich stellte fest, dass es sich bei dem gemeinsamen Thema dieser Publikationen nicht um Puppenstuben, sondern um Mannesfleisch handelte. Die ausgeklappten Mittelseiten präsentierten geile Muskelmänner, die es miteinander trieben. Beim unerwarteten Anblick ihrer eingeölten Leiber erlag ich für einen Moment dem Sog ihrer erstarrten vierfarbigen Hochglanzbegierde. Ich war nicht der einzige, dem die Orgie auf dem Tisch auffiel. Kaiser und Miriam waren unter nichtssagendem Geplauder mit Carrol ins Zimmer getreten und standen jetzt gleich neben dem Tisch und blickten beide starr auf das, was sie dort sahen. Ich hatte den Eindruck, Kaiser hatte noch nie zuvor solch eindeutige Abbildungen männlicher Kopulationen gesehen – seine weit aufgerissenen Augen schienen eher Verwunderung denn Entsetzen widerzuspiegeln. Miriam jedoch verzerrte das Gesicht mit deutlichem Ekel, was mich einigermaßen verwunderte – ihr Einwand gegen Pornografie war schließlich der, dass sie ›Gewalt gegen Frauen‹ darstellte, und man kann mir glauben, gegen Frauen wurde an diesem Morgen auf dem Schreibtisch keine Gewalt ausgeübt.
Ebenso wunderte ich mich über Carrols Gelassenheit. Da stand er, meckerte munter über das ›eklige nasse Wetter ‹ drüben in Kalifornien, und schien sich nicht darum zu scheren, dass diese beiden Fremden Material beglotzten, das die meisten Menschen irgendwo versteckt hätten. Er machte keinerlei Anstalten, die Hefte fortzuräumen oder seine Besucher vom Tisch wegzuscheuchen. Statt dessen plauderte er weiter, während er sich über den Computer beugte und ihn ausschaltete. Mit einem Klicken wurde der Bildschirm dunkel.
Irgendwie war er mir ein Rätsel, dieser Carrol Cantrell. Der König der Miniaturen war nicht nur eine Schlüsselfigur in einer bizarren kleinen Welt, die mir schon etwas von Besessenheit – möglicherweise von Neurose – zu haben schien, zudem vereinte er eine Vielzahl widersprüchlicher Wesenszüge in sich. Man bedenke: Am Tag seiner Ankunft war er tadellos gekleidet und überaus gepflegt gewesen, offensichtlich legte er also Wert auf seine äußere Erscheinung. Aber jetzt sah er verboten aus, sein Zimmer war ein Chaos und es machte ihm überhaupt nichts aus, drei unerwarteten Besuchern seinen ungeschminkten morgendlichen Anblick zu bieten. Hielt er uns hier in Wisconsin alle für Dorfdeppen, deren Meinung nicht das Nachdenken wert war? Oder war er von seiner eigenen Berühmtheit so geblendet, dass er sich, im Vertrauen darauf, dass seine Herrschaft alles überstehen würde, nicht mehr darum scherte, wie man ihn sah oder was man von ihm hielt? Oder (und das war meine beste Theorie) war er von den beiden Nächten in der Falle mit Doug Pierce einfach nur rundum befriedigt? Das hätte Carrols legeres Auftreten, sein Wohlbefinden, sein unbekümmertes Beiseiteschieben der Anstandsformen gut erklärt.
Sobald meine Gedanken diese Richtung eingeschlagen hatten, konnte ich sie nicht mehr abschütteln. Während ich bei dem Gespräch, dessen Inhalt mir entging (Kaiser machte irgendeine abfällige Bemerkung über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die jedoch beliebig und ohne Zusammenhang erschien), zu- und wieder weghörte, suchte ich im Zimmer nach einem Beweis, dass Pierce die Nächte hier verbracht hatte. Zuerst schaute ich natürlich zum Bett – als ob der Sheriff so zerstreut gewesen wäre, sein Pistolenhalfter am Bettpfosten hängen zu lassen. Da ich weder Kanone, noch Abzeichen, noch Handschellen am Bett entdeckte, wandte sich mein Blick vom Bett ab und schweifte durchs Zimmer.
Ich wusste sehr wohl, dass es mich nichts anging. Meine Interesse beruhte auf etwas mehr als – was, bloßer Neugier? Oder war es etwa eine Art Eifersucht? Finger weg, ermahnte ich mich selbst. Worauf hätte ich schon eifersüchtig sein können? Eine schnelle Nummer? Ich hatte eine feste Liebesbeziehung und aus Erfahrung wusste ich, dass man diese nicht beliebigen Prüfungen unterwerfen darf. Außerdem war ich nicht im mindesten interessiert daran, mit Carrol Cantrell ins Bett zu steigen. Aber was war mit Doug Pierce. Ob wohl Doug und ich …
Meine Gewissenserforschung wurde unterbrochen, als mein Blick auf etwas über einer Kommode fiel. Genauer, mein Blick fiel auf ein ›Nichts‹, eine Stelle an der Wand, wo etwas zu fehlen schien. Auf der Kommode standen verschiedene Gegenstände, die der Beachtung nicht wert waren – kleine Kristallfiguren, gerahmte Fotos und andere Erinnerungsstücke der Familie Lord, ein Strauß getrockneter Kornblumen, eine Schale für Kleingeld, ein Paar Kerzenleuchter aus Messing. Die Kerzenleuchter standen symmetrisch an beiden Enden der Kommode und zwischen ihnen an der Wand hing nichts. Es sah aus, als gehöre ein Spiegel da hin. Dann erinnerte ich mich an das Foto von Grace Lords Neffen Ward, das ich auszuräumen mitgeholfen hatte – sicher war das es gewesen, was über der Kommode gehangen hatte. Obwohl ich dieses kleine Rätsel gelöst hatte, wirkte die nackte Stelle an der Wand seltsam beunruhigend. Träumte ich schon wieder dem Bild des Jungen nach? Oder war es einfach eine Reaktion auf die fragwürdige Ästhetik der nackten Wand?
Ich beendete die Inspektion des Zimmers und mein Blick fiel wieder auf das Bett, von wo sie ausgegangen war. Gerade als ich zu dem Schluss gekommen war, meine Suche sei zwecklos, gerade als ich mich ermahnte, mich wieder auf Carrols Gespräch mit Kaiser und Miriam zu konzentrieren, bemerkte ich etwas unter einem Kissen, das auf den Nachttisch geworfen worden war, hervorlugen. Wenn ich mich nicht täuschte, handelte es sich um eine zusammengedrückte Tube KY, einem medizinischen Gleitmittel, das gerne beim Sex verwendet wurde. Obgleich diese Entdeckung kein handfester Beweis für die Liaison war, die ich vermutete, stachelte sie meinen Verdacht doch an, und das Bild, das sie heraufbeschwor, erregte mich. Finger weg, ermahnte ich mich. Das geht dich nichts an. Doug ist erwachsen. Er ist fünfundvierzig. Er ist alleinstehend. Vielleicht hat er das gebraucht.
»Genau so ist es«, sagte Carrol. Er schwenkte sein Notfallarmband aus Nickel, den einzigen Schmuck, den er an diesem Morgen trug. »Ich bin allergisch gegen Nüsse«, erklärte er Kaiser und Miriam. »Schwer allergisch, genau gesagt, aber ansonsten bin ich gesund wie ein Pferd.« Er schlug sich dramatisch gegen die Brust um seine männliche Kraft zu demonstrieren, hätte damit jedoch in allem anderen als diesem flatternden seidenen Morgenrock eine größere Wirkung erzielt.
Wir mussten alle über sein gekünsteltes Draufgängertum kichern und tatsächlich fiel er mit seinem kräftigen, eingeübten Lachen ein. Dann wurde es still.
»Gibt es sonst noch etwas?«, fragte er. »Ich sollte mich jetzt wirklich fertigmachen.«
»Nein …« Kaiser zögerte. »Wir müssen eigentlich gehen. Miriam und ich wollten Sie nur in Dumont willkommen heißen. Wir hoffen, Sie genießen Ihren Aufenthalt.«
»Willkommen in Dumont, Mr. Cantrell«, echote Miriam. Ihr Tonfall war flach und emotionslos, aber das überraschte mich nicht – Zeichen von Leben kamen von ihr nur, wenn es etwas gab, worüber sie keifen konnte.
Ich ging mit den beiden zur Tür und drehte mich um, um Carrol zum Abschied die Hand zu schütteln. Er nahm mich vorsichtig beiseite. »Haben Sie noch einen Moment Zeit?«, fragte er.
Ich blieb also, während Kaiser und Miriam zur Tür hinausgingen, über die Veranda polterten und die Stufen betraten.
Carrol ging an ein Fenster, um ihren Abgang zu beobachten, und als er sicher war, dass sie sich nicht mehr in Hörweite befanden, wandte er sich mir zu. »Tut mir Leid, Mark«, sprudelte er heraus. »Es ist mir furchtbar peinlich, dass Sie mich in diesem Aufzug erwischt haben.« Mit den Händen fuhr er sich durch die Haare, während er durchs Zimmer eilte, um die Zeitschriften auf dem Tisch zuzuschlagen und sie zu mehreren ordentlichen Häufchen zu stapeln.
Ich lachte, erleichtert, dass sein Benehmen zuvor nicht wirklich ›er‹ gewesen war. Aber immer noch war ich verwirrt. »Wieso haben Sie Kaiser und Miriam das vorgespielt?«
Er tat zum Bett, raffte die Laken vom Fußboden auf und versuchte mit nur wenig Erfolg, ein wenig Ordnung zu schaffen. »Ich konnte die beiden einfach nicht leiden«, erklärte er. »Instinktiv vielleicht. Ich wollte, dass sie gehen, und ehrlich gesagt ist es mir scheißegal, was sie von mir halten.« Er betrachtete das zerwühlte Bett und stöhnte frustriert auf. Dann fiel ihm etwas ein und sein Ton wurde fröhlicher. »Gott sei Dank – Grace sagte, sie kommt heute Nachmittag vorbei und hilft mir, Ordnung zu machen. Sie ist ein Schatz.«
»Das ist sie«, stimmte ich zu. »Aber was wollten sie?«
»Verraten Sie’s mir.« Carrol warf verzweifelt die Arme in die Luft. »Haben Sie die Bemerkung über die Bürgerrechtsbewegung verstanden?«
»Eigentlich ja. Kaiser hat sich in letzter Zeit die Pornografie in den Kopf gesetzt, was ihm mit den meisten Bürgerrechtlern Ärger eingebracht hat. Ihre … äh, Lektüre muss ihn ganz schön durcheinander gebracht haben.« Ich informierte Carrol über die Hintergründe von Miriams feministischer Antipornokampagne, die Countyverordnung und den bevorstehenden Sittlichkeitsprozess des Staatsanwalts, den er gewinnen musste.
»Also, wieso wundert mich das alles kein bisschen?«
In der Tat. Ich war versucht, ihn zu fragen, ob Sheriff Pierce ihm davon erzählt hatte, aber dann hätte er bestimmt mein eigentliches, voyeuristisches Motiv für die Frage erahnt, und ich hielt den Mund.
Wild aufräumend bahnte er sich einen Weg ums Bett, breitete eine Tagesdecke über die Laken und kam schließlich zum Nachttisch, wo er das Kissen wieder an seinen Platz auf dem Bett warf, wodurch die noch klebrige Tube KY voll sichtbar wurde. Er brummelte verlegen, während er die Schublade des Nachttischs öffnete und die Gleitcreme hineinfallen ließ. Auf dem Nachttisch entdeckte ich nun neben einem unordentlichen Stapel von Papieren Carrols fetten Füllfederhalter, den hässlichen, den ich am Donnerstagmorgen schon gesehen hatte.
Er raffte die Papiere zusammen und hastete zum Schreibtisch, wo er sie auf das übrige Chaos stapelte. »Und was hat Sie heute Morgen zu mir geführt?« Seine Frage hatte einen gutgelaunten Unterton, der nach einer saftigen Antwort verlangte.
»Eigentlich«, gestand ich, »wollte ich wissen, was Kaiser und Miriam im Schilde führen, und da bin ich mitgekommen und habe behauptet, ich würde an einem weiteren Artikel über Sie arbeiten. In Wirklichkeit wollte Glee Savage Sie noch einmal interviewen – wir hatten gestern Besuch von Ihrem alten Freund Bruno Hérisson und – nun ja, ich greife voraus. Hätten Sie noch ein bisschen Zeit für Glee und mich, morgen früh vielleicht?«
»Na klar, Mark, ist mir ein Vergnügen – je mehr Presse desto besser. Ich habe vor, einen Blick auf das Getümmel in Graces Laden zu werfen. Treffen wir uns doch dort.«
»Toll.« Ich nahm Füller und Block heraus. »Neun oder zehn Uhr?«
Er quittierte es mit einem Aber-bitte-Blick. »Heute ist Samstag, Mark«, erinnerte er mich grinsend. »Sagen wir morgen um elf.«
»Notiert«, sagte ich.
»Und jetzt«, scheuchte er mich spielerisch zur Tür, »muss ich wirklich ein bisschen daran arbeiten«. Er zeigte mit der Hand von Kopf bis Fuß, um anzudeuten, dass er eine komplette Instandsetzung nötig hatte, was auch wirklich der Fall war.
»Vielen Dank, Carrol.« Ich öffnete das Fliegengitter. »Bis morgen im Nook.«
»Bis morgen.« Damit tänzelte er in Richtung Bad, wobei er unterwegs halt machte, um ein Handtuch vom Boden aufzulesen. Dann warf er die Tür zum Badezimmer hinter sich zu.
Ich trat auf die Veranda hinaus und lachte leise über die Szene, die ich gerade erlebt hatte. Dann blieb ich stehen. Etwas beunruhigte mich. Etwas schien zu fehlen, aber was? Ich steckte also den Kopf wieder ins Zimmer und hoffte, der Anblick würde mir auf die Sprünge helfen. Und dann sah ich es – Carrols fetten Füller.
Bei seinem kurzen, heftigen Anfall von Ordnungswut hatte er einen Stapel Papiere vom Bett zum Schreibtisch getragen, den hässlichen Füller aber auf dem Nachttisch liegen lassen.
Hieß das logischerweise, dass der Füller nichts mit den Papieren zu tun hatte?
Oder begann ich jetzt zu spinnen?
Ich schloss die Tür, ging über die Veranda und die Treppe hinunter. Mein Mund war zugekniffen. Das Rätsel des Füllhalters hatte sicher nichts zu bedeuten. Ein viel größeres Rätsel beschäftigte mich. Eine immer noch unbeantwortete Frage lastete über dem kühlen Morgen.
Was zum Teufel führten Harley Kaiser und Miriam Westerman im Schilde?