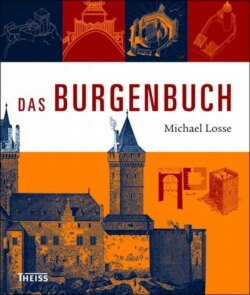Читать книгу Das Burgenbuch - Michael Losse - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеJede/r meint heute zu wissen, was eine Burg ist beziehungsweise war. Doch ist das vom TV und anderen Medien verbreitete und auf zahllosen „Mittelaltermärkten“ gepflegte Bild von „der mittelalterlichen Burg“ meist alles andere als realistisch. Vieltürmige Burgen mit Zugbrücken, Verliesen und tiefen Brunnen, mächtig, trutzig und oft umkämpft, verteidigt von einer großen Zahl „edler Ritter und Recken“ – das sind Klischees, die sich hartnäckig halten. Erst in den letzten Jahrzehnten konnte von der Burgenforschung ein realistischeres Bild der hoch- und spätmittelalterlichen Adelsburgen – diese unterschieden sich funktional und strukturell deutlich von frühmittelalterlichen Großburgen – gewonnen werden. Mit dem hier vorgelegten Buch, das an interessierte Laien gerichtet ist, wird, basierend auf neuesten Erkenntnissen der wissenschaftlichen Burgenforschung, aber allgemeinverständlich, ein realistisches Bild der Entwicklung mittelalterlicher Burgen von den Anfängen bis zur Burgen-Romantik des 19./frühen 20. Jh. vermittelt.
Der professionellen Burgenforschung steht heute ein breit gefächertes Instrumentarium effizienter Erforschungs- und Dokumentationsmethoden zur Verfügung:
– Durch archivalische Forschungen gewinnt die urkundliche Überlieferung für die Burg-Bauund Besitzgeschichte an Bedeutung. Für spätmittelalterliche Burgen und frühneuzeitliche Schlösser können zudem, sofern vorhanden, Baurechnungen und Planmaterial herangezogen werden.
– Mittels der Bauforschung ist es möglich, einzelne Bauphasen einer Burg zu identifizieren, die zeitliche Abfolge einzelner Bauten und Gebäudeteile zu bestimmen. Anhand von Baufugen, Mörtelzusammensetzungen, Steinmaterial und -formaten, der Spuren von Steinbearbeitungs- und -hebewerkzeugen an Steinen, von Bauplastik und Schießschartenformen lassen sich Datierungen vornehmen.
– Mit Hilfe der Dendrochronologie, der Erstellung eines (Baum-)Jahrringkataloges, läßt sich das Fälldatum von Hölzern (vor allem Eiche, Nadelhölzer) und somit ihre Verwendung beim Bau ermitteln – man griff in der Regel auf frisch gefälltes Holz zurück.
– Die 1981 in Deutschland an der Universität Bamberg wissenschaftlich etablierte Mittelalter-Archäologie bietet Möglichkeiten, durch Auswertung des Fundmaterials (zum Beispiel Geschirr, Gebrauchsgegenstände, Spielzeug, Waffen) Erkenntnisse über den Alltag auf Burgen zu gewinnen.
– Archäobotanik und Archäozoologie ergänzen die Mittelalter-Archäologie. Sie liefern Informationen zur Fauna und Flora vergangener Epochen (zum Beispiel Burggarten als Küchengarten), zur Tierhaltung und Ernährung.
Erst die umfassende Dokumentation einer Burg, beginnend mit einem genauen Aufmaß und einer detaillierten Beschreibung, unter Einbeziehung der hier aufgelisteten Forschungsmethoden bietet letztlich die optimale Grundlage zu ihrer Erhaltung. Beratung zum adäquaten Umgang mit mittelalterlichen Burgen bietet die Deutsche Burgenvereinigung (DBV), eine der ältesten nicht-staatlichen Organisationen in Europa, die sich der Erhaltung des kulturellen Erbes widmet. Gegründet wurde sie 1899 in Berlin als „Vereinigung zur Erhaltung deutscher Burgen“, um der zunehmenden Zerstörung von Burgen und historischen Wehr- und Wohnbauten, aber auch falschen Restaurierungen Einhalt zu gebieten. Voraussetzung für beides war und ist die Burgenforschung. Von Anfang an fanden sich in der DBV Burgenforscher und Restauratoren, Burg- und Schlossbesitzer und vor allem interessierte Laien zusammen. Oberstes Ziel der DBV ist nach wie vor die Erhaltung der historischen Wehr- und Wohnbauten als Zeugnisse der Geschichte und Kultur, als Denkmäler der Bau- und Kunstgeschichte und als prägende Elemente unserer Kulturlandschaft (Informationen: www.deutsche-burgen.org).
Neben der DBV sind die Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schlössern e. V., 1992 auf der Wartburg in Eisenach als internationale Forschungsgesellschaft gegründet (www.wartburggesellschaft.de), und der Marburger Arbeitskreis für europäische Burgenforschung e. V. (MAB) als wichtige in der Burgenforschung tätige Vereinigungen genannt, ebenso wie die Gesellschaft für Internationale Burgenkunde e. V. Aachen (GIB) (http://burgenkunde.de).
Wie vom Verlag gewünscht, wurden zur Illustration dieses Buches historische Abbildungen verwendet, da spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Druckgraphiken sowie Zeichnungen aus der Burgenliteratur des 19. Jh. vielfach die in den Texten geschilderten Sachverhalte besser dokumentieren: Nahezu alle mittelalterlichen Burgen unterlagen über die Jahrhunderte ihres Bestehens wiederholt baulichen Veränderungen; dazu gehören Umbauten, Erweiterungen, Reparaturen nach Sturm-, Blitz-, Brand-, Erdbeben- oder Kriegsschäden, Anpassungen an neue Kampfund Verteidigungstechniken, Umgestaltungen aufgrund veränderter Ansprüche an den Wohnkomfort, bauliche Reduzierungen und Teilabbrüche in der Neuzeit, in der keine Wehrgänge oder andere Verteidigungsanlagen mehr benötigt wurden, und schließlich schleichender oder gezielter Abbruch zur Gewinnung von Baumaterial im 19./frühen 20. Jh.
Auch in unserer Zeit kommt es, insbesondere durch zweckfremde Umnutzungen, aber auch durch Baumaßnahmen, häufig zu Verlusten historischer Bausubstanz an Burgen oder gar zum Verschwinden ganzer Objekte, etwa durch Steinbruchbetrieb. Zur Erhaltung der verbliebenen Burgen können alle Burgenbesucher/-innen beitragen, indem sie darauf verzichten, auf Mauern und Wällen herumzuklettern, Lagerfeuer innerhalb alter Gemäuer oder gar direkt an Mauern anzuzünden etc. Große Schäden haben innerhalb der letzten Jahre zunehmend Raubgräber angerichtet, die auf ihrer illegalen und strafbaren Suche nach „Schätzen“ und Metallgegenständen archäologische Befunde in Burgruinen zerstören! Zögern Sie bitte nicht, solche Zerstörer unseres kulturellen Erbes anzuzeigen beziehungsweise die Polizei zu verständigen, wenn sie solche Menschen auf frischer Tat ertappen. Und schließlich hat auch die Nutzung von Mountainbikes zu starken Schäden an vielen Burgruinen geführt. Helfen Sie, liebe Leser und Leserinnen, bitte mit, diese besonderen Baudenkmäler zu schützen!
Ich danke all jenen, die zum Entstehen des hier vorgelegten Buches beigetragen haben, darunter mehreren Kollegen/-innen aus dem Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Burgenvereinigung und dem Marburger Arbeitskreis für europäische Burgenforschung sowie aus dem Nellenburger Kreis, allen voran jedoch meiner Lebensgefährtin Ilga Koch sowie dem Verleger Bruno Hof für die sehr angenehme und ergiebige Zusammenarbeit! Des Weiteren danke ich Elmar Altwasser M.A., Prof. Horst Wolfgang Böhme, Dipl.-Ing. Elmar Brohl, Prof. Tomáš Durdík, Dr. Hermann Fabini, Uwe Frank, Martina Holdorf M.A., Jürgen Keddigkeit M.A., Dipl.-Ing. Rudolf Knappe, Dr. Heiko Laß, Rudolf Martin, Dr. Mathias Piana, Ralf Schrage, Dr. Stephen C. Spiteri (Malta).
Dr. Michael Losse
Andelfingen (CH), Burg (Kupferstich-Ausschnitt aus: Merian, Topographia Helvetiae …, 1642).