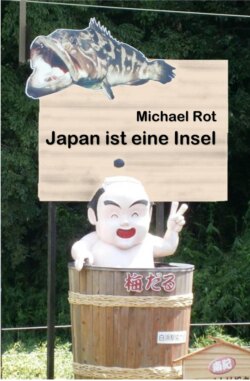Читать книгу Japan ist eine Insel - Michael Rot - Страница 5
Erster Akt – Japan ist eine Insel
Оглавление… oder eigentlich – viele Inseln.
Japan besteht aus einer Vielzahl von Inseln, angeblich 6852. So ganz genau kann man das nicht sagen, weil vielleicht gerade jetzt der eine oder andere Minivulkan entsteht oder im Meer versinkt. Außerdem würden einige Nachbarstaaten diese Zahl bestreiten. Mir selbst hätten ja die vier Hauptinseln genügt; den meisten Japanern wahrscheinlich auch – aber die hat keiner gefragt.
Doch eigentlich wollte ich etwas ganz anderes sagen.
Also, nochmals: Japan ist eine Insel – das klingt wirklich viel besser. Und so sagt es auch immer meine Frau. Deshalb steht diese eigentlich hinlänglich bekannte Tatsache auch am Beginn meiner Betrachtungen (nicht die Tatsache, dass meine Frau das sagt, sondern dass Japan eine Insel ist).
Japan ist natürlich viel mehr; es ist eine jahrhundertealte Monarchie, aber auch eine westlich orientierte parlamentarische Demokratie, Japan ist modern und traditionsbewusst, es ist langsam und schnell, freundlich und unnahbar, Japan ist heiß und kalt, es ist schön und erschreckend, innovativ und unflexibel, bunt, feucht und amerikafreundlich.
Immer wieder scheitere ich am Verständnis japanischer Verhaltensweisen. Und regelmäßig pflegt meine Frau auf die Bitte nach Aufklärung nur trocken zu antworten: »Insel!«
Womit wir gleich einen wesentlichen Charakterzug der japanischen Sprache angesprochen hätten: Sie kann zwar mit ihren Höflichkeitsfloskeln bis zum Exzess ausschweifend sein, ist aber bei der Mitteilung von Fakten umso wortkarger. Würde man etwa auf Deutsch sagen: »Schrecklich heiß ist es heute wieder!«, ist dem Japaner oft nicht mehr als ein seufzendes »'atsui!« zu entlocken, vielleicht noch ein Zustimmung erheischendes »'atsui nē?« (2). Aber das ist eine andere Geschichte.
(2) Zur Schreibung und Aussprache der zitierten japanischen Wörter siehe die Kapitel Transkriptionsschrift und Aussprache.
Wie kommt es, dass das Inselleben die Menschen so stark geprägt hat? Japan ist schließlich nicht die einzige Insel und auch nicht der einzige große Inselstaat der Welt (genau genommen der viertgrößte). Schließlich gibt es ja noch die Philippinen und Indonesien, oder in Europa neben dem kleinen Island auch Großbritannien. (Oder auch Kleinbritannien, falls sich bis zum Erscheinen dieses Buches die Schotten bereits selbständig gemacht haben, gefolgt von Nordirland.)
Die meisten Inselvölker verbindet die Sehnsucht nach der Ferne, der Erkundung dessen, was jenseits des Meeres liegt. So wurden sie zu bedeutenden Seefahrernationen. Geraume Zeit beherrschten die Briten die Weltmeere, aber bereits Jahrhunderte früher haben polynesische Seefahrer Amerika entdeckt und besiedelt, lange vor Cristoforo Colombo.
Ganz anders die Japaner. Der Wunsch übers Meer zu reisen, andere Welten zu entdecken, schlicht ihre Insel zu verlassen, liegt ihnen nicht im Blut. Im Gegensatz zu vielen anderen Inselbewohnern schloss sich Japan mehrmals und über lange Zeit von der Außenwelt ab. Man kapselte sich gleichsam ein, nützte die geographische Lage, um mehr oder weniger unbehelligt zu bleiben, und blieb mehr oder weniger unbehelligt. So entstand im Laufe der Jahrtausende eines der ethnisch und linguistisch vermutlich homogensten Völker der Welt.
Tatsächlich findet sich in der japanischen Bevölkerung Erbgut von mindestens fünf genetischen Gruppen, was auch die nach wie vor unterscheidbaren Gesichtsformen und Hauttypen erklären kann.
Die Entwicklung dieser hohen Homogenität wäre ohne die Insellage nicht möglich gewesen, und sie hat sich bis heute nicht wesentlich verändert – die Homogenität (aber die Insellage auch nicht). Lediglich zwei Zahlen aus dem Jahr 2014 genügen, um den Grad an Homogenität zu veranschaulichen: 99 Prozent aller in Japan lebenden Menschen sind gebürtige Japaner mit japanischer Muttersprache, umgekehrt leben 99 Prozent aller Japaner weltweit in Japan. Die Vergleichszahlen für Österreich sind: 80 und 95 Prozent (für Deutschland ebenso).
(Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass es notwendig sein könnte, zu definieren, was eine Insel ist? Für die Zählung der japanischen Inseln wurde das formuliert als »eine vollständig von Meerwasser umgebene Landmasse, die auch bei Hochwasser mit zumindest hundert Metern Durchmesser aus dem Meer ragt«.)
Die offizielle Geschichte Japans beginnt im Jahr 660 vor unserer Zeitrechnung mit der Thronbesteigung des ersten – mythischen – Kaisers [te'nnō]. In dieser Epoche fanden auch die Besiedlung der japanischen Inseln und damit die genetische »Grundmischung« der indigenen Japaner ihren Abschluss. Seit damals blieben die Japaner also sozusagen unter sich. (Bis vor 20 000 Jahren waren die japanischen Inseln mehrmals durch Landbrücken mit dem Festland verbunden – wie übrigens auch England. Aber wer braucht das schon?)
Man stelle sich zum Vergleich ein 2500 Jahre genetisch einheitliches Europa vor, ohne die Hegemonie der Römer, ohne 400 Jahre Völkerwanderung, ohne die Diaspora der Juden, ohne die Streifzüge Napoleons, den Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn, die ständig wechselnden Deutschen Staatenbünde, die erst 1954 abgeschlossene Staatswerdung Italiens, den Zerfall Jugoslawiens, der Sowjetunion, die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands, die wechselvolle Geschichte Polens, des Elsass, Belgiens oder der Niederlande. Was wäre Europa ohne das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, was wären Spanien und Portugal ohne den Einfluss von 780 Jahren maurischer Herrschaft, was wäre Griechenland ohne die Osmanen (vielleicht nicht pleite?), und überhaupt sind die Magyaren Asiaten.
Ganz anders in Japan. Also, Asiaten sind sie auch, aber der Rest der Geschichte verlief anders. In den frühen Kaiserepochen gab es noch Kontakte zu China und Korea, was schließlich auch zur Übernahme der chinesischen Schrift ab dem fünften Jahrhundert führte. Danach setzte aber eine erste Phase weitgehender Isolation ein. 1534 landeten die Portugiesen als erste Europäer auf dem Inselreich. Gemeinsam mit Spaniern und Niederländern begannen sie mit Japan Handel zu treiben.
Anfänglich lernten sie eifrig voneinander, vor allem übernahmen die Japaner Kenntnisse in Waffentechnik (sie kannten bis dahin keine Feuerwaffen), im Schiffbau und der Navigation. Von den Niederländern erwarben sie auch medizinisches Wissen.
Schon damals waren die Europäer erstaunt über die japanischen Essgewohnheiten. Vor allem die Tatsache, dass sie ihre Speisen nicht mit den Händen berührten, sondern mit Stäbchen. Beim Studium zeitgenössischer Berichte fragt man sich allerdings, welches Benehmen die europäischen Dinnergäste wohl an die Nacht gelegt haben mögen. Es wird schon einen Grund gehabt haben, warum die Japaner sie »Südbarbaren« [namban-jin] nannten. Das »Süd« mag verwirrend erscheinen, kamen die Fremden doch global gesehen aus dem Westen. Regional betrachtet erreichten sie die Insel Kyushu allerdings von Süden her.
Anfänglich verliefen die Handelsbeziehungen zu beiderseitigem Nutzen. Die Portugiesen betätigten sich als Zwischenhändler für die in Japan begehrten chinesischen Waren, nachdem der direkte Handel mit China wegen Piraterie und zahlreicher Scharmützel zum Erliegen gekommen war. Im Gegenzug exportierte Japan Gold, Silber und Kupfer. Während die protestantischen Niederländer sich mit den wirtschaftlichen Erfolgen begnügten, brachten die katholischen Spanier und Portugiesen auch ihre Missionare ins Land. Aber selbst die wurden anfänglich gut aufgenommen, die neue Religion fand auch einige Verbreitung; in Nagasaki, im Süden der Insel Kyushu, erlangten die Jesuiten sogar Jurisdiktion. (Kyushu heißt auf Deutsch »neun Länder«, was sich immer noch in den sieben Präfekturen der Insel wiederspiegelt!?)
Aber die Missionstruppen begannen, shintō-Schreine und buddhistische Tempel zu zerstören. Sie schmuggelten trotz erlassener Verbote weitere Priester ins Land, hetzten konvertierte und nicht konvertierte Einheimische gegeneinander auf und betrieben die Missionierung mit missionarischem Eifer. Das führte schließlich 1639 zum Bruch mit den Europäern und zur völligen Abschottung des Landes für mehr als zweihundert Jahre. Aus- und Einreise waren für Japaner wie für Ausländer verboten, der Handel mit anderen Ländern kam fast völlig zum Erliegen; einzig den Niederländern verblieb eine kleine Handels-Enklave auf der Insel Dejima vor Nagasaki.
Zunächst bescherte die Abschottung dem Land steigenden Wohlstand. Kein Wunder, kannte es doch – begünstigt durch mildes Klima, fruchtbaren, wenn auch rohstoffarmen Boden sowie Fischreichtum (»Insel!«) – keine Nahrungsprobleme; solange – und das war der springende Punkt – solange die Bevölkerung eine bestimmte Größenordnung nicht überstieg. Im 19. Jahrhundert war Japan schließlich nicht mehr in der Lage, sich mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen zu versorgen; das Land verarmte zusehends.
Auf massiven Druck der USA musste Japan schließlich seine Isolation aufgeben. Mit Unterstützung des Westens konnte es auch einiges an Modernisierung und Industrialisierung aufholen.
Der Ende des 19. Jahrhunderts als Berater tätige Flussbauingenieur Johannis de Rijke vermerkte angesichts des Flusses Jōganji: »Das ist kein Fluss, sondern ein Wasserfall« (3). Nun mag ein Holländer nicht unbedingt prädestiniert sein, Steigungen und Gefälle sachkundig zu beurteilen; tatsächlich stößt kommerzielle Schifffahrt in Japan aber auf erhebliche Hindernisse.
(3) Rein, Johann Justus: Japan nach Reisen und Studien, 1886, Bd. 1, S. 102ff.
»Ich habe gelesen, in Japan seien die Flüsse nicht schiffbar.«
»Stimmt nicht. Ich habe selbst auf einem Rundfahrtschiff in Ōsaka gearbeitet – als Kellnerin an der Schiffsbar«, entgegnete meine Frau.
»Dort stand, die Flüsse haben zu viel Gefälle.«
»Genau! Besonders wenn das Hochwasser kommt, sind sie sehr gefällig.«
»Gefährlich, meinst du.«
»Sag ich doch.«
Gleichzeitig wollte Japan den wirtschaftlichen Problemen durch Ausdehnung der politischen Einflusssphäre begegnen, was schließlich in mehrere Kriege mit den Nachbarstaaten mündete, deren Gräuel ihren Höhepunkt in den ruhmlosen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges in China und Korea fanden. Japan selbst war in seiner 2500-jährigen Geschichte kaum äußeren Einflüssen wie Einwanderung oder Fremdherrschaft ausgesetzt. Erst die amerikanische Besatzung von 1945 bis 1952 veränderte das Land von Grund auf, hinterließ jedoch keine ethnischen Spuren – und außer ein paar Fremdwörtern auch keine Englischkenntnisse.
Heute lebt Japan als zugleich geschichtsträchtige und hochmoderne Kultur- und Industrienation in einem Zwiespalt zwischen dem Anspruch, international wirtschaftlich und politisch mitzumischen, und der Realität unüberwindlicher Grenzen; auf der einen Seite 6000 Kilometer Pazifik, gegenüber Südkorea und China, zwei Länder, die aus historischen Gründen gemieden werden. Im Norden der allerletzte Zipfel Sibiriens, und alles andere liegt weit dahinter, tausende von Kilometern entfernt. Und selbst im Zeitalter des allgegenwärtigen Fernsehens und Internets ist die große Mehrheit der Japaner vom Rest der Welt abgeschnitten, weil sie nicht oder kaum Englisch können. Alle wichtigen japanischen Medien sind von öffentlichen Geldern und vom Wohlwollen der Regierung abhängig; folglich gibt es so gut wie keine kritische Berichterstattung. Die Einwohner sind also auf jene Informationen angewiesen, die man ihnen zumutet. So hat selbst ein hochentwickelter und marktwirtschaftlich-demokratisch organisierter Staat Kontrolle über seine Bürger, die jener in diktatorischen Staaten nur unwesentlich nachsteht. Die scheinbar große Zahl japanischer Touristen in Europa ändert nichts an diesem Informationsmangel. Zum einen handelt es sich doch nur um einen sehr kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, zum anderen bleiben solche Besuche zu oberflächlich, um Denkansätze zu motivieren. Essen, Baudenkmäler, Mozart, Sisi, der Eiffelturm und das Kolosseum bilden den Inhalt solcher Reisen, isoliert von Politik, Wirtschaft und gesellschaftlicher Relevanz.
Viele DDR-Bürger, die Westfernsehen empfangen konnten, wussten mehr über die Welt als ein durchschnittlicher Japaner mit Internetanschluss heute weiß.
Ebenso wie ich bis vor wenigen Jahren kaum Kenntnisse über Japan hatte. Als ich meine Frau in Wien kennenlernte, war ich – ganz im Gegensatz zu den meisten meiner Musiker-Kollegen – noch nie in Japan gewesen. Bereits bei meinem ersten Aufenthalt fiel mir jedoch auf, dass man als Europäer in Japan immer heraussticht, obwohl man zumindest in der Großstadt heute kein Aufsehen mehr erregt. Selbst in den Geschäftszentren von Tōkyō oder Ōsaka sind nur wenige nicht asiatische Ausländer zu sehen, sogenannte »Hochnasen« (4). Die Zahl der Touristen in Japan steigt zwar, es sind aber vor allem Chinesen und Koreaner, die meist unerkannt bleiben, solange sie nicht sprechen.
(4) Nach Auffassung von Chinesen und Japanern hebt sich eine europäische Nase höher aus dem Gesicht heraus, woher die von beiden verwendete, eher abwertend gemeinte Bezeichnung »hohe Nase« [jap.: »hana-ga takai«] rührt. Ihre eigene Nase bezeichnen Japaner gerne als »niedlich« (oder meinen sie doch »niedrig«?).
Nun betrat ich also als Europäer zum ersten Mal ohne sprachkundige Begleitung ein japanisches Kaffeehaus und stellte mich in der Schlange an, um zu bestellen. Sobald mich die freundliche Dame hinter dem Tresen erblickte, weiteten sich ihre Augen, die ohnehin spärliche Farbe wich aus ihrem Gesicht. Ein Anflug von Panik machte sich breit, wahrscheinlich dachte sie:
»Hilfe, ein Amerikaner!«
Was sollte sie auch sonst denken? Die einzigen Weißen, die sie im japanischen Fernsehen ständig sieht, sind Amerikaner. Wirtschaftliche und politische Kontakte zu den USA beherrschen die Nachrichten, der Rest ist China, Korea oder Schweigen. Europa ist weit weg. So weit, dass es in den Köpfen kaum existiert.
»Hilfe, ein Amerikaner!«, dachte sie also. »Er wird jetzt sicher Englisch sprechen, und ich werde es nicht verstehen.«
Eigentlich wäre alles ganz einfach. Wörter wie »coffee«, »tea«, »hot« und »cold« versteht selbst eine japanische Verkäuferin; und alle Kassen zeigen die Summe auf großen Bildschirmen an. Es müsste also kein Wort gewechselt werden. Nun aber kam ein verrückter Europäer, der sich einbildete, sein Japanisch trainieren zu müssen, und sagte:
»Do'rippu 'kōhii-o hi'totsu one'gai shi'masu« [Ich hätte gerne einen Filterkaffee, bitte].
Das zu einem Fragezeichen mutierte Gesicht der netten Dame machte deutlich, dass die Botschaft nicht angekommen war. Wie auch. Die unverändert nette Dame kam gar nicht auf die Idee, das Gehörte könnte Japanisch sein. Sie hatte unverständliches Englisch erwartet, und was sie hörte, war für sie unverständlich. Ihrer Erwartungshaltung war voll entsprochen worden.
Japanern ist stets bewusst, wieviel Zeit und Mühe sie aufwenden mussten, die eigene Muttersprache zu erlernen und wie schwer sie sich schon mit ein paar Wörtern Englisch tun. Sie würden daher von einem Ausländer nie erwarten, dass er sich bemüht, Japanisch zu sprechen.
Schließlich sah ich vor mir eine Speisekarte liegen, deutete auf das Gewünschte, und sie sagte erfreut:
»Ah, do'rippu 'kōhii-o hi'totsu.«
»Hai« [Ja], antwortete ich – und dachte: Habe ich nicht genau das eben gesagt? Sie aber hatte mich nun ertappt, die Farbe kehrte in ihr Gesicht zurück, und mit leuchtenden Augen rief sie aus:
»Ah, 'nihon-go-o hanashi'masu-'ka?« [Ah, Sie sprechen Japanisch?]
»Su'koshi, su'koshi« [Nur ein Wenig], sagte ich sicherheitshalber, um weitere Fragen ihrerseits zu vermeiden. Ich wollte ja nur einen Kaffee bestellen, und nur darauf war ich sprachlich vorbereitet. Bloß kein weiteres Gespräch, das meine spärlichen Kenntnisse im Nu überfordern würde. Doch zu spät. Einmal des Japanischen überführt, war der Fluchtweg ins Englische abgeschnitten.
»??? ...?? ..., ??? ... mo-'ii-desu-'ka?« [.... ist das in Ordnung?]
»'Kekkō desu« [Nein, danke], antwortete ich unter Aufbietung von Lektion 5 in Band 1 meines Lehrbuches. Und werde wohl nie erfahren, was sonst noch hätte in Ordnung sein können.
Wer in Europa eines der zahlreichen asiatischen Lokale aufsucht, wird fast immer auch ein Angebot von Speisen in der sogenannten »Bento-Box« vorfinden. Diese Lunchboxen sind eine urjapanische Tradition; ganz und gar nicht japanisch ist jedoch die Idee, sie im Restaurant serviert zu bekommen. O-bentō entspringt eher dem klassischen Fastfood-Gedanken: Essen »to go«, zum Mitnehmen, allzeit bereit.
Dass der Inhalt dieser kleinen Wunderwerke japanischer Kochkunst in der Regel höchsten Ansprüchen gesunder Ernährung entspricht, lässt unsereinen mit europäischer und amerikanischer Fastfood-Erfahrung vor Neid erblassen. Eine typische bentō-Box enthält wie jede traditionelle japanische Mahlzeit gekochten Reis, gekochtes Gemüse, Fisch oder Fleisch (gegrillt oder gedünstet), eingelegtes Gemüse und nori (geröstete Algen). Kinder nehmen sie mit in die Schule, Angestellte ins Büro, Ausflügler zum Picknick, Reisende in den Zug und sogar Theaterbesucher ins Theater. Viele Boxen sind immer irgendwie unterwegs.
Es gehört allerdings zu den absoluten Tabus, seinen Schnellimbiss auf der Straße im Gehen oder stehend in der U-Bahn zu verzehren. Dasselbe gilt für den an jeder Ecke erhältlichen »coffee to go«, der in Japan eigentlich »coffee or go« heißen müsste.
Auch sushi zum Mitnehmen erfreuen sich großer Beliebtheit. Solche Boxen werden aber nicht bentō genannt und haben im Übrigen wenig Ähnlichkeit mit dem, was in europäischen Imbissbuden und Supermärkten angeboten wird.
Viele o-bentō werden zu Hause selbst zubereitet, zum Beispiel für Schulkinder. Die meisten werden jedoch von hunderten kleinen und großen Unternehmen täglich frisch in unzähligen Variationen produziert. Man kann sich unmöglich in Japan bewegen, ohne auf Schritt und Tritt auf sie zu stoßen; in jedem Supermarkt, den rund um die Uhr, 24/7 geöffneten »Convenience Stores«, an Straßenständen und Bahnhöfen, in der U-Bahnstation, und im Erdgeschoß jedes Kaufhauses.
Erdgeschoß, Rez-de-jardin, wie die Franzosen so schön sagen, Piano terra, ebenerdig – eben erdig. Was gibt es nicht für wunderbare Begriffe für die schlechteste aller Wohnlagen. Aber, nein: da gibt es ja noch das Souterrain und das Hochparterre. In Wien sind wir verschwenderisch, wir haben noch das Mezzanin (Halbstock). Zusammen mit den vier darüber gesetzten Stockwerken sind das sieben bewohnbare Ebenen. Und genau das ist der Clou. Die Wiener Bauordnung im 19. Jahrhundert erlaubte nur vier Stockwerke. Was aber nicht Stockwerk hieß, war auch keines.
Wie die meisten Ordnungssysteme in Japan ist auch die Benennung von Etagen einfach und logisch. Man beginnt dort zu zählen, wo man hineingeht – und dort ist »eins«, es gibt kein Erdgeschoß. Nach oben geht es weiter mit 2, 3, 4, ... und nach unten mit -1, -2, -3 ...
Im alten Japan gab man auch das Alter eines neugeborenen Kindes mit »1« an, 365 Tage später wurde es »2«. Obwohl diese Zählung seit 1902 offiziell abgeschafft ist, verwenden ältere Leute sie bis heute. Die Großmutter meiner Frau rühmt sich gerne ihres hohen Alters – und erschwindelt sich mit der traditionellen Zählung noch ein Jahr dazu.
Obwohl die japanische Bezeichnung von Stockwerken denkbar einfach ist (und auch in den USA, Russland und China üblich), kann einem gelernten Wiener die Gewohnheit doch Streiche spielen. Immer wieder bin ich versucht, bei der Angabe »1. Stock« eine Treppe hochzulaufen. Ich bin auch schon im Erdgeschoß in den Aufzug gestiegen, um die Taste »1« zu drücken, verwundert, dass nichts geschieht. Das ist aber ohnehin nur möglich, weil man die Zahlen im Lift wenigstens lesen kann.
Ziffern und Zahlen nicht lesen zu können, war eine der Erfahrungen, auf die ich nicht eingestellt war. Aber warum sollte eine Sprache mit völlig anderen Schriftzeichen nicht auch eigene Zahlenzeichen haben? Die arabischen Ziffern haben sich zwar weitgehend durchgesetzt, kanji-Zahlen findet man aber häufig auf Speisekarten von Restaurants und bei der Preisauszeichnung in manchen Geschäften.
In japanischen Aufzügen sind die Stockwerke in arabischen Zahlen angegeben, aber daneben gibt es immer – für Ausländer nicht identifizierbare – Tasten zum Offenhalten und Schließen der Türen. Ersteres als Geste der Höflichkeit, Letzteres als Zeitersparnis – jede Sekunde zählt. Eine ganz andere unlesbare Taste findet man in Bahnhöfen und U-Bahnstationen, wo Aufzüge oft nur zwei Haltepunkte haben, den sogenannten »homu-Knopf«. Wo aber ist »home«? Ist es der Bahnsteig oder der Ein- und Ausgangsbereich? Einmal fahren die Züge oben, ein anderes Mal im Keller. Wie soll ich denn wissen, wo der Lift beheimatet ist? Die Heimatadresse von Aufzügen ist aber noch die harmloseste Besonderheit japanischer Adressangaben.
»Ein anderer Planet«, wie meine Frau zu sagen pflegt. Das klingt beunruhigend; mit Recht. Orientierung stellt in Japan immer eine Herausforderung dar; und nicht nur wegen der Sprache.
In jedem anderen Land könnte man am Flughafen einfach ein Taxi besteigen, man könnte den Namen des Hotels nennen oder die Adresse, zu welcher man gebracht werden will, nötigenfalls in schriftlicher Form (was sich auch in Portugal empfiehlt). In Japan würde nicht einmal das zuverlässig funktionieren. Wer im Land des Linksverkehrs ein Taxi besteigt, sollte nicht nur das Ziel, sondern nach Möglichkeit auch den Weg dorthin recht gut kennen. Ins Hotel Ritz-Carlton, zum Hauptbahnhof oder zum Flughafen findet jeder Taxifahrer – vorausgesetzt, man kann ihm das Ziel verständlich machen. Jede andere, und sei es noch so genaue Adressangabe hat ihre Tücken und weist eine erstaunliche Verwandtschaft mit Venedig auf (und damit meine ich nicht das Wasser).
»Bezirk Tanimachi, Abschnitt drei, bitte«, sagte meine Frau, als wir ein Taxi in Ōsaka bestiegen.
»Wenn ich von Norden fahre, ist es gut?«, entgegnete der Taxifahrer.
»Ich denke schon.«
»Ist das schon in der Nähe von Ōsaka-Castle?«
»Es ist eigentlich schon fast bei Abschnitt vier.«
»Hier ist schon Abschnitt drei; wo soll ich fahren?«
»Vielleicht die nächste Straße rechts.«
»Rechts?«
»Ja, ich glaube – und dann bitte die zweite Straße links.«
»Es tut mir wirklich ganz besonders leid, ich bin ganz untröstlich, gnädige Frau, aber die zweite links ist unvorhergesehener Weise eine Einbahn in die andere Richtung.«
»Dann nehmen wir doch die nächste. Und dann zurück.«
»Bitte, gerne. Soll ich hier beim Supermarkt abbiegen?«
»Ich weiß nicht, ob das passt.«
»Dann nehme ich vielleicht die nächste Straße.«
»Jetzt sind wir aber doch zu weit.«
»Dann werde ich da vorne wenden.«
»Danke, wir sind schon da! Können Sie bitte neben dem Restaurant anhalten.«
Mit der Zeit habe ich auch verstanden, warum in unserem Hotel mein Wunsch nach einem Taxi immer mit dem Vorschlag quittiert wird: »Bitte gehen Sie doch vor auf die Hauptstraße. Dort fahren alle Taxis.« Was sollten sie auch sagen am Telefon? Bitte ein Taxi zum Hotel neben dem Restaurant?
Haben Japaner schon Schwierigkeiten mit der Orientierung, so kommt für den Fremden die Sprachbarriere noch erschwerend hinzu. Wer auf dem anderen Planeten völlige Unfähigkeit zu Kommunikation erwartet, ein Gefühl von Analphabetismus, Hilflosigkeit bei einfachsten Verrichtungen und plötzliche Vereinsamung, der wird nicht enttäuscht werden. So ungefähr müssen sich die Entdecker fremder Länder gefühlt haben, wenn sie darauf angewiesen waren, sich in Gebärdensprache auszudrücken.
Nehmen wir nur einmal an, man hätte die Sprache der Bewohner erlernen können. Was möchte man wissen, was könnte man erfahren?
»Wo schlaft ihr gewöhnlich?«, würde ich also fragen.
»Gewöhnlich schlafen wir nicht, wir arbeiten.«
»Und wenn ihr doch einmal gerade nicht arbeitet? Wo verbringt ihr eure Zeit, mit eurer Familie?«
»Meist zu Hause.«
»Also doch. Und was ist das für ein Zu Hause?«
»Ich habe eine Eigentumswohnung in der Stadt.«
»??«
»Ist auf Dauer gesehen die günstigste Variante.«
Vielleicht ist dieser Planet doch nicht gar so anders, als ich dachte.
»Und wo ist die Eigentumswohnung?«
»Gleich neben dem Supermarkt.«
»Welcher Supermarkt?«
»Der neben meiner Wohnung.«
»Ich meine, wie heißt er?«
»Kohyō.«
»Gibt’s sicher viele in der Stadt.«
»Ich weiß nicht. Zweihundert?«
»Aha. Und wie finde ich dann deine Wohnung?«
»Komm mit, ich zeig sie dir.«
»Ja, aber wenn ich allein kommen will?«
»Warum willst du allein in meine Wohnung, wenn ich hier bin?«
»Nein, nicht jetzt. Aber wenn du zum Beispiel zu Hause bist, und ich dich besuchen will.«
»Ja, bitte komm!«
»Aber wie finde ich dorthin?«
»Ah, das meinst du. Ich hole dich von der U-Bahn ab. Ausgang Nummer 14.«
»Wunderbar, ich verstehe! Also ihr braucht eigentlich gar keine Adressen. Ihr trefft euch einfach bei einem Fixpunkt.«
»Ja, so machen wir das.«
»Na, dann komme ich dich morgen Nachmittag besuchen. Ist das in Ordnung?«
»Ja, das passt. Morgen Nachmittag also.«
»...«
»Sumima'sen, Entschuldigung noch. Wie heißt denn die U-Bahn Station?«
»Die U-Bahn Station. ... was hilft denn ein Name ... es ist ganz einfach ... vier Stationen von meiner Firma entfernt.«
»Deiner Firma?«
»Ja, wo ich arbeite. Gleich neben dem Drogeriemarkt.«
»Drogeriemarkt!?«
»Aber kein Problem. Wenn du es nicht findest, nimm einfach ein Taxi!«
Tatsächlich benötigt man beim japanischen System von Verabredungen und Terminen nicht unbedingt eindeutige Adressen. Es gibt sie, natürlich gibt es sie. Genauso wie in Venedig – aber wer hat dort schon je eine Adresse gefunden? Die Müllabfuhr jedenfalls nicht. Anders als im systemlosen Chaos Venedigs basiert das japanische System auf einer leicht verständlichen, aber wenig hilfreichen regionalen Unterordnung, vergleichbar der allgegenwärtigen menschlichen Hierarchie; eine Art japanisches Matrjoschka-System. Dem bürokratischen Zentralismus zum Trotz kann die Gliederung regional stark voneinander abweichen.
Bei unserem Hotel in Ōsaka sieht das zum Beispiel so aus:
Präfektur (Ōsaka-fu)
Stadt (Ōsaka-shi)
Bezirk (Chuo-ku)
Viertel (Otemae)
Abschnitt (Block) (4-chome)
2-1-22 (Nummer)
Hausnummer (Nummer)
Also, jetzt reicht es aber!
Suchen Sie sich gefälligst ihr eigenes Hotel!
Die existierenden Nummern sind dem Fremden nicht schlüssig. Und fremd ist hier jeder, der außerhalb des Viertels wohnt. Nur Polizei, Feuerwehr und Briefträger kennen sich wirklich aus; Taxifahrer leider nicht. Man nützt bekannte Orte und markante Gebäude als Treff- oder Orientierungspunkt. So findet sich auch auf japanischen Visitenkarten häufig ein Anmarsch- (Anfahrts-) plan vom nächstgelegenen Bahnhof oder markanten Punkt.
Gespräch in der U-Bahn von Ōsaka:
»Haben wir heute Abend etwas vor?«, fragte ich.
»Ich habe meinen Eltern versprochen, dass wir vorbei kommen.«
»Wann?«
»Gestern.«
»Ich meine, wann sollen wir dort sein?«
»Um halb acht.«
»Kein Problem, jetzt ist es erst sechs.«
»Psst! Nicht so laut!«, ermahnte mich meine Frau plötzlich.
»Du sprichst doch genauso laut.«
»Aber niemand versteht mich.«
»Natürlich, wir sprechen Deutsch.«
»Aber dieses Wort versteht hier jeder.«
»Welches Wort?«
»Sie glauben, wir reden über Sex!«
Auf dem Weg zum Elternhaus meiner Frau kamen wir am nahegelegenen Park vorbei. Es war kurz nach Neujahr und ziemlich kalt, aber im Park herrschte ausgelassene Stimmung. Japaner lieben Feste. Es gibt ein mochi-Fest im Winter, Tanzfeste im Sommer und im Frühling das Kirschblütenfest. Japaner sagen manchmal, in Europa gäbe es keine Jahreszeiten. Das stimmt natürlich nicht. Im Waldviertel zum Beispiel gibt es den Winter, da liegt Schnee, und den Sommer, da ist es kalt. Außerdem kennt in Österreich jeder den Unterschied zwischen Winterschlaf, Frühjahrsmüdigkeit, Sommerurlaub und Herbstferien.
Aber eines stimmt schon: In Japan lebt man die Jahreszeiten bewusster. Das betrifft nicht nur die Feste, sondern vor allem auch das Essen. In keinem anderen Land sind mir so deutlich sicht- und schmeckbare Unterschiede begegnet wie hier beim saisonal wechselnden Angebot von Lebensmitteln, den Speisekarten der Restaurants und den familiären Gewohnheiten jahreszeitlich bestimmten Kochens.
Beim Betreten des Parks wurden wir argwöhnisch beäugt. Wir gehörten eindeutig nicht hier her; ich schon gar nicht. Schnell war aber die Verbindung zu meinen Schwiegereltern hergestellt, woraufhin wir herzlich willkommen geheißen wurden – beim alljährlichen mochi-Fest.
Reis genießt in Japan als Grundlage der gesamten Ernährung hohes Ansehen. Die kleinen runden Reiskuchen namens mochi in all ihren süßen und salzigen Variationen sind ein wichtiger Bestandteil des traditionellen Lebens. Die wohl bekannteste Art heißt 'daifuku, gefüllt mit einer Paste aus roten Azukibohnen und Zucker.
Auch in Europa verzehren wir bei Straßenfesten jede Menge köstlicher Dinge, gefeiert werden aber nicht das Lebensmittel an sich und dessen gemeinsame öffentliche Zubereitung. In Japan sind solche Feste nicht nur Unterhaltung, sondern auch Ritual und Verehrung. Die größte Bedeutung kommt dabei dem Ritual des Schlagens zu. Mit diesem Vorgang wird der bereits weich gekochte Reis so lange malträtiert, bis er seine Struktur aufgibt und sich die Körner zu einer klebrigen, fast unzertrennbaren Masse verbinden. Diese Aktion wird von zwei Personen gemeinsam ausgeführt. Eine Person schlägt mit einem schweren langstieligen Holzhammer beidhändig auf die große Reiskugel ein, während die andere todesmutig zwischen den Schlägen die Kugel rasch umdreht. Diese traditionelle Zubereitungsart findet man heute nur noch bei Festveranstaltungen; für gewerblich gefertigte mochi wird der Reis maschinell geschlagen, was aber der Qualität keinen Abbruch tut.
Ich war sehr erstaunt, als mir nach kurzem Zusehen ein Mann rundweg den Hammer in die Hand drückte und mich aufforderte, das Ritual fortzusetzen. Vor allem bewunderte ich das Vertrauen der Frau, die zwischen meinen Schlägen den Reis wendete.