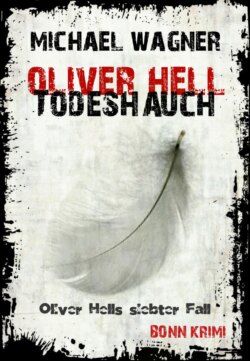Читать книгу Oliver Hell Todeshauch - Michael Wagner J. - Страница 3
Donnerstag, 12.09.2013
ОглавлениеOliver Hell lachte herzlich, legte das Handy neben sich auf dem Frühstückstisch ab und wischte sich die Krümel vom Hemd. Sie landeten auf dem Parkettboden unter dem Frühstückstisch, dort, wo schon die Krümel der Vortage auf einen Besen warteten. Sie wurden von ihren Kollegen freudig begrüßt. Nach dem Dienst würde er einen Hausputz machen. Der war wirklich dringend nötig. Seitdem Franziska das letzte Wochenende bei ihm verbracht hatte, hatte er keinen Besen oder Staubsauger in die Hand genommen. Am Freitagnachmittag würde sie schon frühzeitig ankommen, also musste er den Donnerstagabend dazu nutzen, um klar Schiff zu machen. Mit dem Frühstücksbrettchen und dem Tetra Pak mit Milch in den Händen war er schon auf dem Weg zur Küchenzeile, als das Handy auf dem Esstisch erneut klingelte. Hell stutzte, stellte die Milch auf die Anrichte und ließ das Brettchen in die Spüle gleiten. War es erneut Franziska, die ihm noch etwas zu berichten hatte? Ein Blick auf das Display verriet ihm, dass es nicht so war.
*
Der Leichnam wurde von einer Putzhilfe gefunden. Sie hatte geklingelt, so wie sie es jeden Donnerstag tat und als ihr die Tür nicht geöffnet wurde, hatte sie mit ihrem Schlüssel aufgeschlossen. So war es mit dem Hausbesitzer ausgemacht.
»Wenn ich nicht daheim sein sollte, fühlen Sie sich frei aufzuschließen, dafür haben Sie einen Schlüssel, Frau Susic.«
Sie hatte ihre Tasche in der Diele abgestellt, schon die Tür zur Besenkammer geöffnet, als sie im Augenwinkel etwas zwischen Couch und Sessel im Wohnzimmer liegen sah. Neugierig ging sie in das Zimmer, um nachzusehen. Als sie näher kam, erkannte sie einen der Hausschuhe des alten Herrn. Noch eine Sekunde lang dachte sie, dass eine solche Schludrigkeit dem alten Herrn gar nicht ähnlich sah, als sie ihn dort zwischen Tisch und Couch liegen sah. Nicht weit von seinem zweiten Filzpantoffel entfernt lag der Hausherr und sie zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass er nicht mehr lebte. Sie stieß einen spitzen Schrei aus und unterdrückte den Impuls, die Beine in die Hand zu nehmen und wegzulaufen. Sie hatte schon einige Tote in ihrem Leben gesehen. Mehr als ihr lieb war. Sie hatte ihre Großeltern sterben sehen und ihren großen Bruder. In Jugoslawien. Lange her. Dennoch fuhr ihr der Schreck gehörig in die Glieder und sie musste allen Mut aufbringen, um wieder zu der Leiche zurückzugehen. Mit einem schnellen hektischen Griff an den Hals des alten Herrn überzeugte sie sich davon, dass hier wirklich jede Hilfe zu spät kam. Nicht zuletzt das hässliche Loch in seiner Stirn ließ keinen Zweifel mehr zu. Mit zittrigen Händen fischte sie ihr Handy aus der Tasche und wählte den Notruf. Draußen vor der Haustür wartete sie auf die Ankunft der Polizei.
*
Als Hell in der Straße ankam, die ihm von der Einsatzleitung genannt worden war, sah er den Einsatzwagen der KTU dort stehen und den weißen VW-Polo von Lea Rosin. Dahinter stand ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Lea Rosin hatte ihre Hand auf dem Dach des Wagens liegen und beugte sich in das Fahrzeug hinein. Er erkannte, während er sich dem Fahrzeug näherte, dass jemand auf dem Rücksitze kauerte.
»Guten Morgen, Lea, bist du alleine?«, fragte Hell.
Rosin hob den Kopf und reichte ihm die Hand. »Guten Morgen, Chef, ja, ich bin alleine. Jan-Phillip hat sich eine ‚Sommergrippe‘ genommen. Er sagt, er müsse zum Arzt.« Sie zog die Augenbrauen hoch und wiegte den Kopf hin und her, sodass Hell sofort erkannte, was sie von der Aussage ihres Kollegen hielt.
»Na, hervorragend. Das fehlt uns noch! Klauk ist noch mitten in seiner Findungsphase und Wendt hat nun Grippe!« Hell verzog den Mund, wandte sich ab und drehte sich aber sofort wieder um. »Wer ist das?«, fragte er leise und deutete auf die Person im Streifenwagen.
»Das ist Ediba Susic, die Putzhilfe des Toten. Sie hat ihn gefunden. Es handelt sich bei dem Mann um Donatus Monzel. Komischer Name, oder?«
»Donatus ist Latein und bedeutet so viel wie ‚Von Gott geschenkt‘«, antwortete Hell und betrachtete die Frau, die zusammengekauert auf dem Rücksitz saß.
»Sie macht auf tapfer, aber ich habe vorsichtshalber den Notarzt verständigt. Sicher ist sicher«, antwortete Rosin, die den besorgten Blick ihres Chefs richtig interpretiert hatte.
»Konnte sie dir etwas sagen?«, fragte Hell.
»Nicht viel. Sie hat ihn dort gefunden, gesehen, dass er tot ist, und hat den Notruf gewählt«, flüsterte Lea.
»Okay, bleib bitte hier bei ihr, bis der Notarzt kommt«, sagte Hell und machte eine Bewegung auf das Haus zu. Rosin nickte und schenkte der armen Frau Susic auf dem Rücksitz ein Lächeln.
Unter dem Klingelknopf stand auf einem mit viel Patina versehenen Messingschild der Name Monzel. Keine moderne Gegensprechanlage, keine Kamera, nur ein simpler Klingelknopf. Das ließ darauf schließen, dass der Besitzer des Hauses auf modernen Schnickschnack keinen Wert legte. Ebenso wenig, wie auf eine moderne Sicherheitstechnik, die in den Häusern in dieser Wohngegend Standard war. Vielleicht hatte ihm diese Einstellung das Leben gekostet. Vielleicht.
Oliver Hell hatte gehofft, dass die Gerichtsmedizin schon vor Ort sei, aber weder Dr. Stephanie Beisiegel noch ihr Kollege Plaßhöhler waren zugegen. Der Eindruck, den Hell von außen gewonnen hatte, setzte sich auch im Inneren des Hauses fort. Nachdem er die schwere Eichentür mit dem Metallornament aufgeschoben hatte, empfing ihn ein breiter Flur. Der Hausbesitzer hatte sicherlich Mitte der Siebzigerjahre mit dem Kauf von neuen Möbeln aufgehört. Nicht dass das Mobiliar einen ungepflegten Eindruck machte, ganz im Gegenteil. Alles schien penibel sauber zu sein und die rustikalen Eichenmöbel wiesen fast keine Gebrauchsspuren auf. Sie schienen die letzten vierzig Jahre nicht genutzt worden zu sein. Hell ließ seinen Blick weiter schweifen, bis ihn eine Stimme ins Hier und Jetzt zurückholte.
»Der Tote liegt hier drüben, Herr Kommissar«, hörte er Julian Kirsch sagen. Der junge KTU-Mitarbeiter winkte ihn ins Wohnzimmer. Hell hob die Hand zum Gruß und beeilte sich, Julian Kirsch die Hand zu reichen. Er stand bald in einem Wohnzimmer, das der Diele in nichts nachstand. Auch hier hatte er das Gefühl, alles sei für einen Fototermin in den Siebzigern vorbereitet. Dunkle Eiche, schwere Ledermöbel und Teppiche, deren Ursprung er in Indien vermutete. Alles war sicher einst sehr kostspielig gewesen, oder war es auch jetzt wieder. Einzig der Tote wollte mit seiner Anwesenheit nicht in diese perfekte Zeitreise passen.
»Kommt dir das hier auch so vor wie in einem Museum, Julian?«, fragte Hell wie beiläufig und stützte sich auf der Lehne der Ledercouch ab.
Kirsch nickte. »Ja, das dachte ich auch zuerst. Aber eins stimmt hier nicht«, antwortete Kirsch und hob die Spiegelreflexkamera ans Auge, machte ein Foto, das er sofort auf dem Display betrachtete.
»Was denn?«
»Der Geruch. Es riecht nicht muffig. Bei meinen Großeltern roch es immer muffig und nach alten Leuten ... Sie wissen schon, was ich meine. Hier riecht es anders.«
Hell sah sich um, als könne er schnell den Grund dafür ergründen.
»Richtig, jetzt wo du es sagst«, antwortete Hell und widmete sich jetzt dem Gesicht des Toten mit der hässlichen Schusswunde.
»Er sieht beinahe erstaunt aus oder bilde ich mir das nur ein?«
»Hmh, stimmt. Jedenfalls nicht ängstlich oder gestresst.«
»Einbruchsspuren?«
Kirsch schüttelte den Kopf und machte ein Foto von den Hausschuhen des Mannes.
»Iwo, nichts, was auf ein gewaltsames Eindringen schließen ließe. Die Türen sind alle verschlossen gewesen und die Fenster intakt.«
»Also hat er seinen Mörder gekannt oder ihn zumindest ins Haus gelassen.«
Kirsch nickte erneut. »So sieht es aus.«
»Checke bitte seine Anrufe. Wer hatte zuletzt Kontakt? Das Übliche ...«, sagte Hell und erst jetzt bemerkte er einen weiteren Kollegen der KTU in dem weitläufigen Wohnzimmer. Der Mann hantierte mit einem Gerät, das auf einem großen Stativ montiert war und wie eine große Laterne aussah.
»Was macht er dort?«, fragte Hell leise und beschämt, da er keinen Schimmer hatte, was das für ein Gerät war.
»Och, der Kollege Juffing baut sein neues Spielzeug auf, einen 3D-Laserscanner.«
»Ach so, ich dachte, er sei nur Spezialist für Blutspritzer in jeglicher Ausprägung«, sagte Hell mit einem Grinsen, das von seiner Unwissenheit ablenken sollte.
»Iwo, unser Elmar ist multitaskingfähig«, sagte Kirsch augenzwinkernd.
Hell betrachtete weiter, wie der KTU-Mitarbeiter an seiner Gerätschaft hantierte.
»Elmar setzt seinen 3D-Laserscanner ein, der ein detailliertes Bild eines Tatorts aufzeichnet und diese Daten dann als begehbares Modell am Rechner darstellt. Wir als Ermittler können die Verbrechensstätte so virtuell betreten«, erklärte Kirsch noch, als Elmar Juffing sich zu Wort meldete.
»Wenn die Herrschaften jetzt den Raum verlassen würden«, rief er zu ihnen herüber.
Hell sah Kirsch verwundert an. »Wegen der Schatten«, erklärte Kirsch, »er muss unsere Körper dann hinterher wieder herausrechnen. Dann gehen wir lieber gleich aus dem Weg.«
Hell nickte und musste zugeben, dass er nicht wusste, was Kirsch ihm gerade erklärt hatte. Aber er wollte sich nicht die Blöße geben, eine weitere blöde Frage zu stellen und verließ mit Kirsch das Zimmer. Juffing stellte den Scanner an und beeilte sich, den Raum ebenfalls zu verlassen.
Hell und Kirsch betrachteten, wie der Scanner seine Arbeit verrichtete, und zuckten zusammen, als sie plötzlich von hinten angesprochen wurden.
»Na, meine Herren, was treibt ihr dort?«, fragte Dr. Stephanie Beisiegel und zog fragend eine Augenbraue nach oben.
»Hallo Stephanie, wir bestaunen modernste Kriminaltechnik im Einsatz«, antwortete Hell und konnte sich gerade noch zurückhalten, die Gerichtsmedizinerin in den Arm zu nehmen. Soweit hergestellt war ihr Verhältnis noch nicht, als dass sie es zugelassen hätte. »Ach so«, antwortete sie knapp und schob Hell ein Stück zur Seite, damit sie auch etwas sehen konnte.
»Macht uns das irgendwann arbeitslos?«, fragte sie scherzhaft.
»KTU-Drohnen, die würden uns noch fehlen«, brummte Kirsch und verzog dann doch den Mund zu einem gequälten Lächeln.
»Was haben wir?«, fragte die Gerichtsmedizinerin.
»Männliche Leiche zwischen 70 und 80 Jahren alt, Schusswunde in der Stirn, keine Einbruchsspuren. Den Rest musst du uns liefern, Stephanie.«
»Eben, wenn das Gerät aufgehört hat, dann gerne.«
»Ich stehe auf die gute alte Tatortermittlung«, fügte Kirsch noch an, in dem Moment schaltete sich der Scanner aus.
»Na, dann auf«, sagte Beisiegel und wuchtete ihre Tasche über die Schulter.
*
»Wie lange?«, fragte Hell.
»Kann ich noch nicht genau sagen. Die Leichenstarre ist noch nicht voll ausgeprägt. Lasst mir ein paar Minuten Zeit, bitte.«
Die Totenstarre beginnt bei Zimmertemperatur nach etwa 1 bis 2 Stunden an den Augenlidern, Kaumuskeln - 2 bis 4 Stunden - und kleinen Gelenken, danach setzt sie ein an Hals, Nacken und weiter körperabwärts und ist nach 14 bis 18 Stunden voll ausgeprägt.
»Und, was schätzt du?«, hakte Hell nach, obwohl er wusste, dass Dr. Beisiegel solche Fragen nicht mochte.
»Hmh«, antwortete sie und fasste dem Toten in den Nacken und ans Kinn, »ich schätze zwischen dreiundzwanzig Uhr abends und ein Uhr nachts.«
Hell fasste sich ans Ohrläppchen und rieb es.
»Der Mann sollte sein Opfer gekannt haben. Er hat erst kurz vorher verstanden, dass er in Gefahr ist. Er hat versucht zu fliehen, dabei die Pantoffel verloren«, resümierte Hell, »aber was ich nicht verstehe, diesen Schuss sollte doch jemand gehört haben. Um Mitternacht oder kurz danach, da schläft doch noch nicht jeder.«
Beisiegel zuckte mit den Schultern.
»Klinkenputzen, Oliver, Klinkenputzen!«
»Super Antwort, Stephanie. Klauk ist noch nicht wieder im Dienst, Wendt hat sich mit Grippe krankgemeldet. Vier minus zwei macht zwei. Also bleiben Lea und ich übrig!«, murrte er.
»Nicht mein Problem, Oliver, nicht mein Problem!«, antwortete Beisiegel und drehte Hell den Rücken zu.
»Danke für die Anteilnahme!«
»Gerne«, säuselte sie zurück.
Immerhin etwas, dachte Hell. Ein wenig Normalität schleicht sich doch wieder ein. Sie reagiert wieder auf ihre alte Art und Weise. Professionell und ein wenig schnippisch.
»Alles klar«, sagte Hell und räumte das Feld.
*
»Ich habe Sebi angerufen«, erklärte Lea als Hell zu ihr ans Polizeifahrzeug trat. Die Putzhilfe wurde gerade auf einer Liege in den Rettungswagen geschoben.
»Sie hat einen Schock erlitten, die Arme. Ach ja, Sebi ... der will erst das Ergebnis des Disziplinarverfahrens abwarten, bevor er wieder zum Dienst erscheint. Sorry, aber so ist es«, seufzte Lea. Hell hörte auf, das Bonbon auszuwickeln, das er noch in seiner Jacketttasche gefunden hatte.
»Der Spinner! Wir sind nur zu zweit und der Herr lässt sich bitten!«, platzte er heraus.
»Das stimmt schon, aber vielleicht kann ihn Oberstaatsanwältin Hansen da etwas beschleunigen?«
»Ich werde sie anrufen. Aber wir müssen uns erst um den Fall kümmern. Findest du bitte alles über die Angehörigen heraus? Ich versuche, etwas über den Beruf des Mannes herauszufinden. Eine solche Villa besitzt man nicht von ungefähr!«
Hell drehte sich um, blieb dann aber stehen und hob die Hand. »Wenn du jetzt dort hineingehst, bleibe mal in der Diele stehen und lasse es auf dich wirken. Dann sagst du mir bitte später, was du empfunden hast.«
Es dauerte zwei Sekunden, bis es bei Rosin klick gemacht hatte, dann nickte sie und lächelte Hell hinterher. Was hat er denn jetzt damit wieder im Sinn, fragte sie sich.
*
Auf der Fahrt ins Präsidium schwirrten zwei Gedanken durch seinen Kopf. Der erste hatte mit Donatus Monzel zu tun. Wer tötet einen wohlhabenden Rentner mit einem gezielten Kopfschuss? Wer tötet überhaupt einen Rentner? Die sollten doch mit einem Herzinfarkt im Bett sterben oder in einem Swimmingpool auf Mallorca oder den Kanaren. Aber nicht erschossen werden in einer Bonner Villengegend. Wie immer würde dieser Fall wieder mächtig Staub aufwirbeln. Daher war es wichtig, sich so schnell wie möglich ein Bild von dem Toten zu machen. Im Präsidium würde er den Namen des Mannes googeln, um etwas über ihn zu erfahren. Dann ergab sich hoffentlich bald eine Spur und eine Richtung, in die sie ermitteln konnten.
Sein anderer Gedanke galt Sebastian Klauk. Als kompaktes Duo konnten Lea und er gleich einpacken. Zu zweit in einem Mordfall zu ermitteln, war so aussichtsreich wie mit verbundenen Augen einen Hasen zu jagen. Das ging gar nicht und deswegen würde er im Präsidium sofort Brigitta Hansen informieren. Die Oberstaatsanwältin sollte ihre Beziehungen spielen lassen, um Klauk zurück in den aktiven Dienst zu holen. So schnell wie möglich.
*
Lea Rosin hatte schon eine Weile im Flur der Monzelschen Villa gestanden und die Stimmung auf sich wirken lassen. So wie Hell es von ihr verlangt hatte. Eine Zeitkapsel. Das war ihr erster Gedanke. Als diese Möbel hergestellt worden waren, war Lea noch nicht auf der Welt, selbst ihre Eltern waren damals noch Teenager. Sie drehte sich erneut um die eigene Achse, wie der Zeiger auf einem Zifferblatt. Es blieb dabei. Eine Zeitkapsel. Was war deren Inhalt? So stelle ich mir den Eingang zu einem Internat vor, einem englischen Internat. Ein Internat mit einer langjährigen Tradition, wo in einer Absolventen-Galerie die erfolgreichsten ‚Abgänger‘ aufgeführt waren. Diejenigen, die Politiker oder Anwälte oder erfolgreich in der Wirtschaft geworden waren. Sie ertappte sich dabei, verstohlen nach einer solchen Galerie zu suchen, fand natürlich keine. Kurz bevor sie in ihrer Fantasie aus einer der Türen, die von dem Flur in drei Richtungen abgingen, die ersten Schüler, in ein wichtiges Gespräch vertieft, treten sah, holte sie sich in die Realität zurück. Stattdessen ging sie mit einem Lächeln auf den Lippen auf die Tür zu, hinter der sie Stimmen vernahm. Vertraute Stimmen, keine von flaumgesichtigen Pennälern.
»Wenn das nicht Julian und Elmar sind«, platzte es aus ihr heraus, doch dann hielt sie sich sofort beschämt die Hand vor den Mund. Der Blick, den ihr Dr. Beisiegel zuwarf, sprach Bände. »Entschuldigung«, drückte sie heraus, »ich wollte nicht pietätlos sein.«
Kirsch drohte scherzhaft mit dem Zeigefinger und Rosin gab ihm zu verstehen, dass sie sich am anderen Ende des Wohnzimmers treffen sollten. Dort war allem Anschein nach ein Wintergarten angebaut.
»Hallo Julian, habt ihr schon etwas über den Beruf des Mannes in Erfahrung gebracht?«, flüsterte sie und ihr Blick fiel auf die üppigen Grünpflanzen in dem Wintergarten. »Hmh«, antwortete Kirsch und deutete mit einem Nicken an, ihm zu folgen, »ich denke, ich habe da etwas für dich.«
Fünfzehn Sekunden später machte Lea Rosin große Augen. Da war sie, die Ahnengalerie. Jedenfalls etwas, das in diese Richtung ging. Über einem riesigen Sideboard hingen unzählige gerahmte Fotos. Auf den meisten davon waren Jungen abgebildet, die vor einem monumentalen Eingangsportal standen. Auf einer Treppe aufgereiht, wie auf einem Klassenfoto. Mittig auf der unteren Einfassung saß jeweils ein Messingschild gleicher Größe. Rosin beugte sich über das Sideboard, um die Schrift zu entziffern. ‚Jahrgang 1977‘ stand auf dem ersten Schild, ‚Jahrgang 1978‘ auf dem daneben. Auf jedem dieser Fotos stand hinter den Kindern immer dieselbe Person.
»Ist das der Tote?«, fragte Rosin. Kirsch deutete auf ein Foto, das weiter rechts in der Galerie hing und zwei Personen zeigte. Eine der beiden Personen kam Rosin bekannt vor, konnte sich aber an dessen Namen nicht erinnern.
»Das ist der damalige Innenminister Werner Maihofer, der zu Besuch in diesem Kinderheim war«, erläuterte Kirsch.
»Kinderheim?«, fragte Rosin erstaunt, »kein Internat?«
Kirsch schüttelte den Kopf und zeigte auf ein Foto, das direkt daneben hing. Auf dem kleinen Messingschildchen stand der Name des Kinderheims: ‚Albertus-Magnus-Haus‘.
»Also ist unser Toter ein bekannter Mann und er war der Leiter dieses Kinderheims?«
»So scheint es zu sein«, sagte Kirsch und deutete auf ein weiteres Foto. Dieses zeigte den Leiter des Heims mit einem der Kinder, dem er väterlich die Hand auf die Schulter legte.
»Ein ehemaliger Leiter eines Kinderheims wird in seiner Wohnung ermordet. Habe da nur ich eine unheilige Assoziation in Richtung Pädophilie und später Rache?«, fragte Rosin und Kirsch zuckte nur mit den Schultern.
»Ich hoffe nicht«, antwortete er dann doch und ließ Rosin vor der Galerie stehen. Rosin seufzte vor sich hin. Irgendwann musste es ja mal so weit sein und ihr ein Fall mit pädophilem Hintergrund begegnen. Dann rief sie sich zur Ordnung. Eine Hand, die auf der Schulter eines Jungen lag, gab noch keine eindeutige Richtung vor. Soweit sie das bis jetzt beurteilen konnte, hatte der Tote sein Leben den Waisen gewidmet. Es war schon schlimm, dass man sofort einen solchen Hintergrund ins Kalkül zog.
Schäm dich, Lea!
Sie seufzte erneut und zog ihr Handy aus der Tasche.
»Hallo, hier ist Lea. Der Tote war der Leiter eines Waisenhauses in Bonn, und dass sogar ziemlich lange«, plauderte sie los als Hell sich meldete.
Eine halbe Stunde später verließ Lea Rosin den Tatort. Sie hatte noch einen mündlichen Bericht von Stephanie Beisiegel im Gepäck, die mit ihr zusammen das Haus verließ. Der Tote wies neben der Schussverletzung keine weiteren Verletzungen auf. Er war nicht bewegt worden, die Totenflecken waren stark ausgeprägt. Der Tod war sofort eingetreten, und zwar gegen Mitternacht. Nichts war sonst noch gefunden worden, was die anstehenden Ermittlungen erleichtert hätte.
Julian Kirsch hatte sie noch in das Arbeitszimmer des Toten geführt. Sofort wurde ihr klar warum. Dort hatte jemand etwas gesucht und offenbar auch sehr schnell gefunden. Dieses Zimmer besaß denselben Charme wie der Eingangsbereich und das Wohnzimmer. Alt, bewohnt, aber nicht muffig und verwohnt. Der Schreibtisch war ordentlich aufgeräumt. Ihr am nächsten stand etwas, das sie nicht kannte. Sie ging darauf zu und betrachtete den Gegenstand. Er war aus Eichenholz - woraus auch sonst - besaß eine Ablage, in der mehrere ihr unbekannte Schreibgeräte lagen und zwei Klappen. Sie öffnete eine der Klappen und entdeckte darunter ein Tintenfass.
»Sind das Federkiele?«, fragte sie Kirsch.
»Ja, ich kenne so etwas auch nur aus dem Antiquariat. Wer schreibt denn heute noch mit Federkiel und Tinte?«
»Benutzen das nicht Leute, die Kalligrafie betreiben?«
»Weiß ich nicht, da gibt es spezielle Federn und Aufsätze, glaube ich.«
Rosin sah sich weiter in dem Raum um. Die gleichen düsteren Vorhänge wie in den anderen Zimmern. Hier hat einer die Meterware Stoff gleich im Dutzend verarbeitet, dachte sie. Hinter den Schreibtisch standen zwei große Aktenschränke, akkurat gefüllt mit uniformen Ordnern. Die Hälfte der Ordner aus dem Schrank links neben dem Schreibtisch lag allerdings jetzt auf dem roten Teppich davor. Dieses Chaos wollte nicht zur allgemeinen Aufgeräumtheit der Wohnung passen. Nein, es sah sogar aus wie ein gewaltsamer Einbruch in den Frieden des Hauses. Ebenso wie der Tote, der hinter der schweren Eichentür lag.
»Das dauert eine Weile, bis wir da durch sind und einen Einblick gewonnen haben«, sagte Kirsch mit herunterhängenden Mundwinkeln.
»Geht es langsam an. Es hat keinen Zweck, wenn ihr euch beeilt und dann etwas überseht«, sagte Rosin, um ihren Kollegen zu beruhigen.
»Das sag mal dem Wrobel, der will doch immer alles schon gestern haben«, antwortete der Tatortermittler, hob die Arme und ließ sie mutlos wieder sinken.
»Alles wird gut, Julian, alles wird gut!«
Kirsch schob die Unterlippe hervor und produzierte so etwas wie ein Lächeln.
»Was ist eigentlich mit Sebastian? Wie geht es seiner Cousine? Habt ihr etwas gehört?«
Rosin schüttelte den Kopf. Was sollte sie ihrem Kollegen antworten? Wo sie doch selbst nicht wusste, was in Klauks Kopf herumging.
»Ich kann es dir nicht sagen, Julian, echt nicht.«
Er sah ihr fest in die Augen. »Sag ihm, er soll keinen Scheiß machen. Wir brauchen ihn!«
»Werde ich machen«, antwortete Rosin. Sie spürte, dass ihr Kollege ihr noch eine Frage stellen wollte, doch er verkniff es sich.
»Wir halten euch mit dem hier auf dem Laufenden«, sagte er mit einem Kopfnicken zu dem Aktenchaos hin.
»Danke«, antwortete Rosin, die keine Lust verspürte, die Aufgabe des Kollegen zu übernehmen.
Als Rosin sich in ihren VW-Polo setzte, wurde der Metallsarg mit dem Toten in ein Fahrzeug der Gerichtsmedizin gehoben und nach Bonn in die Stiftsgasse gebracht. Dort würde Dr. Beisiegel mit der Leichenschau beginnen. Es hatten sich gottseidank keine Gaffer eingefunden, auch keine Reporter. Die wenigen Passanten, die vorbeigekommen waren, waren von den Streifenbeamten weitergewunken worden. In Gedanken versunken fuhr sie los. Sie stellte sich ihr Wochenende vor. Freitag, nach dem Aikido-Training, wollte sie mit einer Freundin durch die Gemeinde ziehen, eine neue Kneipe besuchen. Am Samstag wollte sie ausschlafen, sich dann mit den frischen Frühstücksbrötchen und einem Kaffee wieder ins Bett kuscheln. Nach einer Dusche würde sie dann vielleicht zu Christina Meinhold hinübergehen, wenn diese Zeit hatte und nicht wieder für ihre Zwischenprüfung lernen musste. Das hatte sie vorgehabt. Doch wie es jetzt aussah, würde das Wochenende nur eine trostlose Verlängerung der Arbeitswoche sein. Verhöre und Gespräche mit den Nachbarn und Angehörigen standen an. Ihre Wochenendplanung passte schlecht zu der alten Polizeiweisheit, dass die ersten Stunden einer Ermittlung immer die wichtigsten waren.
Doch wohin sollten sie ermitteln? Dem ganzen Fall haftete schon jetzt eine Rätselhaftigkeit an und es schien ihr nur zwangsläufig so zu sein, dass sich die Ermittlungen in die Länge ziehen würden. Daher war es sehr wichtig, das direkte Umfeld des Täters zu durchleuchten. Verwandte und Nachbarn. Irgendwo keimte noch immer ein Fünkchen Hoffnung, neben der Arbeit an diesem Wochenende noch ein paar Stunden Privatsphäre herausschlagen zu können.
*
Eine Stunde später saßen sie gemeinsam im Besprechungsraum vor einer noch leeren Glaswand, auf der der Name Donatus Monzel stand. Darunter das Geburtsjahr und der Name des Waisenhauses. Hell hatte schon herausgefunden, dass dieses Waisenhaus Ende der neunziger Jahre geschlossen wurde.
»Julian checkt die Telefondaten der letzten Tage und sie suchen nach lebenden Verwandten. Das ist schwierig, weil Donatus Monzel allem Anschein nach keinen Computer besaß. Alles scheint schriftlich festgehalten worden zu sein«, erläuterte Lea.
Hell zog die Augenbrauen hoch.
»Gibt es so etwas heute noch?«
»Allem Anschein nach schon«, antwortete sie. »Sagen Sie mal, Chef, haben Sie Sebi erreicht oder mit Hansen gesprochen?«
Hell schaute weg, als könne er sich dadurch vor einer Antwort drücken.
»Hansen will sehen, was sie tun kann. Wir erhalten aber Unterstützung von einer anderen Abteilung«, sagte er in einem Tonfall, der nichts Gutes erahnen ließ.
Rosin zog die Stirn kraus. »Nein, oder? Niemand aus Lessenichs Team?«
Hell verzog den Mund nach rechts und anschließend nach links. »Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Wir bekommen Akuda als Unterstützung. So lange, bis Klauk wieder im Dienst ist.«
»Akuda?«, fragte Rosin erstaunt. »Und was ist mit seiner eigenen Abteilung? Wie heißt das noch gleich ... ‚Sonderdezernat für Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung‘!«
»Eben nur so lange, bis Klauk wieder im Dienst ist«, sagte Hell erneut.
»Ach ja, und wenn das noch einige Wochen dauert?«
Hell hob die Schultern und ließ sie wieder sinken. »Ich bin froh über jeden Mann!«
Er stand auf und ging zur Kaffeemaschine hinüber.
»Ich kann den Neuen noch nicht richtig einschätzen«, sagte Rosin nachdenklich.
»Auch einen?«, rief Hell aus seinen Büro, Rosin nickte.
»Er hat Klauk den Arsch gerettet und man hat ihn in Hamburg nicht mehr haben wollen, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Wohin sollte er besser passen als in unser Team?«
Das Rumpeln des Mahlwerks gab Lea Zeit zum Nachdenken.
Das Mahlwerk verstummte und stattdessen brummte die Maschine jetzt leise vor sich hin. »Ich bin kein Rassist, bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber ich kann in seinem Gesicht nichts lesen. Er trägt ein Pokerface und ist nicht durchschaubar in dem, was er sagt.«
Hell erinnerte sich daran, dass er Akuda noch nicht vor ganz zwei Wochen für einen Spitzel des abgesetzten Staatsanwalts Überthür gehalten hatte. Dabei hatte er die ganze Zeit über Klauk observiert und ihm das Leben gerettet. Also konnte er kein übler Kerl sein. In dem Moment fiel ihm auf, dass er nicht wusste, welcher Staatsanwalt ihnen jetzt zugeordnet wurde.
»Lea, weißt du, welcher Staatsanwalt mit dem Fall ‚Monzel‘ betraut ist?«
Lea schüttelte den Kopf und nahm die Tasse entgegen, die Hell ihr reichte.
»Der Fall ‚Donatus‘ gefällt mir besser. Aber nein, ich weiß nicht, wer zuständig ist, nachdem unser Quälgeist Überthür uns verlassen hat. Der war ja eine stete Konstante im Schlechten.«
Hell lachte laut auf, dann drückte er auf den Knopf der Kaffeemaschine und betrachtete den Kaffee, der in seine Tasse floss.
Eine Konstante im Schlechten!
Lea hatte recht. Überthür war ein intriganter und hinterlistiger Mistkerl gewesen, aber auf seine Art durchschaubar. Wer ihnen aus dem meist überlasteten Pool der Staatsanwaltschaft jetzt zugelost wurde, war entweder ein Glücksfall oder exakt das Gegenteil. Die Bonner Staatsanwaltschaft war genau wie die Kriminalpolizei und jede normale Dienststelle total überlastet. Und über allen standen noch Kürzungen im Etat, mit der viele Kollegen hausieren gingen. Der neue Bonner Polizeichef wollte seine Zahlen schönen und bei seinem Dienstantritt schon für klare Verhältnisse sorgen. Dem sahen alle Dezernate mit Sorge entgegen.
Der ehemalige Staatsanwalt Überthür war nicht mehr im Pool. Durch seine Intrigen hatte er sich so aufs Abstellgleis gestellt, dass er froh sein konnte, wenn er noch eine Anstellung als Sicherheitskraft fand. Keine Staatsanwaltschaft in ganz Deutschland würde ihm noch vertrauen. Schachmatt.
Hell nahm seinen Kaffee in die linke Hand und wischte mit der Rechten den Nachnamen des Opfers weg. Dann betrachtete er dessen Vornamen.
»Was ist das für ein seltsamer Heiliger, der sich nachts in seinem Wohnzimmer erschießen lässt?«
Mit einem Lächeln betrachtete Lea Rosin ihren Chef.
»Wer weiß, vielleicht war er krank oder er hielt es für gerechtfertigt, wenn man ihn erschießt. Wenn es wirklich ein Fall von später Rache wegen sexueller Übergriffe war?«, dachte Lea laut nach.
»Nein, Lea, dann hätte er seine Pantoffel nicht verloren. Er wollte fliehen, aber der Mörder war schneller. Aber checke bitte vorsichtshalber seine Krankenakten. Mit dem Ergebnis der Obduktion haben wir dann ein Bild seines Gesundheitszustandes.«
Lea seufzte und wechselte das Thema.
»Haben wir schon herausgefunden, ob er Verwandte hat?«
Hell ließ sich im Sessel zurücksinken und fragte sich, ob es ebensolche Menschen waren wie der Tote. Er schüttelte den Kopf. Du weißt noch gar nichts über den Mann und fängst schon an, Mutmaßungen zu stellen. Eilig sprang er wieder auf und schrieb mit dem Marker zwei Worte auf die Glasscheibe. Verwandte? Gesundheit? Jeweils mit einem Fragezeichen.
»Ich kümmere mich um Punkt eins, du dich um Punkt zwei.« Er legte den Marker zurück in die Glasschale und musterte Lea Rosin mit einem Blick, der so etwas wie ein verbissenes Lächeln war.
*
»Würden Sie uns ein paar Fragen beantworten?«, sagte Lea Rosin und zückte zum x-ten Mal an diesem sonnigen Nachmittag ihren Dienstausweis. Bei Familie Plöttner, vor deren Haustür sie nun standen, erkundigten sie sich zum vierten Mal in der unmittelbaren Nachbarschaft der Monzelschen Villa. Mehr direkte Nachbarn gab es auch nicht, außer einem, dessen Haus schräg gegenüber der alten Villa lag. Klinkenputzen.
»Fragen?«, wiederholte der Mann an der Tür. Er drehte sich um und rief nach seiner Frau. »Kommst du mal bitte. Hier ist die Polizei und hat Fragen!«
Dann schaute er von Rosin zu Hell und wieder zurück, bis sein Blick zwischen den beiden ins Leere ging. Er schien erst wieder zum Leben zu erwachen, als seine Frau ihn zur Seite drängte und die beiden Beamten mit dem gleichen skeptischen Gesichtsausdruck anstarrte wie zuvor ihr Mann.
»Guten Tag, wir sind hier, um ein paar Auskünfte über ihren Nachbarn Donatus Monzel einzuholen«, erläuterte Rosin in ihrem gewinnenden Tonfall.
Sofort veränderte sich der Gesichtsausdruck der Frau.
»Monzel? Der Stinkstiefel? Hat ihn endlich der Teufel geholt? Das geschieht ihm recht!«
Die Frau trug eine alte verschlissene Schürze mit einem nicht sonderlich fantasievollen Blümchenmuster, das aber farblich hervorragend zu ihrem rosa Teint passte.
»Sie habe ihren Nachbarn nicht gemocht? Gab es Streit mit ihm?«, fragte Rosin weiterhin sehr höflich.
»Nein, es gab keinen Streit. Den mag hier nur keiner. Was ist denn mit ihm passiert?«, fragte die Frau und wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab.
»Ihr Nachbar ist tot. Das sollte Ihnen erst einmal reichen«, mischte sich Hell in das Gespräch ein.
»Um den ist es nicht schade«, stieß die Alte hervor und erntete dafür einen Seitenhieb ihres Mannes.
»Was denn? Ich habe doch recht«, wehrte sie sich gegen die Kritik ihres Mannes.
Hell wunderte sich, dass er überhaupt zu einer solchen Kritik an seiner Frau imstande war.
»Ihnen ist schon klar, dass Sie sich mit diesen Worten als erstklassige Tatverdächtige präsentieren, Frau Plöttner?«
Hell hatte seine Stimme erhoben und seine Worte verfehlten ihren Zwecke nicht.
»Tatverdächtige? Ich? Sind Sie verrückt?«
Die rosa Gesichtsfarbe wich einem sehr bleichen Weiß. Sie trat mit offenstehendem Mund einen Schritt zurück und trat ihrem Mann dabei auf den Fuß. Der offene Mund brachte ein strahlend weißes Gebiss zum Vorschein. Irgendwo muss das Geld ja investiert werden, dachte Hell. Wenn schon nicht in ordentlicher Kleidung.
»Nein, ich bin nicht verrückt. Ihr Nachbar ist letzte Nacht in seinem Haus erschossen worden und wir wollen jetzt von Ihnen beiden wissen, ob Ihnen zwischen 23 Uhr und 2 Uhr nachts etwas Verdächtiges aufgefallen ist!«
Die beiden Alten rissen die Augen auf. Jetzt hatte Hell ihre volle Aufmerksamkeit.
»Erschossen?«, fragte Frau Plöttner mit erstickter Stimme und fasste sich an den Hals. Sie hatte vor ihrem Mann die Beherrschung wiedergefunden. Hell und Rosin nickten zur Bestätigung. Herr Plöttner schüttelte den Kopf, während seine Frau nachzudenken schien. »Hast du etwas gehört, Karl-Heinz?«, fragte sie schließlich. Plöttner wiederholte das Kopfschütteln.
»Nein, Herr Kommissar, wir haben nichts gehört«, antwortete sie für sich und ihren Mann gleich mit, der mit dem Kopfschütteln nicht aufhörte.
»Das hat er nun doch nicht verdient«, stieß er zwischen spitzen Lippen hervor und hörte endlich mit dem Kopfschütteln auf.
Das sich die beiden Alten plötzlich nicht mehr wohl fühlten in ihrer Haut, kam Hell ganz recht. Daher wunderte ihn ihre nächste Frage überhaupt nicht.
»Waren das Einbrecher?«
»Wir stehen am Anfang der Ermittlungen und dürfen daher nichts ausschließen«, antwortete Hell und er wusste genau, dass die beiden in den nächsten Nächten einen sehr unruhigen Schlaf haben würden.
»Eine Frage habe ich noch«, sagte Lea und warf Hell einen listigen Seitenblick zu, »Sie kennen sich doch sicher gut in der Nachbarschaft aus. Welcher Ihrer Nachbarn ist denn ein Nachtschwärmer? Wissen Sie, meine Oma, die weiß ganz genau, wer wann den Fernseher ausschaltet. Wer von den Nachbarn könnte denn zusammen mit meiner Oma nachts am Fenster sitzen?«
Leas Frage war geschickt gestellt, hatte aber auch einen Haken. Einerseits würden die Plöttners zugeben, selber auf die Nachbarschaft ein Auge zu halten, andererseits konnten sie so den schwarzen Peter an die Nachbarn weitergeben.
Die beiden warfen sich fragende Blicke zu, bis Frau Plöttner schließlich auf das Haus schräg gegenüber zeigte. »Dort, die sind noch die Jüngsten hier in der Straße und die Kinder sind oft nachts unterwegs.« Sie sagte das mit einem bedauernden Unterton.
»Wie heißt diese Familie?«
»Steiner«, kam es bei beiden wie aus der Pistole geschossen.
Sie sahen sich erstaunt an und diesmal nickten beide.
»Vielen Dank und wir bitten noch einmal um Entschuldigung«, säuselte Lea wieder höflich.
»Das macht doch nichts, kleines Fräulein«, sagte Frau Plöttner und Lea verzog ihren Mund, sobald sie sich zum Gehen gewandt hatten.
»Kleines Fräulein«, äffte sie Frau Plöttner nach, »meine Oma würde mit denen noch nicht einmal an der Mülltonne reden.«
Hell grinste.
»Wenn dort bei den Steiners auch niemand etwas gehört hat, müssen wir davon ausgehen, dass der Täter einen Schalldämpfer benutzt hat«, erläuterte Hell, als sie durch den Garten zurück zur Straße gingen.
»Profis benutzen einen Schalldämpfer«, sagte Rosin und öffnete das Gartentörchen.
»Dann wurde er von einem Profi ermordet«, antwortete Hell und trat hinaus auf den Gehweg.
»Welcher Profi ermordet einen ehemaligen Leiter eines Kinderheimes?«
»Ein wütender Profi!«, antwortete Hell und schaute nach links die Straße hinunter, bevor er sie überquerte.
*
Sebastian Klauk konnte zwar schätzen, was ihn erwarten würde, dennoch hatte er ein komisches Gefühl als er seinen neuen Mini-Countryman vor dem Haus parkte, in dem seine Cousine Irina Lanau wohnte. Noch nie hatte er dieses Gefühl gehabt, wenn er seine Lieblings-Cousine besuchte. Mit Irina verband er Heiterkeit und Lebensfreude. Diesmal war es anders. Am Morgen hatte er mit klopfenden Herzen den neuen Mini beim Autohändler abgeholt und eine lange Ausfahrt mit dem spritzigen Diesel gemacht. Nein, eigentlich war der Mini nicht neu, sondern ein Jahreswagen. Auf einen ähnlich oder gleich ausgestatteten Neuwagen hätte er ein halbes Jahr warten müssen. Dieser Mini stand auf dem Verkaufsplatz des BMW-Händlers in Bonn und Klauk hatte sich sofort verliebt. Kurzentschlossen hatte er den Mini gekauft.
Jetzt stand er genau dort, wo er schon hundert Mal seinen VW-Golf geparkt hatte. Der war sicher schon in der Schrottpresse gelandet, nachdem er in St. Augustin bei einem Unfall einen Totalschaden erlitten hatte. Weil Klauk in diesen Unfall verwickelt wurde und er nicht zur Verabredung mit seiner Cousine kommen konnte, fuhr diese alleine mit ihrem Mountainbike los und wurde das Opfer des ‚Siegsteig-Killers‘, der Wochen zuvor sein Unwesen auf den Wanderwegen getrieben hatte. Sie überlebte die Gefangenschaft schwer verletzt und war gestern aus dem Krankenhaus entlassen worden. Jeden Tag hatte Klauk sie im Krankenhaus besucht, was ihm dadurch möglich war, dass er noch vom Dienst suspendiert war. Ihre gebrochenen Rippen und ihre anderen Verletzungen würden schnell verheilen. Doch ihre verletzte Seele nicht.
Von seinen Kollegen hatte Klauk erfahren, unter welchen Umständen Irina im Trainingsraum des Killers gefangen gehalten worden war. Festgeschnallt auf einer Pritsche. Er hatte sich nicht an der jungen Frau vergangen, doch hatte sie mit ansehen müssen, wie der Mann seine Frau tötete. Diese Bilder verfolgten sie jede Nacht. In der Dunkelheit ihres Schlafzimmers wachte sie schweißgebadet auf, sah im Traum Carina Quade sterben. Seitdem schlief sie mit Licht. Die Träume blieben.
Klauks Verletzungen, die er bei dem Unfall erlitten hatte, waren längst abgeklungen. Sein Schleudertrauma war vergangen, die Rippenquetschungen ebenfalls. Doch auch Klauks Seele hatte gelitten. Nicht nur, weil Irina in die Gewalt von Gregor Quade geraten war, nein, vor allem, weil er sich die Schuld daran gab. Sie hatte ihm gesagt, dass er nichts dafür konnte und auch nichts hätte dagegen tun können. Es war Schicksal. Klauk konnte diese Ansicht nicht teilen. Er war sicher, dass Quade sie nicht gequält hätte, wenn er nicht erfahren hätte, dass er Polizist war. Das wiederum stritt Irina strikt ab. Diese ganze Gefühlslage brachte Klauk dazu, an seinem Beruf zu zweifeln. Wollte er noch Polizist bleiben? Würde er es noch ertragen, solchen Menschen wie Gregor Quade hinterherzuhetzen? Sie zu jagen, sie zur Strecke zu bringen? Daher zögerte er, daher hatte er auch heute Oberstaatsanwältin Brigitta Hansen gebeten, ihm noch Zeit zum Nachdenken zu geben. Doch wie lange konnte er das noch tun? Sein Team brauchte ihn. Kommissar Hell hatte ihn ebenfalls angerufen, er hatte ihn weggedrückt.
Schweren Herzens.
Oliver Hell. Sein Chef. Sein Vorbild. Gerne hätte er einen Vater wie ihn gehabt. Streng, aber gerecht, verbissen in der Verfolgung von Straftätern, aber auch ein hervorragender Lehrer, ein einfühlsamer Ermittler und der beste Kriminalist, den Klauk bisher erlebt hatte. Aber Hell war nicht sein Vater. Sein Vater hatte ihm am Telefon Vorwürfe gemacht. Mal wieder. Diesmal, weil Irina verletzt worden war. Weil Gregor Quade sie gequält hatte. Als könne Klauk etwas für die Psyche der Verbrecher, die er verfolgte. Sein Vater war das genaue Gegenteil von Oliver Hell. Aber er war sein Vater. Punkt.
Mit klopfendem Herzen drückte Klauk auf die Klingel.
*
Allein zuhause schaute Irina Lanau aus dem Fenster, so wie sie es schon den ganzen Tag getan hatte, seitdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Ihr Blick ging über die Stadt, über Straßen und Dächer der Häuser in der Nachbarschaft, über die Bäume im angrenzenden Park bis hin zu den beiden höchsten Häusern Bonns, dem Post-Tower und dem ‚Langen Eugen‘, wie das ehemalige Abgeordnetenhochhaus liebevoll genannt wurde. Über allem lag seit dem Morgen ein grauer Dunst, der alles in eine konturenauflösende Decke hüllte. Das Siebengebirge auf der anderen Rheinseite schien sich mit dem Himmel zu vereinen. Seit Tagen war der Himmel nur blau gewesen, doch jetzt kündigte sich ein Wetterwechsel an. Der Sommer schien zu Ende zu gehen. Als sie ihren Blick senkte, sah sie einen rot-weißen Mini-Countryman durch die Straße rollen. Erst als der kleine Wagen vor ihrer Tür parkte, fiel ihr ein, wer das war. Es war Klauks neues Auto. Das musste sie sich erst einprägen. Jahrelang hatte ihr Cousin diesen VW-Golf gefahren. Bis zu diesem tragischen Unfall. Doch nicht nur das Auto hatte sich geändert. Seit diesem verhängnisvollen Tag hatte sich auch ihr Leben geändert. Sie biss sich unbeabsichtigt auf die Zähne und verspürte sofort den ihr mittlerweile vertrauten Schmerz. Gregor Quade hatte ihr den Kiefer gebrochen. Man hatte ihr versprochen, dass die Wunde, die bei der Operation entstanden war, in ein paar Tagen abgeheilt sein würde. Doch der Schmerz begleitete sie immer noch. Sie durfte keine feste Nahrung zu sich nehmen, nur trinken und irgendeinen elenden Brei löffeln. Und sprechen konnte sie auch nur mit Mühe und unter Schmerzen. Daher kam ihr Klauks Besuch nicht wirklich gelegen. Sie würden sich unterhalten. So wie sie es immer taten, wenn er bei ihr war. Sie hatten immer viel gelacht. Aber heute würden sie nicht lachen. Auch ihr Blickwinkel ihrem Cousin gegenüber hatte sich geändert. Wenn sie ehrlich zu sich war, dann war es so. Und sie fühlte sich schuldig dabei. Klauk konnte nichts dafür. Er hatte einen Unfall, den er nicht selbst verschuldet hatte. Er hatte sie sofort angerufen, sobald es ihm möglich war, um ihr von dem Unfall zu berichten. Dass er damit den ‚Siegsteig-Killer‘ auf ihre Spur bringen würde, konnte Klauk nicht ahnen. Doch so war es gekommen. Gregor Quade hatte sie bemerkt, betäubt und entführt. Hatte sie tagelang in seinem Trainingsraum im Keller seines Hauses gefangen gehalten und sie gezwungen, den Mord an seiner Frau mit anzusehen. Einen bestialischen Mord. Seitdem sie Zeuge dieses grauenvollen Gemetzels geworden war, verfolgten sie diese Bilder. Immer, wenn sie die Augen schloss. Nachts kamen die Albträume. Immer wiederkehrende Albträume. Sie wollte nicht mehr schlafen, nicht die Augen schließen. Dann kamen diese Bilder. Nächste Woche hatte sie ihren ersten Termin bei der Psychologin, wenn sie bis dahin wieder richtig sprechen könnte. Nie hatte sie gedacht, dass sie einmal auf einer Psychologencouch liegen würde. Irina Lanau doch nicht. Die lebenslustige und quirlige Irina brauchte keine Psychologin. Oh doch. Und wie sie eine brauchte.
Ich glaube, ich nehme Sebastian ganz fest in den Arm und drücke ihn, dachte sie, als die Türklingel läutete. Würde das so einfach sein? Sie drehte dem Fenster den Rücken zu und schlurfte mit ihren Kinderpantoffeln, die ihr Klauk geschenkt hatte, über den Flur. Weiße Pantoffel, die wie ein Hund aussahen. Mit Knopfaugen und großen schwarzen Ohren.
*
»Ich muss doch heute Nachmittag noch ins Büro«, erklärte Julia Deutsch mit einer Handbewegung zum Bildschirm ihres Computers hin.
Jan-Phillip Wendt gab ein jämmerliches Husten als Antwort zurück. Er lag auf der Couch im Wohnzimmer, dick in eine Decke eingemummelt und litt still vor sich hin.
»Och, mein armer Schatz, bist du sterbenskrank? Soll ich den Notarzt holen?«, fragte sie keck, stand von ihrem Bürostuhl auf und kam zur Couch herüber. Wendt folgte ihr mit einem leidenden Blick und hustete erneut.
»Du kannst mich nicht alleine lassen«, röchelte er und sah jetzt noch erbarmungswürdiger aus als zuvor.
»Dieser Blick! Jeder Dackel wäre neidisch darauf!«, sagte sie, setzte sich neben Wendt auf die Couch, legte ihm die Hand auf die Stirn. Sie zog die Hand schnell wieder weg und tat so, als hätte sie sich an seiner Stirn verbrannt, sog schnell die Luft ein. »Hoffnungsloser Fall«, murmelte sie und schüttelte besorgt den Kopf. Wendt erhob sich langsam und mit einem Stöhnen.
»Können sich diese Leute nicht ohne dich scheiden lassen? Oder wenigstens den Anstand besitzen zu warten, bis ich nicht mehr todkrank bin?«
Er griff nach dem Päckchen Taschentücher, das auf dem Couchtisch lag, faltete langsam eines auseinander und schnäuzte sich geräuschvoll. Julia beobachtete ihn mit verschmitztem Gesichtsausdruck.
»Ich muss leider dorthin, schon alleine, um mir weiterhin deinen immensen Taschentuchkonsum leisten zu können!«, sagte sie leicht vorwurfsvoll und deutete auf den Berg Taschentücher, die vor der Couch lagen.
»Man soll ein Taschentuch nur einmal benutzen, wegen der Viren«, protestierte Wendt.
»Man könnte die Dinger auch entsorgen, damit die Viren nicht zurück auf die Couch hüpfen«, sagte sie belustigt und stand auf. »Ich fasse sie nicht an, das musst du selbst erledigen.«
Zehn Minuten später hörte er, wie Julia seinen Mazda MX5 anließ und davonfuhr. Auf dem Tisch neben ihm stand eine dampfende Tasse Erkältungstee. Er beugte sich vor, um den Teebeutel herauszunehmen und ließ ihn kurzerhand auf den Stapel Taschentücher fallen. Bei jeder Bewegung hatte er das Gefühl, seine Schädeldecke würde sich heben. Julia nahm ihn nicht ernst.
»Pfleg deinen Männerschnupfen. Ich bin in drei Stunden wieder zurück«, hatte sie ihm noch aus dem Flur zugerufen. Sein Protest ging in einem Hustenanfall unter, begleitet von erneutem Schädeldeckenheben. Er nahm einen Schluck Tee, verzog den Mund, weil Julia den Zucker vergessen hatte, stellte den Tee beiseite. Stattdessen fingerte er nach der Fernbedienung des Fernsehens und zappte erst einmal alle Programme durch. Nichts interessierte ihn und auch die Lautstärke dröhnte in seinem Kopf. Er schaltete den Ton aus und sah nur die Bilder, schaltete den Fernseher kurz darauf wieder aus. Eigentlich will ich nur dösen, dachte er. Und diese Scheißgrippe loswerden. Verdammt. Er legte die Fernbedienung zurück auf den Tisch und fingerte nach seinem Handy, das unter der Fernsehzeitung lag. Er drückte eine Kurzwahltaste, ließ sich auf das weiche Sofakissen sinken und lauschte dem Klingelton.
»Hallo, hier ist Jan-Phillip«, sagte er, als er die Stimme seines Chefs hörte, »ich wollte nur mal hören, wie ihr so ohne mich klarkommt.«
»So lala«, antwortete Hell und formte mit den Lippen den Namen Wendt, weil Lea Rosin neugierig fragte, wer am Telefon sei.
»Wir sind gerade dabei, die Arbeit zu delegieren und die ersten Ergebnisse der Ermittlung zusammenzutragen.«
»Und?«
»Noch nicht viel. Wir müssen mit Nachbarn, Kollegen und Verwandten sprechen, falls es noch welche gibt.« Hell hörte bloß noch ein Husten, dann ein Röcheln.
»Chef, ich melde mich wieder!«
Mehr kam nicht mehr von seinem Stellvertreter.
»Wie gehts ihm?«, fragte Rosin.
Hell lachte. »Gerade hörte er sich an, als stünde er kurz vor dem Ende!«
»Männergrippe«, sagte Rosin entschuldigend, aber mit einem Augenzwinkern.
Hell erhob sich.
»Was denkst du? Sollen wir auf Akuda warten? Oder versuchen wir unser Glück noch einmal in der Nachbarschaft? Diesmal vielleicht eine Straße weiter?«
Rosin dachte einen Moment nach, dann brauchte sie nicht mehr zu überlegen, denn die Glastür wurde aufgerissen und Akuda streckte seinen Kopf durch die Tür. »Entschuldigung, ich bin viel zu spät. Ich hatte noch einen Termin, den ich nicht absagen konnte.«
Er schloss schnell die Tür und zog sich den nächstbesten Stuhl heran. Keiner sagte etwas. Beide starrten ihn nur an.
»Habe ich was verpasst?«, fragte er.
Hell antwortete, nachdem er sich mit dem Gedanken angefreundet hatte, Akuda in seinem Team zu haben.
»Nein, Herr Kollege, wir waren gerade dabei zu überlegen, ob es Sinn macht, noch einmal die Nachbarschaft zu befragen. Bisher haben wir dort nichts erreicht. Und ja, es ist ungewohnt, ein neues Gesicht hier zu sehen. Aber trotzdem, herzlich willkommen im Team«, sagte er und kam um den Tisch herum, um Akuda die Hand zu reichen.
*
»Die Nachbarn wollen alle nichts gehört haben«, fasste Rosin zusammen, als die Tür geöffnet wurde und ein Bote der KTU mit einer Kiste vor ihnen stand. »Mit schönen Grüßen von Julian Kirsch. Soll ich so ausrichten«, sagte der junge Mann mit Zögern in der Stimme. »Für Sie, Herr Kommissar Hell, ist auch noch etwas dabei!«
»Vielen Dank«, sagte Hell und deutete ihm an, die Kiste auf dem Tisch abzustellen.
»Können Sie uns etwas über den Inhalt der Kiste sagen?«, fragte Akuda.
»Das sind die Verzeichnisse der ehemaligen Mitarbeiter und Angestellten, die in dem Heim gearbeitet haben. Bis zuletzt. Die anderen hat er schon aussortiert, weil ...«, erläuterte der Bote und heftete seinen Blick auf Farai Akuda. Hell machte eine genervte Geste und der Bote nickte eifrig. »Sie verstehen schon. Ich bin dann mal wieder weg. Schönen Tag noch!« Er beeilte sich, den Besprechungsraum zu verlassen.
Rosin sah dem jungen Mann hinterher. Ihr war nicht verborgen geblieben, wie bange er Akuda angeschaut hatte.
»Na, das ist ja mal eine völlig ungewohnte Art der Ermittlung«, stöhnte sie dann und zog eine Akte aus der Kiste. ‚Edeltraut Weyres‘ stand auf dem kleinen Plastikreiter, geschrieben mit einer Schreibmaschine.
»Sei froh, Lea. Wir haben früher nur so gearbeitet. Vor dem Computerzeitalter gab es auch schon Kriminalpolizei!«
Lea pustete die Backen auf und ließ die Luft entweichen. »Dann habe ich ja wohl die Gnade der späten Geburt.«
»Wenn du so willst, ja«, antwortete Hell lachend und fischte sich den Ordner heraus, auf dem ‚Ermittlung KHK Hell - privat‘ stand. Er legte die Akte beiseite, spontan kippte er die Kiste auf dem Tisch aus. Schnell wurden die Akten verteilt und die Beamten fingen an zu sondieren und schon bald saßen sie an ihren Tischen und telefonierten.
*
Nachdem Akuda und Rosin das Büro verlassen hatten, widmete sich Hell seiner privaten Akte. Bevor er den blauen Aktendeckel öffnete, bürstete er einige imaginäre Krümel von der Schreibtischunterlage. Kirsch hatte ihn schon am Vortag über das Ergebnis der Untersuchung in seinem Garten informiert. Die Vögel waren mit einem kleinkalibrigen Gewehr erschossen worden. Das hatte die Gerichtsmedizin zu dem Bericht beigetragen. Die Tiere erfreuten sich vorher bester Gesundheit, bis jemand sie dazu auserkoren hatte, auf Hells Fußmatte zu enden. Dieser jemand konnte auch durch die Untersuchung der Kriminaltechnik nicht enttarnt werden. Seine Motivation ebenfalls nicht. Hell musste den Abscheu überwinden, der ihn überkam, wenn er sich mit dieser Geschichte befasste. Machte es wirklich Sinn, sich dem Ganzen intensiver zuzuwenden? Sollte er seine kostbare Zeit investieren, um die Motivation des Täters zu ergründen? Hatte hier einer seine kranke Fantasie ausgelebt? Oder steckte mehr dahinter? Hinter diesen merkwürdigen Worten, die auf dem Zettel standen:
Weiß ist schwarz.
Hell ist dunkel.
Und du bist nicht derjenige, der du zu sein glaubst.
Hell hatte, nachdem er den ersten Schrecken überwunden hatte, eine gewisse Wut gespürt, die sehr bald von einer Gleichgültigkeit abgelöst wurde. Was für ein Schwachsinn! Ein Mann von über fünfzig wusste, wer er war. Da konnten auch keine toten Vögel für Zweifel sorgen. Das war Fakt. Jetzt bemühte er auch nur kaum seine Gesichtsmuskeln und legte den Aktenordner beiseite. Julian Kirsch hatte die Idee ins Spiel gebracht, eine Kamera zu installieren. So eine kleine, wie auch die Geheimdienste sie benutzten. Die ließ sich leicht verbergen. Oder eine große, die man oben in der Ecke der Terrasse anbrachte, die über seinen Heim-PC eine IP-Adresse zugewiesen bekam und mit der man den ganzen Garten beobachten konnte. Hell hielt das für überflüssig, dennoch war er dem Tatortermittler dankbar für seine Mühe.
*
Ihr wettergegerbtes Gesicht und die gepflegten grauen Haare gaben Frau Weyres etwas von einer Abenteuerin. Rosin überlegte eine Weile, bis ihr die Ähnlichkeit zu Jane Goodall auffiel, der bekannten Wissenschaftlerin und Forscherin. Man hätte jedenfalls nicht vermutet, dass sie einmal die Chefsekretärin in einem Kinderheim gewesen war. Aus der Akte wusste Lea, dass sie in dem Jahr, in dem das Heim geschlossen wurde, in Frührente gegangen war. Ihr Mann war ein hohes Tier bei einer der zahlreichen Behörden gewesen, die bis zum Inkrafttreten des Bonn-Berlin-Gesetzes ihren Sitz in der ehemaligen Bundeshauptstadt hatten. Der Ehemann war vor einigen Jahren verstorben, was ihr erlaubte, das Haus mit den Angestellten zu halten und sich auch noch diverse Urlaube pro Jahr zu gönnen. Die macht es richtig, dachte Lea und fischte ihren Notizblock aus der Umhängetasche.
»Noch einmal vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben es extrem schwer, uns ein Bild von Ihrem ehemaligen Chef zu machen«, begann sie und bewegte den Stift nervös zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her.
»Donatus Monzel also«, sagte Frau Weyres und setzte eine ernste Miene auf, »das hätte ich nicht gedacht, dass er auf diese Art und Weise aus dem Leben gerissen wird. Das hat er nicht verdient.«
»Sie haben sich gut verstanden?«, fragte Lea Rosin.
»Oh ja, er war der beste Chef, den man sich nur vorstellen konnte. Immer zuvorkommend, stets höflich und für die Kinder hätte er sein letztes Hemd geopfert!«
Rosin tadelte sich insgeheim, weil nach dem Wort ‚Hemd‘ ihre Gedanken sofort wieder in eine nicht jugendfreie Richtung abdrifteten. Sie musste sich zusammenreißen.
»Wir müssen uns ein umfassendes Bild von Herrn Monzel machen«, fuhr Rosin dann fort und betrachtete Frau Weyres, wie sie geistesabwesend mit den großen Holzperlen ihrer Halskette spielte.
»Sie waren wie lange Arbeitskollegen?«
»Über zwanzig Jahre haben wir zusammengearbeitet, über zwanzig Jahre«, wiederholte sie.
»Hatte er Feinde? Ich meine, erinnern Sie sich an jemanden, der ihm vielleicht nicht so freundlich zugetan war wie Sie?«
»Feinde? Donatus Monzel hatte keine Feinde!«, stieß sie hervor und Rosin bemerkte einen unfreundlichen Unterton in ihrer Stimme.
»Und trotzdem gibt es jemanden, der ihn erschossen hat«, entgegnete Rosin und hielt daraufhin dem Blick der alten Dame stand.
»Wer sollte einen Wohltäter wie Donatus Monzel töten? Das geht mir nicht in den Kopf«, antwortete sie matt und Rosin gewahrte mit einem Mal, dass sie die ganze Zeit über nur die Starke gespielt hatte. Tränen rannen ihr über das Gesicht und Rosin beeilte sich, ihr ein Papiertaschentuch zu reichen.
»Hatten Sie auch nach der Schließung des Heims noch Kontakt zu Herrn Monzel?«, fragte Rosin, nachdem Frau Weyres sich wieder gefangen hatte. Sie hielt das Papiertaschentuch in ihrer Hand geknüllt und überlegte.
»Nein, nicht wirklich. Wir trafen uns ein paar Jahre hintereinander auf einem Wohltätigkeitsball. Sonst nicht, nein.«
»Was war das für ein Ball? Wer war der Schirmherr?«, wollte Rosin wissen.
»Der Schirmherr war der Rotary-Club Bonn. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen.«
Rosin machte sich Notizen. Endlich eine Spur, der man nachgehen konnte.
»Wissen Sie, was seine Aufgabe dort war?«
Weyres schüttelte den Kopf.
»Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Donatus Monzel war ein bekanntes Bonner Gesicht. Viele waren froh, wenn man sie mit ihm an der Seite ablichtete. Ja, das war so, junges Fräulein.«
Rosin überhörte dieses Wort. Dieser liebenswerten alten Dame konnte sie nicht böse sein. »Wie war er?«, fragte sie stattdessen. »Können Sie mir bitte etwas über Donatus Monzel erzählen?«
Nachdem Edeltraut Weyres gegen Rosins Protest einen Tee aufgebrüht hatte, saßen die beiden Frauen bald da und Lea lauschte den Worten der alten Dame. Das Bild, das sie von Donatus Monzel zeichnete, wollte in keinster Weise zu dem potentiellen Kinderschänder passen, der in Rosins Hinterkopf herumspukte. Ihre freundliche Gastgeberin zeichnete stattdessen mit farbigen Pinselstrichen eine Skizze eines warmherzigen Menschen, der die Belange seiner Schützlinge immer in den Vordergrund stellte. Sie brachte keine dramatischen Enthüllungen zutage. Rosin machte sich wieder Stichpunkte. Auch flossen in die Beschreibung immer wieder Szenen aus dem Heimalltag ein, so wie sie ihn in den zwanzig Jahren erlebt hatte. Auch das notierte sich Rosin pflichtbewusst. Beinahe konnte sie vor ihrem inneren Auge die beiden Menschen sehen, wie sie sich über jedes aus dem Heim entlassene Kind freuten.
»Ich werde immer das Strahlen in den Augen sehen, wenn eines der Kinder in ein eigenes Zuhause gehen konnte und das Heim für immer verließ. Er hat dann immer ein Foto gemacht, besser gesagt, ich musste dieses Foto machen und er hat es sich dann daheim an seine Wand gehangen. Das waren seine Lieblingskinder, die dort einen Ehrenplatz erhielten.«
Wieder rührte sich etwas in Rosins Nacken. Lieblingskinder. Was taten diese Kinder wohl, um diesen Status zu erhalten? Sofort hakte sie ein.
»Waren Sie oft in der Monzelschen Villa?«
»Nein, nicht oft. Vielleicht fünf Mal in all den Jahren.«
»Das ist nicht sehr oft«, sagte Rosin skeptisch, »gab es nicht genügend Anlässe?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, Donatus Monzel wollte daheim seine Ruhe haben. Dort ist meine Oase der Ruhe, hat er immer gesagt. Er hat leidenschaftlich gerne klassische Musik gehört und besaß eine außerordentlich große Schallplattensammlung«, antwortete sie und Rosin überlegte, wieso das bisher niemand aus der KTU erwähnt hatte. War das nicht ein Mordmotiv? Von einem Freund wusste sie, dass unter Liebhabern für guterhaltenes Vinyl leicht horrende Preise gezahlt wurden.
»Haben Sie mal zusammen mit ihm Musik gehört?«
Frau Weyres schüttelte wieder den Kopf.
»Nein, nie.«
Ihr Bedauern darüber war leicht zu erkennen. Rosin notierte sich ‚Platten‘ auf dem Block und malte einen Pfeil dahinter, schrieb dann KTU auf. Nachdem Frau Weyres mehrmals hintereinander auf ihre Armbanduhr gesehen hatte, deutete Rosin das als freundliche Aufforderung, zu gehen. Nach dem Tee und den original englischen Keksen empfand sie es als reichlich schwer, sich aus dem bequemen Sessel wieder herauszuarbeiten. Sie bedankte sich artig und fragte noch zum Abschied, ob sie am nächsten Tag mit ihrem Chefkommissar - wieso sie Hell in diesem Moment so nannte, wusste sie auch nicht - erneut vorbeischauen dürfte. Falls ihnen noch Fragen einfallen würden. Die alte Dame hatte nichts dagegen und begleitete Rosin noch zur Tür. Lea Rosin nahm ein gutes Gefühl mit und als sie sich in ihren VW-Polo setzte, bemerkte sie, dass sie sich darauf freute, die alte Dame zu treffen. Und auf Kekse und englischen Earl Grey Tee.
Unterwegs fiel ihr noch eine Frage ein, die sie hätte stellen können: Sie kannte seine Gewohnheiten über all die Jahre hinweg sehr gut. Aber kannte sie auch seine Freunde? Und: Gab es eigentlich eine Frau Monzel?
*
»Wie war noch ihr Name?«, fragte Hell und runzelte die Stirn, »Weyrich?«
»Weyres, Edeltraut Weyres«, antwortete Rosin und Hell korrigierte den Namen auf der Glasscheibe.
»Was kannst du uns berichten?«, fragte Hell und setzte sich an den Besprechungstisch, an dem außer Rosin nur Akuda Platz genommen hatte.
Hell schaute auf seinen Stift, während Rosin über die Dinge sprach, die ihr die alte Dame anvertraut hatte.
»Sie ist also der Meinung, dass ihr Chef ein grandioser Wohltäter war?«, fragte Akuda.
»So negativ würde ich es nicht sehen, aber wenn man sagen würde, dass sie ihn verehrt hat, ja, das würde ich unterschreiben.«
»Man hat es ja nicht selten, dass Sekretärinnen heimlich in ihre Chefs verknallt sind«, erklärte Akuda seinen Zweifel.
»Ich kann es nicht sagen, ob sie in ihren Chef verknallt war. Es ist eine liebenswerte alte Dame, für die Loyalität noch etwas zählt«, antwortete Rosin und strafte Akuda für seinen Zynismus mit einem Seitenblick. Sie konnte es nicht erklären, aber sie hatte das Gefühl mitgenommen, dass sie auf diese Frau nichts kommen lassen würde. Vor allem keine üble Nachrede.
»Diese alten Schachteln leben doch oft in einer völlig verklärten Realität«, sagte Akuda, der sich von ihrem Blick nicht abhalten ließ, seine Meinung zu äußern.
»Diesen Eindruck kann ich nicht bestätigen. Ich denke, dass sie ziemlich genau weiß, worüber sie redet.«
»Nein, ist schon klar. Ein paar Kekse und ein Tässchen Tee können schon das Urteilsvermögen so mancher weiblichen Kollegin trüben!«
Das war doch langsam keine fundierte Kritik mehr.
Wollte Akuda sie provozieren?
Zweifellos. Sie fragte nach und bekam sofort die Bestätigung. »Was soll diese Stichelei, Herr Kollege Akuda?«
»Stichelei? Wir haben einen Mordfall aufzuklären und ich höre nur, wie nett es bei der Frau war und wie gut der Tee geschmeckt hat. Ist das Ihre Art, eine Befragung zu führen?«
»Herr Akuda, wir müssen uns ein Bild vom Mordopfer machen. Und wenn ich dazu einen Liter Tee trinken muss, dann werde ich das tun. Mit Ihren Methoden möchte ich nicht erneut in das Haus Weyres fahren. Wenn wir morgen erneut die alte Dame aufsuchen, dann begrüße ich es, mit Kommissar Hell dorthin zu fahren. Sie dürfen gerne die Monzelsche Schallplattensammlung einem eingehenden Verhör unterziehen. Das Vinyl steht vielleicht auf ihre ruppige Art, ich jedenfalls nicht«, sagte Rosin und bemerkte, wie aufgeregt sie war.
Akuda stieß einen Grunzer aus. Er sah aus dem Fenster. Hell überlegte. Und sein Fazit war eindeutig. Er wünschte sich sofort sein Team hierher. Selbst ein Wendt mit Männergrippe und ein Klauk mit Selbstfindungsproblemen waren sehr wahrscheinlich effektiver als zwei Kollegen, die sich wegen Kleinigkeiten beharkten.
Mein Gott, dachte er.
»Liebe Kollegen, ich appelliere an Ihren Teamgeist. Ich möchte keine Spitzfindigkeiten zwischen den Mitarbeitern haben. Wir sind nur zu dritt und wir haben eine harte Nuss zu knacken. Wem das nicht gefällt, der kann sich gerne anderen Aufgaben widmen! Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt.«
Hell hätte nie gedacht, dass er einen Kollegen, der den gleichen Rang wie er bekleidete, so ansprechen würde. Aber Akudas Art gefiel ihm nicht und er war voll und ganz auf Rosins Seite.
»Schallplattensammlung? Das klingt tatsächlich nach etwas, was mich interessieren dürfte«, raunte Akuda vor sich hin, stand auf und streckte unmerklich seine langen Gliedmaßen.
»Ich bin dann mal vor Ort. Vielleicht kann ich den Platten ja ein paar Töne entlocken«, sagte er und grinste süffisant vor sich hin, als er den Besprechungsraum verließ.
»Blödmann. Kein Wunder, dass die den im Hamburg nicht mehr haben wollten«, beeilte sich Rosin zu sagen, als Akuda hinter der Glaswand verschwunden war.
»Wir müssen uns an ihn gewöhnen, wohl oder übel.«
»Dann wohl eher übel. Kaum sind wir Überthür los, haben wir den nächsten Kotzbrocken am Bein. Ich mag seine selbstherrliche Art nicht.«
Hell dachte an das Gespräch, das er mit Akuda auf der Erpeler Ley geführt hatte und an sein Unbehagen, das ihn dabei überkommen hatte.
»Na ja, Kotzbrocken ist vielleicht zuviel gesagt. Ich würde ihn eher als sehr direkt bezeichnen.«
Lea Rosin zuckte mit den Schultern. »Ich bin doch nicht rührselig, nur weil ich es bei der alten Dame gemütlich fand. Und gegen einen Tee und Kekse kann auch niemand etwas sagen, oder?«
Hell schätzte die intuitive Art der jungen Kollegin. Er tippte sich mit dem Finger an die Schläfe, dann auf die Brust. Dorthin, wo das Herz sitzt. »Man muss es nicht nur hier haben, sondern auch hier ...!«
Rosin nahm es als ein Kompliment und mit einem Lächeln entgegen.
»Sie dürfen mich morgen gerne begleiten, dann werden Sie sehen, dass ich recht habe«, sagte sie und stand auf.
»Sehr gerne, ich liebe Earl Grey Tee.«
»Es sind nur noch ein paar Fragen, die ich geklärt haben möchte. Also, wenn Sie denken, dass wir unsere Ressourcen bündeln können für eine Tasse Tee?«
»Aber selbstverständlich.«
Rosin wartete zwei Sekunden, bevor sie eine Frage in den Raum warf. »Gibt oder gab es eigentlich jemals eine Frau Monzel?«
*
»Nimmst du eigentlich irgendetwas zur Beruhigung?«, fragte Klauk. Irina Lanau schaute aus dem Fenster und ließ mit der Antwort eine Weile auf sich warten. Dann schüttelte sie den Kopf und sah Klauk in die Augen.
»Ich nehme keine Psychopharmaka, wenn du das wissen willst, Basti.«
»Und warum nicht? Du erzählst mir, dass du nachts nicht schlafen kannst und auch weiterhin diese Albträume hast.«
Irina Lanau antwortete wieder nicht. Sie betrachtete Sebastian Klauk mit leicht hochgezogenen Augenbrauen und er sah, dass sich ihre Augen mit Tränen füllten.
»Irina, du musst dir Hilfe holen. Sonst wird dich die Erinnerung in ihrem Griff halten. Es hat keinen Zweck, den Starken zu markieren. Du tust dir damit keinen Gefallen!«, mahnte er. Er setzte sich neben sie auf die Couch und sie vergrub ihren Kopf in seiner Schulter. Sie begann hemmungslos zu weinen und Klauk streichelte sanft über ihren Kopf.
»Ich wünschte, dieser elende Unfall wäre nie passiert«, murmelte er in ihr Haar hinein.
»Du kannst doch nichts dafür«, schluchzte Irina.
»Ich kann schon etwas dafür. Hätte ich einen anderen Job, hätte mich der Killer nicht provozieren wollen. Hätte ich einen anderen Job, dann wäre ich früh genug in Siegburg gewesen.«
»Dein Job kann nichts dafür. Einzig dieser Gregor Quade kann etwas dafür. Er hat mich entführt, er hat die Frauen getötet. Du hast dazu beigetragen, ihn zu erledigen. Das ist dein Beruf, du bringst solche Monster hinter Gitter!«
»Ja, mein Beruf«, sagte Klauk bitter, »genau das ist es, was mir Sorgen bereitet.«
Er griff nach seinem Glas und trank es aus.
Irina löste den Griff und sah ihn an. »Was willst du damit sagen?«
Klauk saß einige Sekunden nur stumm da. Dann seufzte er. »Ich weiß es ja auch nicht.«
»Willst du den Polizeidienst quittieren?«
»Vermutlich nicht«, antwortete Klauk.
»Was heißt das?«
»Das ich trotz meiner Zweifel weitermachen werde. Aber es ist genauso möglich, dass ich in den Sack haue. Ja, so ist es. Ich kann dir nicht sagen, was ich machen werde.«
»Was willst du denn sonst machen, Basti?«
»Ich kann es dir nicht sagen!«, musste Klauk zugeben.
»Du kannst aber doch wegen dieser Sache deinen Beruf nicht aufgeben!«, protestierte Irina, fasste sich dann sofort mit schmerzverzerrtem Mund an die Wange.
Klauk hob den Zeigefinger. »Siehst du, es ist eben nicht nur eine beliebige Sache. Du hättest sterben können. Er hätte dich ebenso töten können wie die anderen Frauen!«
Irina strich sich über die Wange. »Ich lebe aber noch und du hast mich gerettet.«
Sie legte ihre Hand auf Klauks Knie.
»Ja, das kann sich aber eher der Kollege Akuda auf die Fahnen schreiben.«
Er nahm Irinas Hand und drückte sie. Sie schüttelte den Kopf.
»Nein, hättest du den Kontakt zum Killer nicht gehabt, wer weiß, was dann passiert wäre.«
»Vielleicht aber auch gar nichts, wenn er nicht gewusst hätte, dass ich ein Bulle bin«, antwortete Klauk langsam.
»Oder er hätte mich genauso an den Tisch genagelt, wie seine Frau. Die Arme«, stieß Irina hervor.
»Denk nicht daran, bitte!«, versuchte Klauk sie zu beruhigen.
»Wenn das so einfach wäre«, sagte sie und sah aus dem Fenster, »hast du schon jemanden auf diese Art sterben sehen?«
»Nein«, entgegnete Klauk und der Kloß in seinem Hals fühlte sich riesig an. Er hatte schon einige Menschen sterben sehen. Der Letzte, den er sterben sah, war ausgerechnet der, über den sie jetzt sprachen: Gregor Quade. Der Siegsteig-Killer. Der Mann, der drei Frauen in den Wäldern zwischen Siegburg und Hennef getötet hatte und schließlich noch seine eigene Frau. Irina hatte er mehrere Tage in seiner Gewalt gehabt, doch sie hatte Glück gehabt und überlebt.
»Overkill«, flüsterte Klauk beinahe lautlos und Irina sah ihn aus Augen an, die den Schmerz des Erlebten immer noch widerspiegelten.
»Overkill?«
»Ja, so sieht es Christina Meinhold, meine Profiler-Kollegin. Sie ist der Überzeugung, das Quade eigentlich nur seine Frau umbringen wollte. Sie war das eigentliche Ziel. Die anderen Frauen hat er an ihrer Stelle getötet, weil er sich nicht getraut hat, Hand an seine Frau zu legen.«
»Und deshalb musste sie so grauenvoll sterben?«
»Ja, so sieht Christina es jedenfalls. Sie will den Fall »Quade« als Thema für ihre Abschlussarbeit aufgreifen. Sie beginnt in den nächsten Tagen mit der Ermittlungsarbeit. So einen Fall von Overkill hat es in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Daher nimmt sie sich den Fall vor.«
Klauk sah totale Bewunderung in Irinas Augen. »Mutig, sich in eine solch abgründige Seele zu versenken. Wenn sie von mir etwas erfahren will, dann soll sie mich anrufen. Sag ihr das bitte.«
»Bist du sicher?«, fragte er.
»Ja, das bin ich. Ab Montag gehe ich zur Therapie. Mit Christina zu reden, wäre sicher noch eine zusätzliche Hilfe. Ich finde sie so toll.«
Klauk lächelte.
»Ja, das ist sie wohl, da hast du recht.«
Sie schwiegen eine Weile, bis Irina einen Gedanken loswerden wollte.
»Glaubst du, er hat mich verschont, weil es für ihn keinen Grund mehr gab zu töten?«
»Ja, Christina sieht darin einen möglichen Ansatz einer Erklärung. Sie denkt, dass seine Frau aus einem bestimmten Grund die Höchststrafe verdient hatte. In seinen Augen selbstverständlich.« Klauk nahm die Hände zu Hilfe, um sein Unverständnis darüber deutlich zu machen. Er schob den Gedanken bildlich zur Seite. »Du warst einfach da und er hat dich als Druckmittel benutzt. Er hätte dir aller Voraussicht nach nicht das Gleiche angetan wie den anderen Frauen.«
»Sagt das Christina?«
Klauk nickte.
»Sie hat seinen Blick nicht gesehen. Der Typ war irre!«
Angst trat in ihren Blick. Klauk bemerkte sofort, dass es an der Zeit war, das Thema zu wechseln. »Wir machen jetzt einen Cut. Ich werde Christina raten, dass sie eine Weile wartet, bis sie dich anruft. Ist das okay?«
Sie nickte nur.
»Was machst du jetzt? Wenn ich mir jetzt auch noch Sorgen machen muss, weil ich weiß, dass du vielleicht deinen Beruf aufgibst, verbessert das meine Genesung nicht wirklich«, sagte sie und Klauk war froh, dass er jetzt wieder in den Fokus geriet. Er versuchte zu lächeln.
»Danke, das ist lieb von dir.«
»Es ist meine Überzeugung. Du bist der beste Polizist, den ich kenne.«
Klauk lachte auf.
»Du kennst nur mich!«, sagte er.
»Na und?«
»Wenn ich so ein toller Bulle wäre, dann hätte man mich nicht vom Dienst suspendiert, Irina.«
»Dieser Überthür war ein Arschloch, das sagst du doch selber. Warum ist diese Suspendierung noch nicht aufgehoben? Du hast dir doch nichts zuschulden kommen lassen!«
»Das sieht die Dienstaufsichtsbehörde anders. Sie ist der Meinung, dass ich anders hätte handeln müssen!«
»So ein Quatsch!«, ereiferte sich Irina, »ich war in Gefahr und das stellte eine Ausnahmesituation für dich da.«
Klauk lächelte mild. »Es hätte schon noch Spielraum gegeben«, antwortete er und freute sich über ihre Parteinahme.
»Ach ja? Welchen denn?«
Klauk fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. »Ich hätte die Kollegen informieren müssen und können. Akuda hat mich überwacht, aber das wusste nicht einmal Hell. Also, ich hätte mit offenen Karten spielen können.«
»Und wenn er es spitzbekommen hätte, dann wäre es um mich geschehen!«
»Hansen ist der Meinung, ich hätte Hell informieren müssen. Sie kann aber auch meine Gründe verstehen. Ich weiß nicht, wie sie sich dazu stellen wird. Die Dienstaufsicht wird mir auf jeden Fall einen reinwürgen! Das gibt einen Eintrag in der Personalakte. Eine Beförderung kann ich erst einmal vergessen.«
Irina witterte ihre Chance, ihn zu überzeugen. »Scheiß drauf, du willst doch eh nicht aufsteigen!«
Klauk lachte, weil Irina sich so echauffierte.
»Was?«, zischte sie kampfeslustig.
»Du kennst mich ja wirklich gut. Hell wirft mir ebenfalls mangelnden Ehrgeiz vor. Daher hat er auch Wendt befördert«, erklärte er.
Irina hob eine Augenbraue. Sie erwartete eine weitere Erklärung. Was sollte er ihr sagen? Wenn sein Gehirn schon wieder klar hätte denken können, dann wäre die Antwort sicher einfach gewesen. Aber sein Kopf war nicht der alte. Wollte er wirklich den Job hinwerfen? All die Zeit wäre vergeudet gewesen. All die Diskussionen mit seinem Vater. Acht vergeudete Jahre. Etwas rebellierte in ihm. War es der Gedanken an seinen Vater? Dass er nach all den Jahren triumphieren würde?
Er hörte seine Worte förmlich: »Das habe ich dir doch gleich gesagt. Mach etwas aus deinem Leben! Polizeidienst? Das ist doch nichts für einen Klauk!«
Wie oft hatte er diese Worte und den abschätzenden Blick seines Vaters schon gesehen und durchlitten. Zu oft.
Was ist das nur für ein Blödsinn in meinem Kopf, dachte er.
Du kannst nicht ernsthaft deinen Beruf aufgeben! Eine andere Tatsache wog beinahe genauso schwer wie das Triumphgeheul seines Vaters. Er würde Lea nicht mehr jeden Tag sehen können.
»Eine Beförderung kann ich in den nächsten Jahren vergessen. So lange, bis Gras über die Sache gewachsen ist.«
»Was heißt das jetzt? Machst du weiter?«, wollte Irina wissen.
Klauk sah ihr in die Augen.
»Es heißt, dass ich es mir reiflich überlegen werde, ob ich weitermache. Auf jeden Fall bist du die erste, die ich anrufe, wenn in meinem Kopf wieder Ordnung eingekehrt ist! Na ja, meinen Chef werde ich vielleicht noch vor dir informieren. Nun, der ist ja auch männlich.«
Irina knuffte ihn in die Seite. Klauk seufzte selbstkritisch. »Mehr kann ich dir nicht zugestehen«, erklärte er mit einem traurigen Blick.
»Irgendwie weiß ich schon jetzt, wie du dich entscheidest«, sagte sie und setzte sich ganz aufrecht hin, wie ein Mädchen, das im Begriff war, ein Geheimnis an seine beste Freundin zu verraten.
»Ach ja, dann lass mal hören!«
»Du machst dir Gedanken um etwas, um das es sich nicht lohnt, auch nur einen Gedanken zu verschwenden. Du solltest dir Gedanken machen, ob es nicht endlich an der Zeit ist, deiner Lea reinen Wein einzuschenken. Sie sollte wissen, was du für sie empfindest.«
Klauk wurde sofort puterrot. Obwohl sie völlig recht hatte, protestierte er: »Das hat doch nichts mit dem Job zu tun.«
Lea traf mit ihrem Einwand des Pudels Kern. Wenn er und Lea zusammenkamen, mussten sie entweder Versteck spielen oder ihren Vorgesetzten informieren. Das wiederum würde bedeuten, dass einer das Team verlassen musste. Liebschaften unter Kollegen wurden nicht gerne gesehen.
»Dir ist schon klar, was das bedeutet?«, fragte Klauk.
»Ja, sicher. Vielleicht hilft es bei deiner Entscheidungsfindung.«
Sie betrachtete ihn mit einem kecken Lächeln. Klauk seufzte erneut.
»Du hast recht. Ich kann nicht das eine wollen und das andere ausklammern. Verdammt, ich wünsche mir, mein Leben wäre weniger kompliziert!«, sagte er und schlug sich mit beiden Händen auf die Oberschenkel.
»Du musst eine Entscheidung nach der anderen treffen. Dann löst sich vielleicht alles in Wohlgefallen auf. Mach ein Date mit Lea und erklär ihr, was du für sie empfindest. Wenn du recht hast und sie auch auf dich steht, dann ist ja alles klar. Einer von euch wechselt das Team und ihr werdet glücklich!«
»Das Team wechseln, wenn das so einfach wäre«, sagte Klauk, dem bei diesem Gedanken alles andere als wohl war. Das Team wechseln? Andere Kollegen? Einen anderen Chef? Nicht mehr Hell? Nein. Das ging überhaupt nicht.
»Das ist ja vielleicht ein seltsames Gefühl«, sagte er.
»Was für ein Gefühl?«, hakte Irina nach.
»Nicht mehr in Hells Team zu arbeiten oder nicht mehr Bulle zu sein?«
»Ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich tun soll. Ich sollte mich wohl besser mit etwas anderem beschäftigen!«
»Für mich klingt es so, als wäre dir gerade etwas klar geworden, Basti.«
Klauk betrachtete sie mit einem fragenden Gesichtsausdruck.
»Ach ja, dann ist es dir sicher klarer als mir!«
»Nein, es wird dir klar, dass du dich weder von der Polizeiarbeit noch aus Hells Team verabschieden willst. Lea spielt nur eine untergeordnete Rolle. Sorry, ich sehe das so!«
»Aha«, antwortete er kurz angebunden.
Irina stand auf und atmete einmal tief durch. »Du, sei mir bitte nicht böse, aber das viele Sprechen tut mir weh. Wenn du jetzt gehst, dann lege ich mich noch ein wenig hin.«
Klauk stand sofort auf und kratzte sich verlegen am Kopf. »Natürlich, in Ordnung. Du hättest mich viel früher rauswerfen sollen, wenn du Schmerzen hast, Cousinchen!«
Sie lächelte milde. »Ich mache es ja jetzt!«
»Entschuldige bitte, ich sehe im Moment nur meine eigenen Probleme.«
Sie schüttelte sanft den Kopf.
»Nein, das tust du nicht.«
Klauk sah sie zweifelnd an.
»Na ja, wir wollen uns nicht darüber streiten, wer im Moment mehr neben der Spur steht. Ich denke, meine Chancen zu gewinnen stehen gut«, scherzte er und nahm Irina vorsichtig in den Arm.
Zwei Minuten später startete er den Mini-Countryman mit einem Lächeln auf den Lippen. Niemand kannte ihn so gut wie Irina. Das hatte sich in diesem Gespräch mal wieder bewahrheitet. Trotzdem war er nicht schlauer geworden. Aber immerhin konnte er jetzt die Eckpunkte seiner Probleme benennen. Irina hatte den Finger in die Wunde gelegt. Hell oder Lea. Das war die Frage. Und er war sicher, dass er es schnell zu klären hatte, damit er wieder in die Spur kam. So oder so.
*
Vier Stunden lang zeigte Farai Akuda einen gesteigerten Enthusiasmus und wühlte sich durch insgesamt 260 Schallplatten mit klassischer Musik. Viele der Vinylscheiben waren älter als er, aber trotzdem in einem tadellosen Zustand. Einige der Komponisten und Interpreten waren ihm geläufig, andere dagegen überhaupt nicht. Wenn er ehrlich war, hatte er von klassischer Musik keine Ahnung. Ebenfalls nicht von den Preisen, die man durch den Verkauf von Schallplatten erzielen konnte. Die Ordnungsliebe des Toten war ihm eine große Hilfe gewesen, hatte er doch ein Verzeichnis aller Schallplatten angelegt. Selbstverständlich war dieses Verzeichnis mit einer Schreibmaschine geschrieben. Ordentlich und fehlerfrei. Akuda hatte alle Schallplatten gezählt und festgestellt, dass keine davon fehlte. Alle 260 Schallplatten waren vorhanden und darüber hinaus standen sie genau an der Stelle, die Monzel jeder Einzelnen zugewiesen hatte. Akribisch hatte Akuda jede einzelne Platte aus der Innenhülle genommen, sie auf Kratzer oder schriftliche Hinweise untersucht. Ebenfalls hatte er die Plattenhüllen aufgeklappt, in der Hoffnung, darin etwas versteckt zu finden. Diese Hoffnung wurde enttäuscht. Schließlich hatte er eine Platte, die ihm aus der Jugend am meisten im Gedächtnis verhaftet war, auf dem Schallplattenteller gelegt und ‚Peter und der Wolf‘ von Sergei Prokofjew gelauscht. Um in den vollen Genuss der Musik zu kommen, setzte er sich in den bequemen Sessel, den Monzel speziell für diesen Zweck genau im besten Hörabstand zwischen den großen Lautsprecherboxen platziert hatte. Akuda schloss die Augen und lauschte. Es war eine andere Version als die, die er in seiner Kindheit oft gehört hatte. Daher schob er den fremden Klang zuerst darauf. Aber etwas stimmte nicht. Er stand auf, klickte auf die Automatikschaltung und der Tonarm erhob sich von der Platte. Er schaute nach, ob sich unter dem Tonabnehmer Staub angesammelt hatte. Das erzeugte oft ein dumpfes Geräusch und störte den Stereogenuss empfindlich. Er drehte den Ton auf null und reinigte mit einem kleinen Bürstchen den Tonabnehmer. Langsam senkte sich der Tonarm erneut in die Einlaufrille der Schallplatte. Gespannt hörte Akuda auf das Ergebnis des Reinigungsversuches. Er drehte die Lautstärke wieder hoch, setzte sich aber erst gar nicht hin. Mit Recht, denn die ersten Töne klangen noch immer dumpf. Er drehte den Balance-Regler ganz nach links, dann in die andere Richtung. Als Störquelle ortete er sofort die rechte Box. Er kniete sich vor die große Box und löste vorsichtig die Abdeckung. Dahinter lagen ein Hochtöner, ein Mittenhochtöner und ein Basslautsprecher von circa 20 cm Durchmesser. Er spielte mit dem Regler am Verstärker und sein Eindruck bestätigte sich: der Mittenhochtöner produzierte keine Töne. Daher kam der schwammige Klang. Ohne Mitten schlugen der kräftige Bass und der Hochtöner voll durch. Er drehte die riesige Box um und sah, dass die Rückwand angeschraubt war. Akuda holte sich aus seinem Jackett einige Utensilien: eine Taschenlampe und ein Schweizer Taschenmesser, das er immer bei sich trug. Bevor er vorsichtig die sechs Kreuzschlitzschrauben löste, vergewisserte er sich, dass diese Schrauben schon einmal herausgedreht worden waren. Vielleicht hatte Monzel den Defekt bemerkt und wollte es selbst reparieren. Gleichzeitig fragte er sich, ob ein Mann wie Donatus Monzel mit einem Schraubendreher umgehen konnte. Seine Neugier war geweckt, langsam und vorsichtig löste er die Schrauben. Mit dem Zeigefinger hakte er in der Vertiefung ein, wo die Boxenkabel angeklemmt waren und zog die Abdeckung nach vorne. Vorsichtig drehte er die Holzplatte zur Seite, um die Verkabelung nicht zu beschädigen. Er erschrak, weil etwas aus der Box herausfiel. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken, als er erkannte, was dort in der Box verborgen gelegen hatte. Er stellte die Platte ab, holte sein Handy und dokumentierte seinen Fund. Dann zog er sich Untersuchungshandschuhe an, schaltete die Taschenlampe an und betrachtete das Notizbuch. Er leuchtete in die Box hinein und erkannte sofort, warum der Mittenhochtöner seinen Dienst aufgegeben hatte: ein Kabel hatte sich gelöst. Daher konnte er nicht mehr funktionieren. Warum hatte ein Musikfanatiker wie Monzel das nicht erkannt? Oder hatte er es erkannt und keine Zeit gehabt, das Kabel wieder zu befestigen? Weil er in Eile war? Weil er das Notizbuch verstecken musste? Akuda atmete tief durch. Eine Erklärung dafür konnte er nicht finden. Er holte das Notizbuch hervor, legte es vor sich auf den Parkettboden. Nachdem er ein weiteres Foto mit dem Handy gemacht hatte, nahm er das kleine Buch an sich und blätterte darin. Alt und oft benutzt schien es zu sein. Er stand auf und ging zu dem Sessel zurück, schaltete die große Stehlampe ein und setzt sich. Das Büchlein nahm sich klein aus in seinen riesigen Händen. Die ersten Einträge darin waren datiert von 1973. Es waren eigentlich Blankoseiten, doch hatte jemand mit Bleistift vertikale Linien gezogen. Auf jeder Seite gab es drei Spalten. Auf jeder Seite stand oben handschriftlich derselbe Eintrag. Ganz links stand ‚Name‘, daneben ‚Name des K.‘ und in der dritten Spalte eine Zahl. Akuda blätterte schnell weiter, dann ließ er das Notizbuch sinken. Sollte es sich wirklich um das handeln, was er vermutete? Wenn ja, dann hatte jemand über Jahre hinweg Kinder gegen eine Zahlung eines fünfstelligen Betrages ‚verkauft‘. So schien es das Notizbuch zu verraten. War das Donatus Monzel’s Werk? Oder hatte er diese Buch an sich gebracht und versteckt? War dieses Büchlein der Grund ihn zu töten? Akuda sah sich im Raum um. Was sollte ‚Name des K.‘ anderes bedeuten? Auf diese Art hatte sich derjenige eine äußerst lukrative Einnahmequelle beschafft und sich gleichzeitig das Schweigen derjenigen erkauft, die für diese Kinder gezahlt hatten.
Akuda schluckte. Wenn das kein Mordmotiv war. Er blätterte das Buch durch bis zur letzten Eintragung, die auf das Jahr 1989 datiert war. Dann hörte es im November plötzlich auf. Sechzehn Jahre lang hatte dieses Geschäft eine Person zu einem reichen Mann gemacht. War diese Person Donatus Monzel gewesen? Er zählte die Namen auf den Seiten zusammen und machte im Kopf eine Überschlagsrechnung. In den Siebzigerjahren hatte ein Kind 10.000,- D-Mark eingebracht, die letzten zwanzig Einnahmen in den Achtzigern lagen schon bei 15.000,- D-Mark. Auch beim Verhökern von Kindern gab es eine Inflation oder einfach nur profane Geldgier. 67 Kinder hatten einen Betrag von über einer Million D-Mark eingebracht! Er stieß einen leisen Pfiff aus und griff zum Handy. Als sich ein Mitarbeiter der KTU meldete, erklärte er ihm seltsam ruhig, was er soeben entdeckt hatte.
*
Oliver Hell bekam den Anruf von der KTU, als er unter dem Esstisch die Krümel zusammenfegte. Bis er unter dem Tisch hervorgekrochen war, sprang schon der Anrufbeantworter seines Handys an. Leise fluchend krabbelte er unter dem Tisch hervor und suchte nach dem Handy, fand es schließlich auf dem Wohnzimmertisch. Da er seine donnerstägliche Arbeit als nicht sehr vergnüglich empfand, ließ er sich von den Worten des KTU-Kollegen nur zu gerne ablenken. Dieser hatte es auch noch spannend gemacht und auf dem Anrufbeantworter die Nachricht hinterlassen, dass Kommissar Akuda eine heiße Spur gefunden hätte. Hell drückte die Rückruftaste und lauschte gespannt dem Klingeln. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis jemand das Gespräch annahm, in Wahrheit waren es nur fünf Sekunden, bis Elmar Juffing sich meldete.
»Hallo, Herr Kommissar, ich hoffe, ich habe Sie nicht bei etwas Wichtigem gestört?«, begann der Tatortermittler das Gespräch.
»Nein«, brummte Hell, »so erzählen Sie schon, was hat Akuda entdeckt?«
Juffing stieß einen komischen Laut aus. »Das ist ein echtes Ding, wissen Sie? Der setzt sich hin, um ‚Peter und der Wolf‘ zu hören, dabei fällt ihm auf, das der Klang der sündhaft teuren Boxen - ich zitiere - für den Arsch ist. Er hat dann eine der Boxen aufgeschraubt und dort ein Notizbuch gefunden, was darin versteckt war. Ist das ein Ding?«
Hell konnte seine Neugier kaum bremsen. »Was für ein Notizbuch? Mit welchem Inhalt?«
Juffing stieß erneut den komischen Laut aus. »Jetzt kommt das Brisante: darin sind Namen vermerkt und Summen. Akuda vermutet, und ich kann da nur mit ihm mitgehen, dass dort jemand die Einnahmen aus dem ‚Verkauf‘ der Jugendlichen und Kinder aus dem Heim dokumentiert hat.«
Er ließ seine Worte wirken und Hell musste schlucken. Wenn das kein Mordmotiv war!
»Welchen Zeitrahmen decken diese Notizen ab?«, wollte er wissen.
»Von 1973 bis Ende 1989. Aufaddiert ist es eine sechsstellige Summe.«
Hell stieß einen Pfiff aus. Das war definitiv ein Mordmotiv.
»Ihr müsst sofort sämtliche Bankverbindungen überprüfen, privat wie auch geschäftlich. Das Geld muss ja irgendwo auftauchen. So ein Milliönchen kann man nicht einfach verstecken!«
Jetzt seufzte der Tatortermittler. »Akuda ist schon dran und wir werden sicher auch eine freundliche Nachtschicht dranhängen.«
»Wenn es sein muss, reißt die ganze Bude auseinander, wenn er so gerne Sachen versteckt hat, vielleicht ist auch das Geld noch irgendwo im Haus.«
Juffing lachte. »Denselben Gedanken hatte Kollege Akuda auch bereits, er hat die andere Box schon auseinandergeschraubt - hat aber nichts gefunden.«
Hell fasste sich an die Nase und rieb sie aufgeregt. »Egal, sucht weiter und vergleicht die Namen aus dem Notizbuch mit den Namen der Heimkinder. Wenn es dort Parallelen gibt, haben wir vielleicht eine heiße Spur. Danke für die Info und bis morgen. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden!«
Wie gut, dachte Hell, als er wieder unter den Esstisch zurückkehrte. Wir haben zwar keinen blassen Schimmer, aber immerhin eine Spur. Wohin diese Spur auch immer führen würde. Total aufgekratzt verrichtete er seine weiteren Putzarbeiten und gönnte sich dann ein Feierabendbier auf der Terrasse.
*
Als Klauk wieder zuhause war, machte er sich einen starken Kaffee und telefonierte mit Lea. Er brauchte nicht viel Überzeugungskraft, um sie zu einem Treffen zu überreden. Eigentlich überhaupt keine. Sie verabredeten sich in der Bonner Innenstadt und hatten den Plan, Eis essen zu gehen, locker ins Auge gefasst. Sie verabredeten sich am Hofgarten neben dem altehrwürdigen Universitätsgebäude, quasi schon in Sichtweite zu der Eisdiele, die am Kaiserplatz lag. Lea war noch nicht da, als Klauk den Mini in der Straße ‚Am Hofgarten‘ parkte. Er schlenderte unter den alten Bäumen bis zum vereinbarten Treffpunkt neben der Einfahrt zur Tiefgarage. Er überlegte kurz, ob er noch schnell auf einen Sprung in die Stadt gehen sollte, verwarf den Gedanken allerdings sofort. Lea ließ auch nicht mehr lange auf sich warten.
»Hallo, Sebi, du siehst gut und entspannt aus«, sagte sie als Begrüßung.
»Ach ja, findest du? Ich könnte mich besser fühlen ...«
»Die Frage ist, was machst du jetzt?«, fragte sie und Klauk konnte ihr innerlich nur laut applaudieren. Dennoch hätte er sich eine andere Begrüßung gewünscht, nicht direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, hätte er als angenehmer empfunden. Irgendetwas stand zwischen ihnen, das spürte er sofort. Ihr Blick hatte etwas Lauerndes, als wolle sie ihn nach einer unbedachten Äußerung ans Kreuz nageln. Sie überquerten die Straße und gingen an dem Brunnen vorbei, der, wie immer im Sommer, von lautstark herumschreienden Kindern belagert war.
»Du musst dich langsam entscheiden, was du tun willst«, sagte sie und schaute eine Mutter giftig an, die es für völlig normal hielt, dass ihre Tochter die Passanten nassspritzte.
»Wem sagst du das ...«
»Ich sage es dir, Sebastian Klauk. Wir haben einen ziemlich seltsamen Mordfall vor der Brust und das halbe Team ist entweder krank oder auf Selbstfindungstrip!«
Klauk überhörte ihre Spitze. »Krank?«, fragte er.
»Jan-Philipp hat sich eine Männergrippe genommen und du spielst die Mimose.«
»Ich spiele nicht, ich überlege, was ich tun soll. Mal ganz ehrlich, wenn du keinen Bock darauf hast, dich mit mir zu treffen und meine Beweggründe zu verstehen, dann können wir das auch lassen, Lea!«
Er blieb unverwandt stehen und sah sie an.
Sie hob die Augenbrauen und kam einen Schritt auf ihn zu. »Entschuldigung, es ist nur, weil dieser Akuda als Ersatzmann ins Team gerutscht ist, so lange bis ... bis ihr wieder einsatzfähig seid«, erklärte sie und ihr Blick verlor etwas von der Härte.
»Also setzen wir uns jetzt und du hörst mir zu?«, fragte er mit einem reichlich genervten Unterton in der Stimme. Lea nickte.
Sie warteten, bis die Eisdielen-Bedienung den Tisch trocken gewischt hatte und die Getränkekarte und die Zuckerdose wieder an ihren Platz stellte.
»Sie dürfen sich schon setzen«, forderte sie die beiden Gäste auf. Klauk zog galant den Stuhl zurück und schob ihn dann nach vorne, damit Lea sich setzen konnte.
Dann setzte er sich selber und signalisierte der Bedienung noch, dass sie aus der Karte bestellen wollten. Lea bestellte sich vorab einen Espresso.
»Für Sie auch einen?«
Klauk schüttelte den Kopf. Stattdessen kreisten in seinem Kopf die Gedanken. Er überlegte, wie er ihr weiter begegnen sollte. Seine Stimmung mit ihr zu flirten, ihr vielleicht sogar ein Liebesgeständnis zu machen, war mit Leas anfänglicher schlechter Laune untergegangen. Als er ihr jetzt so gegenübersaß, fragte er sich für einen Moment, ob diese Frau überhaupt die Richtige für ihn sein konnte. Verglichen mit Irina war sie ein grober Klotz. Aber den Vergleich mit seinem Cousinchen verloren fast alle Frauen. Die Bedienung brachte den Espresso und Lea versenkte zwei Stück Zucker darin. Dabei sah sie zu ihm herüber.
»Nun, wo drückt denn der Schuh, Sebi?«, fragte sie und rührte mit dem kleinen Kaffeelöffel den Espresso um.
*
Als Lea Rosin an diesem späten Nachmittag in die Bonner City fuhr, hatte sie bereits eine genaue Vorstellung der Abläufe. Als sie gegen neun Uhr wieder nach Hause fuhr, fand sie diese Vorstellung in fast allen Belangen bestätigt. Ihr Kollege Sebastian machte auf sie den Eindruck eines ziemlich verwirrten Menschen, der mit den Erlebnissen der letzten Wochen noch nicht im Reinen war. Es kam genau so, wie sie es befürchtet hatte. Obwohl sie ihm gut zugeredet hatte, man hätte auch bestätigen können, dass sie auf ihn wie auf ein totes Pferd eingeredet hatte, war das Gespräch letztendlich ergebnislos verlaufen. Hatte sie doch die leise Hoffnung gehegt, dass er ihr mitteilen würde, alsbald wieder zum Dienst zu erscheinen, hatte er seine Suspendierung zum Schutz hergenommen. Sie gewann den Eindruck, dass es ihm sogar ganz recht war, sich in diese Situation zu flüchten. Warum auch immer. Daher war sie froh, dass sie bei ihrer Kleiderwahl diesmal nicht so hoch gepokert hatte, wie vor einigen Tagen zuvor. Sie trug anstelle ihrer Hotpants und des Tank-Tops einen Rock und eine züchtige Bluse. So eine Blamage wie im Kaldauer Wald, wollte sie sich nicht noch einmal geben. Damals hatte sie sich besonders sexy angezogen, weil sie von einem Date mit Sebastian ausgegangen war. Dabei wollte Klauk mit ihr bloß auf Spurensuche gehen und ihr die letzten Ermittlungsergebnisse entlocken. Dass sie bei dieser Suche auch noch Erfolg hatten, blieb einmal dahingestellt. Jedenfalls kam sie sich im Wald mit ihrem Outfit reichlich underdressed und beinahe peinlich vor. Die Höchststrafe war, dass Klauk ihre Bemühungen nicht einmal kommentierte. Wie sie im Nachhinein erst erfuhr, stand ihm sein Kopf nicht nach einem Flirt oder sogar nach etwas Weitergehendem. Diesen Eindruck gewann sie in den beinahe zwei Stunden in der Eisdiele erneut. Er machte nicht den Eindruck, als hätte er ein über den Beruf hinausgehendes Interesse an ihr. Also startete auch sie keinen weiteren Flirtversuch.
Als sie dann abends wie üblich mit Christina Meinhold noch am Fenster telefonierte, ersparte sie es sich, von dem Treffen mit Sebastian zu berichten. Erstens konnte man dieses Gespräch nicht als ein Date bezeichnen, außerdem und zweitens hätte sie dann wieder die gut gemeinten Ratschläge Chrissies über sich ergehen lassen müssen. Darauf wollte sie verzichten. Sie schlief ein in dem Bewusstsein, dass sich ihre Schwärmerei für Sebastian in Wohlgefallen aufgelöst hatte. Entweder hatte er kein Interesse an ihr oder er hatte zu viel anderes im Kopf - Irinas Zustand zum Beispiel - oder beides zusammen. Jedenfalls machte sie einen großen Haken hinter dem Namen Sebastian Klauk.
*
Der Mann, der schon seit zwei Stunden auf seinem Beobachtungsposten hinter einem üppigen Rhododendronbusch stand, gähnte herzhaft, aber leise. Niemand durfte ihn bemerken. Von dort, wo er stand, konnte er genau in das Wohnzimmer der Villa schauen. In dieser Zeit waren drei weibliche Gäste angekommen und er gewann langsam die Erkenntnis, dass es an diesem Abend nur zu einer weiteren Beobachtung reichen würde. Diese vier Damen hatten viel Spaß, enormes Sitzfleisch, und die Likörflasche, die vor ihnen auf dem Tisch stand, war schon bis auf eine kleine Pfütze geleert. Er ließ das Fernglas sinken und als er sah, dass die Hausherrin unter Applaus der anderen Damen mit einer weiteren Flasche Likör zurückkehrte, beschloss er, sofort zu gehen. Im Umkehrschluss hieß es für ihn, dass er sich den ganzen Abend umsonst um die Ohren gehauen hatte. Diese vier Frauen schienen kein Ende zu finden. Sie würden sich weiter amüsieren. Ohne weitere Zeit zu verschwenden, steckte er das Fernglas ein und duckte sich. Im Entengang passierte er den Zaun und versteckte sich für einige Sekunden hinter einem der großen Pfeiler des Eingangstores. Er atmete einmal tief durch als er bemerkte, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Eine Sekunde später war alles um ihn herum schwarz und er fiel.
*