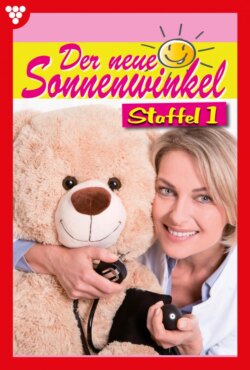Читать книгу Der neue Sonnenwinkel Staffel 1 – Familienroman - Michaela Dornberg - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEs war ein herrlicher, sonniger Mittag, ganz so wie in einem Bilderbuch, mit einem klarblauen Himmel, auf dem weiße Schäfchenwolken tanzten.
Das Mittagessen war gekocht.
Inge Auerbach saß auf ihrer Terrasse in einem schönen, dazu erstaunlich bequemen Korbsessel und wartete nur noch darauf, dass ihre Jüngste, Pamela, die jeder nur Bambi nannte, aus der Schule kam.
Es war still geworden im Landhaus am Sternsee.
Inge fragte sich immer wieder, wo die Zeit eigentlich geblieben war.
In der Erinnerung sah sie sich mit ihrer Familie in dieses wunderschöne Haus einziehen, das ihr Ehemann, der bekannte Professor Werner Auerbach, überraschend für sie gekauft hatte.
Anfangs waren sie wirklich nicht alle von dieser Idee begeistert gewesen. Doch dann hatten sie alle, trotz mancher Höhen und Tiefen, ihr Glück gefunden.
Ricky, die kein Mensch Henrike nannte, obwohl sie eigentlich so hieß, war mit ihrem Fabian glücklich geworden. Vier Kinder hatten sie mittlerweile und aus ihr eine glückliche Großmutter gemacht.
Ihr Ältester, Jörg, war praktischerweise mit Fabians Schwester Stella verheiratet. Ob es bei diesem glücklichen Paar bei zwei Kindern bleiben würde, war noch nicht abzusehen.
Hannes, der es mit der Schule nie so genau genommen und jahrelang Achterbahnnoten nach Hause gebracht hatte, sehr zum Entsetzen seines klugen Vaters, hatte zum Schluss den Dreh bekommen und ein besseres Abitur gemacht als seine Geschwister.
Mit einer Eins-Komma-Null standen ihm alle Türen offen.
Er war noch jung, hatte keine Eile, wollte sich auch noch nicht festlegen, zumal er auch die Möglichkeit hatte, mit Stipendium in New York an der Columbia zu studieren.
Im Augenblick war er mit Freunden als Backpacker unterwegs, um sich den Wind ein wenig um die Ohren wehen zu lassen.
Inge hatte auch jetzt noch ein mulmiges Gefühl, wenn sie daran dachte, dass er sich in Ländern aufhielt, in denen er nicht einmal mit Englisch weiterkam.
Werner hatte seinen Sohn bestärkt, hatte sogar ordentlich seine Reisekasse aufgebessert, die Hannes sich zuvor als Regalauffüller in einem Supermarkt mühsam verdient hatte.
Hinterher war herausgekommen, dass es auch ein Traum ihres Ehemannes gewesen war, unbeschwert nach dem Abitur durch die Welt zu reisen, was seine Eltern leider erfolgreich zu verhindern gewusst hatten.
Ricky hatte, obwohl sie sehr klug war, überhaupt keine beruflichen Ambitionen gehabt, sondern nach dem Abitur direkt ihren Lehrer, Dr. Fabian Rückert geheiratet, der mittlerweile der angesehene Direktor eines großen Gymnasiums war.
Jörg hatte bei der Auswahl seiner Freundinnen immer daneben gegriffen, und sie waren heilfroh gewesen, als er sich in Stella verliebt hatte. Eine bessere Schwiegertochter konnte Inge sich nicht wünschen. Umgekehrt war es allerdings ebenso. Sie und Werner hatten als Eltern alles für ihre Kinder getan, sie hatten immer zuerst an sie gedacht und ihnen all die Liebe geschenkt, die ein Kind brauchte, um sich zu einem selbstbewussten Menschen zu entwickeln. Und sie hatten sie gefördert, wo sie nur konnten.
Und als Schwiegereltern hatten sie die Partner ihrer Kinder mit offenen Armen aufgenommen.
Und sie taten etwas sehr Kluges, um Konflikte von vornherein zu vermeiden, sie hatten sich von Anfang an herausgehalten.
Ach ja, sie und ihr Werner, sie waren schon ein gutes Team. Vor die Wahl gestellt, würde sie sich sofort wieder für ihren Mann entscheiden.
Sie liebte ihn noch immer wie am ersten Tag, und seiner Liebe konnte sie sich auch sicher sein.
Natürlich war es auch bei ihnen nicht immer nur eitel Sonnenschein gewesen.
Manchmal hatte es sogar ganz ordentlich gekracht. Nur langanhaltende Kräche hatte es nie gegeben, sie hatten sich direkt wieder versöhnt. Und vor allem hatten sie, bei allem Zorn, ihre Kräche niemals vor ihren Kindern ausgetragen.
Leider hatten sie in ihrem Umfeld, auch unter ihren Freunden, einige Trennungen erlebt, die teilweise unterhalb der Gürtellinie verlaufen waren. Und sie hätten es nie für möglich gehalten, dass man sich um eine angeschlagene Vase erbittert streiten konnte.
Inge griff nach ihrer Kaffeetasse, trank genüsslich einen Schluck, ehe sie sich wieder zurücklehnte.
Sie war heute ganz schön sentimental. Vielleicht lag das an dem schönen Wetter. Da sah man die Welt mit ganz anderen Augen.
Ihre Augen sahen jetzt auf jeden Fall, dass überall Unkraut wucherte, und dass sie unbedingt den Gärtner bestellen musste, damit er die vom Sturm niedergerissenen Bäume entfernte.
So schön ein großer Garten auch war. Es gab stets eine Menge zu tun. Mit ihrem Professor konnte sie nicht rechnen, der hatte, was die praktischen Dinge des Lebens anging, zwei linke Hände.
Bambi war ihr eine sehr große Hilfe. Sie liebte die Gartenarbeit und war mit Feuereifer dabei. Sie war überhaupt ein richtiger Sonnenschein.
Dieses Kind war ihnen vom Himmel geschickt worden. Und so traurig es auch war, dass Bambi als Einjährige ihre leiblichen Eltern durch einen tragischen Autounfall verloren hatte. Sie hatten es nie bereut, dieses entzückende Kind spontan bei sich aufgenommen und adoptiert zu haben.
Die Adoption …
Inge Auerbach bekam ein ganz schlechtes Gewissen, wenn sie daran dachte, dass Bambi noch immer nicht wusste, dass sie kein leibliches Kind der Auerbachs war. Für sie und Werner war Bambi ein Kind ihres Herzens, das sie nicht weniger liebten als ihre anderen Kinder. Im Gegenteil, manchmal sogar ein wenig mehr, weil die Kleine ein ganz außergewöhnliches Mädchen war.
Inge seufzte bekümmert.
Sie hatten es Bambi immer sagen wollen. Auch ihre eigenen Kinder hatten darauf gedrängt, weil sie der Meinung waren, dass Bambi ein Recht darauf hatte, alles über ihre Herkunft zu erfahren.
Für Jörg, Ricky und Hannes hatte es nie ein Problem gegeben, keine Eifersüchteleien.
Bambi war vom ersten Augenblick an ihre kleine, vor allem ihre über alles geliebte Schwester gewesen.
Inge trank noch etwas von ihrem Kaffee, seufzte erneut. Werner und sie hatten den Zeitpunkt verpasst!
Je älter Bambi wurde, und je selbstverständlicher sie als eine Auerbach-Tochter auftrat, umso schwieriger wurde es. Inge und Werner, der ganze Hörsäle von Studenten in seinen Bann ziehen konnte, dem international bekannte Wissenschaftler begeistert applaudierten, brachten es nicht übers Herz, ihrem Kind, und das war Bambi für sie, die Wahrheit zu sagen.
Auch wenn sie wussten, dass es falsch war, steckten sie weiterhin den Kopf in den Sand, verschoben es auf später.
Ein solches Verhalten passte weder zu Inge, noch zu Werner.
Sie waren offene, aufrichtige Menschen.
Was war da nur schief gelaufen?
Anfangs waren sie der Meinung gewesen, Bambi sei noch zu klein, um mit der Wahrheit konfrontiert zu werden.
Ach, es war müßig, sich jetzt all die Versäumnisse in Erinnerung zu rufen und die Gründe, weswegen sie es nicht getan hatten.
Sie waren zu feige gewesen, genau das war der Punkt.
Inge Auerbach blickte auf ihre Armbanduhr, die Werner ihr zum fünfundzwanzigsten Hochzeitstag geschenkt hatte und die sie über alles liebte.
Wo blieb Bambi eigentlich? Sie hätte längst zu Hause sein müssen, weil sie nicht zu den Kindern gehörte, die herumtrödelten, sondern immer gleich nach der Schule zu ihren Eltern wollte.
Ihr war doch wohl nichts passiert?
Diesen Gedanken verwarf Inge so schnell, wie er ihr gekommen war.
Im Sonnenwinkel kannte jeder jeden.
Wäre etwas passiert, dann hätte man es ihr längst zugetragen, und man hätte sich um Bambi gekümmert.
Hier zu leben war ein Privileg!
Im Sonnenwinkel, der aus den Orten Erlenried und Hohenborn bestand, lag die Kriminalrate bei Null.
Hier gab es sie noch, die heile Welt.
Zumindest, was das Außen betraf. Dass innerhalb der einzelnen Familien nicht immer eitel Sonnenschein herrschte, war normal. Die Menschen waren verschieden, auch hier im Sonnenwinkel. Doch eines hatten sie schon gemeinsam. Sie liebten ein Leben fernab der Turbulenz der Großstädte.
Also gut, Sorgen machen musste sie sich keine.
Doch wo blieb Bambi?
Professor Werner Auerbach kam in diesem Augenblick auf die Terrasse hinaus.
Er war ein hochgewachsener Mann, schlank, mit einem schmalen Gesicht, zu dem die randlose Brille ganz hervorragend passte. Er gehörte zu den Männern, die mit zunehmendem Alter immer attraktiver wurden und bei denen graue Schläfen interessant aussahen.
Er lief auf seine Frau zu, beugte sich über sie, drückte ihr einen zärtlichen Kuss auf die Stirn, ehe er sich erkundigte: »Bleibt bei uns heute die Küche kalt? Ich habe Hunger.«
Sie drehte sich zu ihm um, lächelte ihn an.
»Wir müssen nur noch auf Bambi warten. Das Essen ist fertig.«
Werner Auerbach setzte sich.
»Nun gut, das kann ja nicht mehr so lange dauern, ich hatte schon die Befürchtung, du wolltest wegen des schönen Wetters heute streiken und uns mit einem Butterbrot abspeisen.«
»Was auch kein Drama wäre«, bemerkte Inge leichthin. »In vielen Ländern werden mittags nur ein Salat oder ein Sandwich gegessen, und die Hauptmahlzeit wird am Abend eingenommen.«
Er lächelte sie an, und ihr wurde ganz warm ums Herz. »Mein Liebes, vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir in einigen dieser Länder gemeinsam gelebt haben und ich mit diesen Gepflogenheiten durchaus vertraut bin? Seit wir hier im Sonnenwinkel leben, weiß ich die deutsche Gemütlichkeit zu schätzen.«
Nun blickte auch er auf seine Uhr. »Unsere Bambi ist wirklich überfällig. Ich denke, ich fahre ihr ein Stück entgegen. Vielleicht hat sie den Bus verpasst.«
*
Professor Auerbach wollte gerade aufstehen und sein Vorhaben in die Tat umsetzen, als Bambi auf die Terrasse gestürmt kam.
Sie war ein entzückender Teenager und sah mit ihren braunen Locken und den großen grauen Augen ausgesprochen hübsch aus.
Schon jetzt umstrichen die Knaben ihres Alters das Haus, doch noch war Bambi an Jungen nicht interessiert.
Ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit schmiss sie ihre Schultasche in eine Ecke, ließ sich ebenfalls in einen Sessel fallen und rief: »Bitte sagt mir, dass das nicht wahr ist.«
Ihre Stimme war laut, ihre Augen blitzten.
Es musste schon etwas sehr Gravierendes geschehen sein, das Bambi so aufregte.
Inge nahm es gelassen. Sie lächelte ihre Tochter liebevoll an.
»Um dir eine Antwort geben zu können, solltest du dich ein wenig präziser ausdrücken, mein Kind.«
Das tat Bambi zunächst einmal nicht, denn pfeilschnell kam aus einer hinteren Ecke des Gartens Jonny, Bambis schon ziemlich in die Jahre gekommener Collie, hervorgeschossen, um sein Frauchen zu begrüßen.
Bambi und Jonny waren ein Herz und eine Seele, seit Fabian ihr den Hund als Welpen geschenkt hatte.
Für sein Alter war er noch gut dabei, doch auch ein Hundeleben dauerte nicht ewig, und Inge hatte jetzt schon Angst, wenn sie daran dachte, dass Jonny eines Tages nicht mehr da sein würde.
Doch augenblicklich mussten sie sich darum noch keine Gedanken machen.
Die Begrüßung war herzlich, Bambi umarmte ihren Jonny und streichelte ihn hingebungsvoll, und der war außer sich vor Freude.
Der Professor unterbrach diese Idylle, indem er aufstand und sagte: »So, dann können wir jetzt endlich essen.«
Er ging voraus in die Küche, nicht ohne vorher seiner Tochter gesagt zu haben: »Und wasch dir die Hände.«
Bambi lachte, sie schien ihren Ärger vergessen zu haben. »Aber Papi, das musst du mir doch nicht sagen, das weiß ich.«
Sie erhob sich, ging ebenfalls ins Haus, Jonny trottete neben ihr her, die Schultasche blieb auf der Terrasse liegen.
Inge nahm sie mit hinein.
Wenig später saßen sie an dem großen blank gescheuerten Küchentisch.
Die Auerbachs besaßen ein Esszimmer mit wunderschönen Biedermeiermöbeln, die Inge von einer Tante geerbt hatte.
Doch diesen Raum benutzten sie nur selten, sie liebten ihre Küche und deren Gemütlichkeit. Und Inge liebte große blanke Tische. Außerdem war es praktisch, da hatte sie nur kurze Wege vom Herd zum Tisch.
Heute Mittag gab es einen Gemüseeintopf, den Werner Auerbach besonders liebte. Er war zu vielen offiziellen Essen eingeladen, die jeweils aus mehreren Gängen bestanden. Früher war es noch häufiger der Fall gewesen. Er schätzte die bürgerliche Küche, ganz besonders die Kochkünste seiner Frau, die es mit so manchem Sternekoch aufnehmen könnte. Seine Inge war einfach großartig, und das in jeder Hinsicht. Und attraktiv war sie außerdem. Er hatte sich sofort in sie verliebt. Sie war seine Mrs Right, seine Mrs Perfect. Und obwohl er viele Gelegenheiten gehabt hatte und die noch immer da waren …
Er hatte einer anderen Frau nicht einmal einen Blick zugeworfen.
Er füllte seinen Teller ein zweites Mal, weil der Eintopf einfach zu köstlich war, dann wandte er sich an seine Tochter, der es auch schmeckte.
»Sag mal, mein Kind, du kamst mit einer Weltuntergangsstimmung nach Hause, warst außer dir … Was hat dich denn so aufgeregt? Was kann nicht wahr sein?«
Weil Jonny sie so hingebungsvoll begrüßt hatte und weil sie auch ziemlich hungrig gewesen war, hatte sie es vorübergehend verdrängt.
Doch nun war es wieder da. Bambi ließ ihren Löffel fallen, dann sagte sie: »Nun, dass Dr. Riedel mit seiner Familie hier wegziehen soll, angeblich nach Amerika.«
Inge begann zu lachen.
»Da musst du dich verhört haben, Kleines. Ehe er sich hier niedergelassen hatte, war Dr. Riedel in Amerika, das stimmt schon. Doch er arbeitet nun schon so viele Jahre als Arzt im Sonnenwinkel, er wird von seinen Patienten geliebt und gebraucht. Wenn man sich eine solche Existenz aufgebaut hat, dann gibt man das nicht wieder auf. Die Riedels sind glücklich hier, und wir sind es auch.«
Das hörte sich zwar sehr beruhigend an, was ihre Mutter da gesagt hatte, doch Bambi konnte sich damit nicht zufriedengeben.
»Mami, die Frau Hollenbrink hat es zu einer anderen Frau gesagt, die ich nicht kannte. Und die muss es doch wissen. Sie ist schließlich die Sprechstundenhilfe von Herrn Dr. Riedel und arbeitet seit vielen Jahren für ihn. Und Frau Hollenbrink hat ganz schön traurig geklungen.«
Bambi war ein sehr fantasievolles Kind, sie interpretierte sehr schnell Dinge in etwas hinein. Nicht nur das, manchmal ging die Fantasie auch mit ihrer Kleinen durch, und sie hatte Bambi deswegen schon mehrfach aufgefordert, Märchenbücher zu schreiben.
»Du kannst dich dennoch verhört haben, Bambi«, sagte Inge, weil sie sich auch einfach nicht vorstellen konnte, dass Dr. Riedel vom Sonnenwinkel wegziehen könnte. Die Riedels gehörten einfach dazu.
Werner Auerbach, der sich das bislang schweigend angehört hatte, räusperte sich.
»Bambi hat sich nicht verhört, Inge. Es trifft zu. Die Riedels werden uns verlassen, weil der Doktor ein Angebot bekommen hat, das er einfach nicht ablehnen kann.«
Inge konnte es nicht glauben.
Bambi konnte ihren Triumph nicht genießen, doch recht gehabt zu haben.
Inge Auerbach fasste sich als Erste.
»Werner, das glaube ich nicht«, sprach sie aus, was sie dachte. »Was kann so reizvoll sein, um alles hier einfach im Stich zu lassen? Die Kinder aus ihrer gewohnten Umgebung zu reißen.«
Der Professor trank etwas, stellte bedächtig sein Glas wieder ab, während seine Frau und Bambi wie auf Kohlen saßen. Das wollten sie jetzt aber wissen!
»Sein früherer Chef hat ihm eine florierende Privatklinik in Philadelphia vermacht. Das allerdings nur unter der Voraussetzung, dass er sie auch selbst weiterführt.«
Nach diesen Worten war es still, und es dauerte eine ganze Weile, ehe Bambi sagte: »Damit kommt unser Sonnenwinkel natürlich nicht mit.«
Recht hatte sie.
»Und wann soll es losgehen?«, wollte Inge wissen.
»Recht schnell«, war seine Antwort.
»Und was wird aus uns?«
»Für seine Nachfolge ist gesorgt.«
Inge Auerbach schaute ihren Mann an.
»Sag mal, Werner, woher weißt du das eigentlich alles?«, erkundigte sie sich.
»Vom Doktor höchstpersönlich, und ehe ihr mich mit weiteren Fragen löchert, es wird kein großes Verabschieden geben, das wollen sie wegen der Kinder nicht, die natürlich viel lieber hierbleiben würden. Der Doktor wird jeden seiner Patienten anschreiben und sich verabschieden und bei dieser Gelegenheit dann auch seine Nachfolgerin vorstellen und empfehlen.«
»Nachfolgerin?«, riefen Inge und Bambi wie aus einem Mund.
Diese Reaktion irritierte den Professor ein wenig. »Ja, Nachfolgerin. Ihr habt doch wohl keine Probleme mit einer Frau?«
Das hatten sie natürlich nicht. Doch jetzt waren sie neugierig und wollten natürlich mehr wissen.
Das verriet er nicht, obwohl er es wusste. Er sagte seinen beiden Grazien auch nicht, dass er die Frau Doktor sogar schon kennengelernt hatte.
»Sie ist eine großartige Ärztin, sie und Dr. Riedel haben zusammen studiert, danach niemals so ganz den Kontakt verloren.«
Für Bambi wurde es uninteressant, sie erkundigte sich höflich, ob sie aufstehen und gehen dürfe.
Dagegen hatte Inge überhaupt nichts, denn sie brannte darauf, von ihrem Mann mehr zu erfahren.
»Hat sie Familie?«, wollte sie wissen.
Ein Kopfschütteln war die Antwort.
»Wenigstens einen Ehemann?«
»Nein, Inge. Warum stellst du solche Fragen? Das alles hat doch nichts mit einer fachlichen Qualifikation zu tun.«
»Das nicht, mein Lieber. Aber wir wohnen hier, wie du weißt, nicht in einer Großstadt. Das kulturelle Angebot ist eher bescheiden. Eine alleinstehende Frau nimmt es doch nicht freiwillig auf sich, in … Nun ja, ich drücke es mal drastisch aus, in die … Pampa zu ziehen. Das ist was für Ehepaare, denen die Familienplanung noch bevorsteht, für Familien mit Kindern …, mal ganz ehrlich, mit dieser Frau Doktor scheint etwas nicht zu stimmen. Wie heißt sie überhaupt?«
Werner Auerbach liebte seine Frau wirklich über alles. Und sie war auch sehr klug, obwohl sie nicht studiert hatte. Sie besaß einen gesunden Menschenverstand, was manchmal mehr wert war als ein Prädikatexamen.
Nur wenn sie emotional bewegt war, und das war sie jetzt, plapperte sie, ohne nachzudenken.
Aber so war sie halt, und deswegen liebte er sie kein bisschen weniger.
»Liebes, um hier im Sonnenwinkel wohnen zu wollen, wohnen zu dürfen, dazu muss man sich keine Genehmigung einholen, und es setzt auch kein kollektives Verhalten voraus. Und das mit den Ehepaaren und Familien stimmt so auch nicht. Erinnere dich an die Opernsängerin, die wir mal in der Nachbarschaft hatten, die sich verzweifelt hierher geflüchtet hatte, weil sie Stimmprobleme hatte. Oder der Schriftsteller mit der Schreibblockade, der wohnte monatelang hier.«
Inge winkte ab. Wenn ihr Mann so drauf war, dann begann er zu dozieren. Und darauf hatte sie jetzt überhaupt keine Lust. Dazu war sie viel zu neugierig.
»Okay, Werner. Ich habe verstanden, du hast recht«, am liebsten hätte sie jetzt hinzugefügt: »wie immer«. Doch das stimmte nicht und würde auch nur einen unnötigen Streit heraufbeschwören. »Erzählst du mir, was du weißt?«
Natürlich tat er das, weil er vor seiner Frau keine Geheimnisse hatte, und sie würde es ohnehin erfahren. Warum also nicht sofort.
Er erzählte ihr, dass Dr. Roberta Steinfeld eine erfahrene Ärztin war, vor allem eine ganz hervorragende Diagonistikerin, die sich immer wieder weitergebildet hatte.
»Sie leitete zusammen mit ihrem Ehemann eine große Praxis, deren Erfolg in erster Linie ihr zu verdanken war. Als sie seine ewigen Seitensprünge nicht mehr aushalten konnte, ließ sie sich scheiden und verzichtete, weil sie keine schmutzige Wäsche waschen wollte, auf ihren Anteil an der Praxis und ging. Das Angebot von Dr. Riedel kam ihr gerade recht. Privat ist sie ziemlich am Boden, beruflich freut sie sich auf die neue Herausforderung.«
»Und wenn sie sich wieder gefangen hat, wird sie dann gehen?«
»Liebes, darüber müssen wir uns nicht den Kopf zerbrechen. Es ist allein ihre Entscheidung. Lass sie doch einfach erst mal ankommen. Ich werde ihr auf jeden Fall unvoreingenommen gegenübertreten.«
»Ich doch auch, Werner. So haben wir es bisher immer gehalten. Wieso sollte sich da etwas geändert haben? Die von Riedings haben uns mit offenen Armen aufgenommen, ganz besonders Sandra. Das werde ich nie vergessen.«
Der Professor nickte zufrieden.
»Da jetzt alles geklärt ist: Was hältst du davon … sollen wir noch gemeinsam auf der Terrasse einen Espresso hinken, ehe ich wieder an meine Arbeit gehe?«
Dagegen hatte Inge nichts einzuwenden, im Gegenteil.
Während sie sich an der Espressomaschine zu schaffen machte, hörte sie ihren Mann rufen: »Für mich bitte einen Doppelten.«
Sie lächelte. Als wenn sie das nicht wüsste.
*
Dr. Roberta Steinfeld deutete auf zwei große Kartons, die angefüllt waren mit Bekleidungsstücken.
»Damit mach, was du willst, Nicki. Du kannst die Sachen behalten, du kannst sie verkaufen, verschenken, ins Frauenhaus bringen.«
Nikola Beck blickte ihre Freundin bekümmert an.
»Wenn du deinem treulosen Ex schon alles überlässt, nichts mitnehmen willst, was dich an ihn erinnert. Anziehen musst du dich doch in diesem Dorf. Auch wenn das niemand kennt, kann ich mir nicht vorstellen, dass man dort nackt zwischen den Bäumen hindurchhüpft.«
Roberta schenkte ihrer Freundin ein nachsichtiges Lächeln.
Für Nicki war es unvorstellbar, dass jemand freiwillig die Stadt verließ, um irgendwo auf dem platten Land neu anzufangen.
Nicki irrte sich in mehrfacher Hinsicht, und es war kein plattes Land, sondern ein wunderschönes, hügeliges. Es war eine sehr reizvolle Gegend, in die Roberta sich sofort verliebt hatte.
»Nicki, ich überlasse Max nicht alles, sondern nur das, was wir gemeinsam angeschafft haben. Und was meine Bekleidung betrifft, so alt kann ich überhaupt nicht werden, um all das auftragen zu können, was ich mit in mein neues Leben nehme. Nicki, du bist voller Vorurteile, freue dich noch ganz einfach mit mir. Als freie Übersetzerin bist du unabhängig, du kannst überall arbeiten. Warum nicht im Sonnenwinkel? Ich werde da ein wunderschönes Haus beziehen, und du bist jetzt schon herzlich eingeladen, so viel Zeit bei mir zu verbringen, wie du willst.«
Das allerdings war für Nikola derzeit noch absolut unvorstellbar, doch das sagte sie ihrer Freundin nicht.
Eigentlich hatte sie schon mehr gesagt, als sie hätte sagen dürfen.
Roberta war eine kluge, erwachsene Frau, die wusste, was sie tat.
Und wenn man mit einem Schwerenöter, einem notorischen Fremdgänger verheiratet gewesen war wie mit diesem Max, den Nikola nie hatte leiden können, dann würde wohl jede Frau versuchen, von ihm so weit wie nur möglich wegzukommen.
Nikola stand auf, umarmte ihre Freundin stürmisch.
»Du wirst mir fehlen, Roberta. Ich vermisse dich schon jetzt.«
»Nicki, ich dich auch. Aber ich bin nicht aus der Welt, und wie gesagt, mein Angebot steht. Du bist jederzeit herzlich willkommen im Sonnenwinkel.«
Nikola Reck, noch immer auf der Suche nach ihrem Mr Right, trotz einiger schmerzhafter Fehlschläge, erkundigte sich. »Gibt es da attraktive und nicht ganz unvermögende Junggesellen?«
Trotz ihres ganzen Elends musste Roberta lachen.
Typisch Nicki. Sie sprach vollmundig über attraktive, reiche Männer, dabei waren ihre bisherigen Verehrer weder das eine noch das andere gewesen, und dennoch hatte ihre Freundin sich auf sie eingelassen, weil sie geglaubt hatte, sie zu lieben.
»Ich denke, eher nicht. In erster Linie leben Familien im Sonnenwinkel und Ehepaare, die eine Familie gründen möchten. Doch Enno Riedel hat mir auch von einer Ausnahme erzählt. Ein reicher verwitweter Fabrikant mit Kind hat sich in Sandra von Rieding aus dem Herrenhaus verliebt, sie geheiratet, und …«
Sie wurde von ihrer Freundin unterbrochen. »Warum erzählst du mir das, Roberta? Dieser Fabrikant ist vom Markt, und er wird sich meinetwegen bestimmt nicht scheiden lassen. Und ansonsten denke ich, werden Männer mit Kohle nicht reihenweise in dieser dörflichen Idylle auftauchen.«
»Meine Mutter hat immer gesagt: Was auf deinen Weg kommen soll, kommt auf deinen Weg«, bemerkte Roberta.
»Dabei hat sie bei dir aber ganz gewiss nicht an diesen windigen Max gedacht, der dich ausgenommen hat wie eine Weihnachtsgans«, sagte Nicki.
Es tat noch immer weh, doch Roberta bemühte sich, darüber hinwegzukommen.
»Es wird ihn einholen«, sagte sie leise. »So, wie er sich alles unter den Nagel gerissen hat, kann es ihm kein Glück bringen.«
»Als erstes werden ihm die Patienten wegbleiben. Die wollten nicht von ihm behandelt werden, sondern von dir. Abgesehen von diesen Hühnern, die mit ihm ins Bett wollten.«
Nikola blickte auf ihre Uhr, sprang entsetzt auf. »Du liebe Güte, ich habe eine Verabredung mit einem Auftraggeber. Ich muss weg, hoffentlich wartet er auf mich. Ich komme später wieder. Und du überleg währenddessen, ob du die Klamotten nicht doch mitnehmen willst.«
Sie umarmte ihre Freundin stürmisch, dann lief sie los. Roberta Steinfeld seufzte, dann sortierte sie weiter.
So cool, wie sie sich Nicki gegenüber gab, war sie längst nicht.
Sie hatte ihre Entscheidung, Enno Riedels Praxis zu übernehmen, sehr spontan getroffen, zumal die Voraussetzungen stimmten und er ihr ein gutes Angebot gemacht hatte, das sie so schnell nicht wieder bekommen würde.
Nur … War es die richtige Entscheidung?
Gut, das sah man meist erst hinterher. Aber der Schritt von einer Großstadt, aus einer Praxis mit mehreren angestellten Ärzten und vielen Helferinnen, Assistentinnen, in eine Ortschaft mit überschaubaren Häusern war schon ein gewaltiger Schritt.
Und als Einzelkämpferin mit einer einzigen Mitarbeiterin hatte sie auch noch keine Erfahrung. Das war eine gewaltige Umstellung.
Enno Riedel hatte es viele Jahre ausgehalten, war glücklich gewesen. Doch der war in den Sonnenwinkel gezogen, um eine Familie zu gründen, also unter ganz anderen Voraussetzungen.
Nach ihren Erfahrungen mit Max war es für Roberta unvorstellbar, dass sie sich noch einmal binden würde. Sie hatte ihren Beruf, den sie über alle Maßen liebte, und der musste ihr jetzt alles ersetzen.
Sie wurde aus ihren Gedanken gerissen, als sie Schritte hörte. Wenig später stand Max vor ihr, sehr gut aussehend, selbstbewusst und sehr selbstverliebt.
Er sah leicht erregt aus, die Lippenstiftspuren auf seinem Hemdkragen waren nicht zu übersehen. Er kam von einer Frau.
So kannte sie ihn, so hatte sie ihn unzählige Male erlebt.
Zum Glück tat es nicht mehr weh wie während der Zeit ihrer Ehe.
Jetzt fragte sie sich nur, wie er so leichtfertig sein konnte zu einer Zeit, in der er eigentlich in der Praxis hätte sein müssen, seinen privaten Vergnügungen nachzugehen.
Sie wollte ihn darauf ansprechen, doch dann besann sie sich, ließ es bleiben. Es ging sie nichts mehr an. Doch wenn er so weitermachte, dann konnte man sich ausrechnen, wann er die Praxis heruntergewirtschaftet haben würde. Und dann würde es auch aus sein mit seinen Gespielinnen, denn ohne Geld würde er erheblich an Attraktivität einbüßen.
Sie erkundigte sich nur: »Was willst du?«, und freute sich, obwohl es in ihr ganz anders aussah, ihrer Stimme einen so gleichgültig klingenden Klang verliehen zu haben.
Das irritierte ihn.
Er zerrte an seinem Hemdkragen.
Und jetzt konnte sie sich nicht verkneifen zu sagen: »Du hast übrigens Lippenstift am Kragen.«
Er wurde rot. Und das gefiel ihr, früher hatte sie ihn mit solchen Äußerungen wütend gemacht. Aber sie hatte genug von Spielchen. Max und sie, das war vorbei, und deswegen waren es auch die Verletzungen, die er ihr zugefügt hatte. Die musste sie noch verarbeiten, neue brauchte sie wirklich nicht.
Ganz ruhig wiederholte sie ihre Frage.
»Ich möchte nur mal sehen, was du alles mitnehmen willst«, sagte er.
Es war unglaublich.
»Das, was wir abgesprochen haben.«
Er grinste. »Na ja, zwischen dem, was man sagt und was man hinterher tut, gibt es ja wohl einen Unterschied.«
Er machte es ihr durch solche Äußerungen immer einfacher, ihn zu vergessen.
»Für mich nicht, Max«, antwortete sie ganz ruhig. »Und das solltest du auch wissen. Wir waren schließlich lange genug verheiratet. Aber bitte, kontrolliere noch mal alles, und am besten stehst du morgen früh um sieben auch hier auf der Matte, um nochmals alles zu überprüfen. Dann kommt nämlich der Möbelwagen.«
»Und wohin wirst du gehen?«, erkundigte er sich noch einmal. Auch wenn sie geschieden und zwischen ihnen alles geklärt war, interessierte ihn das schon. Man konnte ja nie wissen. Vielleicht brauchte er Roberta ja noch einmal. Seine Ex war nicht nachtragend, und sie war sehr hilfsbereit. So etwas musste man unbedingt in petto haben. Also, er hätte nicht so bereitwillig auf alles verzichtet. Wäre sie nicht so großzügig gewesen, hätte er um jeden Teller gestritten.
Sie schaute ihn an.
»Weg«, sagte sie kurz und knapp, ehe sie sich wieder ihrer Arbeit zuwandte und ihn einfach ignorierte.
Er blieb noch eine kurze Weile unschlüssig stehen, dann drehte er sich abrupt um und verschwand.
Roberta hatte keine Ahnung, ob er jetzt das Haus verlassen würde. Es konnte durchaus sein, dass er aus lauter Angst, sie könne etwas mitnehmen, was nicht vereinbart war, alles kontrollieren würde.
Es interessierte sie nicht.
Das Haus war verkauft, den Erlös würden sie teilen, obschon es in erster Linie von dem Geld bezahlt worden war, das sie geerbt hatte.
Sollte er glücklich werden, mit dem Geld, mit dem Inventar des Hauses, mit der Praxis.
Sie fragte sich allerdings, was er mit all den Möbeln, Bildern und sonstigen Einrichtungsgegenständen, mit all dem Geschirr, dem Porzellan, den Gläsern, dem Silber machen wollte, das er sich unter den Nagel gerissen hatte, in seiner abstoßenden Gier.
Das musste nicht wirklich ihre Sorge sein. Irgendwann hörte Roberta das Zuschlagen der Haustür. Er war gegangen, ohne sich zu verabschieden. Damit konnte sie allerdings leben. Je weniger sie ihn sah, umso besser. Von alldem, was sie einmal für ihn empfunden hatte, war nichts mehr geblieben. Er hatte alles zerstört, wenigstens bei ihr, in ihr. Ob er sie je geliebt hatte, das bezweifelte sie mittlerweile. Es hatte ihm gefallen, dass sie ihn bewundert hatte, weil er so anders war, als die Männer, die sie vorher gekannt hatte. Und natürlich hatte er sehr schnell festgestellt, dass sie so etwas wie ein Lotteriegewinn war: klug, zielstrebig und nicht ganz arm. Und gut aussehend war sie auch.
Er hatte sich nicht in ihr getäuscht, sie hatte all seine Träume erfüllt. Ohne sie hätte er überhaupt nichts erreicht.
Mit einem mittelmäßigen Examen kam man nicht weit. Und ohne sie hätte er jetzt auch keinen Doktortitel, denn sie hatte seine Arbeit mehr oder weniger geschrieben.
Aus …
Vorbei …
Es würde ihn einholen. Für Max und seine Zukunft, ob in privater oder beruflicher Hinsicht, hatte Roberta kein gutes Gefühl.
Max hatte nie ernsthaft gearbeitet, sich nie ernsthaft um etwas bemüht, sondern das Leben, ganz besonders sein Liebesleben, stets als ein Spiel betrachtet.
In der Praxis spielte er den Chef, dem der weiße Arztkittel besonders gut stand, und bei besonders attraktiven Patientinnen spielte er den Charmeur und baggerte sie an.
Gutachten schreiben, Abrechnungen, Zahlungen, Verhandlungen, das alles waren für ihn böhmische Dörfer, das hatte er stets auf sie abgewälzt. Und was Verantwortung bedeutete, da hatte er gerade mal eine Ahnung davon, wie man das Wort schrieb.
Sie wünschte ihm nichts Schlechtes, doch die Praxis war eine Nummer zu groß für ihn. Das würde ihm um die Ohren fliegen. Roberta wusste es. Man musste keine hellseherischen Fähigkeiten haben, um das vorauszusehen.
Die Patienten, die sie behandelt hatte, und das waren viele, blieben größtenteils jetzt schon weg.
Sie könnte jetzt triumphieren, doch davon war Roberta weit entfernt.
Es war einfach nur traurig, diesen Untergang vorauszusehen.
Sie stellte eine weitere Kiste mit Bekleidungsstücken auf den Stapel, mit dem Nicki machen konnte, was sie wollte. Roberta wollte mit leichtem Gepäck in ihr neues Leben starten, und das in jeder Hinsicht.
Auch wenn sie augenblicklich ringsum nichts weiter als Trümmer sah, freute sie sich. Sie war eine Kämpferin, sie würde es schaffen, sie würde durchkommen.
Aus diesem Gefühl heraus rief sie Enno Riedel an, um sich für die Chance, die sie durch ihn bekam, zu bedanken.
»Hey, Roberta«, widersprach er sofort, »wenn sich hier jemand bedanken muss, dann ich. Ich kann, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, nach Philadelphia reisen. Für mich erfüllt sich ein Traum. Aber ich weiß, dass es dir im Sonnenwinkel gut gefallen wird. Als Großstadtpflanze musst du dich erst mal an diese himmlische Ruhe und den Frieden ringsum gewöhnen. Aber glaub mir, daran gewöhnt man sich schnell.«
Sie besprachen noch ein paar Details, die die Praxis betrafen. Da musste zunächst nichts verändert werden. Das Haus war ausgeräumt, frisch gestrichen. Enno würde mit seiner Familie die Nacht in einem Hotel in der Nähe des Flughafens verbringen, und wenn sie im Sonnenwinkel eintraf, dann würden sie im Flieger bereits eine ziemliche Strecke zurückgelegt haben.
Alles war gesagt.
»Enno, ich wünsche dir, Amelie und den Kindern viel Glück in Amerika. Du kannst dich ja mal melden.«
Das versprach er, dann sagte er: »Und du vergiss Max. Er hat nicht zu dir gepasst, und wir haben uns alle sehr gewundert, warum du ausgerechnet ihn geheiratet hast. Da gab es noch ein paar andere Bewerber um deine Hand, mit denen du mehr Glück gehabt hättest.«
Das wusste Roberta, doch damals hatte sie keinen anderen Mann außer Max gewollt.
Und dafür hatte sie einen hohen Preis bezahlt.
Das alte Sprichwort – wer nicht hören will, muss fühlen – würde sie heute glatt unterschreiben.
Sie verabschiedeten sich voneinander, und Roberta wandte sich wieder ihrer Arbeit zu. Es gab noch viel zu tun.
Gutachten schreiben,Inge Auerbach wollte ihren Mann gerade fragen, ob er auch einen Kaffee trinken wollte, als draußen das Gartentor quietschte, sich eilige Schritte dem Haus näherten, die Haustür aufgerissen wurde und Ricky hereingestürmt kam, ihrer Mutter um den Hals fiel und lachend rief: »Mami, wolltest du gerade zu meinem Empfang den roten Teppich ausrollen?«
Sie deutete auf den roten Samt, den ihre Mutter in der Hand hatte.
Inge fiel in das Lachen mit ein, erklärte, dass sie aus dem Stoff für Bambi ein Prinzessinnenkleid für eine Schulaufführung nähen wollte, dann erkundigte sie sich: »Ist was passiert, Ricky?«
Angelockt durch das Lachen kam der Professor aus seinem Arbeitszimmer, sah seine Tochter und begrüßte sie herzlich. Die beiden verstanden sich gut, Ricky war schon immer ein Papakind gewesen, was nicht bedeutete, das sie ihre Mutter weniger liebte. Sie hatte ihren Vater früher einfach nur leichter um den Finger wickeln können.
»Papi, ehe du mich jetzt auch noch fragst ob etwas passiert ist, sage ich nein. Alles ist in bester Ordnung. Ich war nur gerade bei meinen Schwiegereltern, weil Rosmarie unbedingt etwas von meiner selbstgemachten Himbeermarmelade haben wollte. Und Ihr kennt sie, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann muss es sofort geschehen. Sie ist jetzt glücklich, und Ihr und Omi und Opi bekommt natürlich auch ein Gläschen. Bei den Großeltern war ich schon. Hier ist also euer Glas, und über einen Kaffee würde ich mich sehr freuen. Ich habe euch nämlich etwas zu sagen.«
»Hast du es den Rückerts auch schon erzählt?«, erkundigte Inge sich. Sie und Rosmarie und Heinz Rückert verstanden sich ganz hervorragend. Sie waren sogar miteinander befreundet. Doch eine gewisse Rivalität gab es schon, was die Kinder und Enkel anging.
Da war Rosmarie ziemlich schmerzfrei, sie glaubte, sich das nehmen zu dürfen, was ihr als Mutter, Schwiegermutter und Oma zustand. Und das gefiel keinem so richtig. Ricky und Jörg hielten sich da zurück, aber Fabian und Stella hatten ihrer Mutter schon einige Male ihre Meinung gesagt, was stets zur Folge hatte, dass Rosmarie sich dann für einige Tage nicht blicken ließ und auch nicht anrief.
»Nein, Mama, die Rückerts wissen es nicht«, antwortete Ricky. »Omi und Opi habe ich es gerade erzählt, und nun seid ihr an der Reihe … bekomme ich jetzt den Kaffee?«
Inge verschwand in der Küche, Ricky holte Tassen aus dem Schrank und ging damit hinaus auf die Terrasse. Man musste das schöne Wetter einfach ausnutzen, ganz besonders, da bekannt war, dass das nächste Tief schon im Anzug war.
Wenig später saßen sie sich gegenüber, der Kaffee duftete, und die selbst gebackenen Kekse schmeckten köstlich.
Ehe Ricky anfangen konnte zu erzählen, erkundigte Inge sich: »Du sitzt hier in aller Ruhe. Musst du nicht die beiden Kleinen vom Kindergarten abholen und daheim sein, wenn Sandra und Henrik aus der Schule kommen?«
Typisch ihre Mutter!
»Mama, entspann dich, für die Kinder ist gesorgt.«
Ricky trank noch einen Schluck Kaffee, griff in die Keksschale, und als sie den Keks gegessen hatte, lehnte sie sich zurück.
»Es wird einige Veränderungen in meinem Leben geben«, sagte sie. »Ich werde studieren, genauer gesagt, Deutsch und Biologie auf Lehramt.«
Inge wollte gerade den Zucker in ihrer Tasse umrühren. Der Löffel landete klirrend auf der Untertasse.
Sie starrte ihre Tochter an, glaubte, sich verhört zu haben, dann stammelte sie: »Willst du … äh … hast du dich etwa von Fabian … getrennt?«
Nun konnte Ricky nur ganz verblüfft dreinblicken, ehe sie anfing, herzhaft zu lachen.
»Aber Mami, wie kommst du denn auf eine so absurde Idee? Fabian ist der Mann meines Lebens, ich habe ihn von der ersten Sekunde an geliebt. Mit uns wird es immer schöner, wir sind so eng miteinander, dass zwischen uns kein Blatt Papier passt.«
Inge Auerbach war verwirrt.
»Ricky, du bist verheiratet, hast vier Kinder … und nun willst du studieren? Wie soll das denn gehen? Bist du hier, um uns zu fragen, ob wir die Kinder nehmen sollen? Meinetwegen ja, und wenn Papa einverstanden ist … aber, Ricky, das ist alles zu hoch für mich. Das musst du mir erklären.«
Ihre arme Mama!
»Mami, das will ich ja, doch da musst du mich auch lassen. Es ist ganz einfach so, dass ich seit einiger Zeit weiß, dass das nicht alles gewesen sein kann. Ich war mit achtzehn verheiratet, bekam mit neunzehn mein erstes Kind, danach hintereinander weg drei weitere Kinder.«
»Die du alle wolltest«, wandte Inge Auerbach ein.
Ricky schenkte ihrer Mutter einen nachsichtigen Blick. Sie konnte es einfach nicht lassen.
»Ja, Mami, ich wollte die Kinder, ich liebe jedes von ihnen, könnte mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen, und …«, sie machte eine kurze, bedeutsame Pause, »ich würde es wieder so machen, nicht ganz, ich würde neben den Schwangerschaften studieren, wie es viele Frauen heutzutage machen.«
»Ricky«, stöhnte Inge, die die Welt nicht mehr begriff.
Werner Auerbach hatte bislang zugehört, jetzt wandte er sich an seine Tochter.
»Ich finde das gut, Ricky«, unterstützte er sie, »du bist klug, und du bist jung genug. Ich zweifle nicht daran, dass du es schaffen wirst, aber vier Kinder … das bedeutet Verantwortung und Zeitaufwand …«
Ricky nickte.
»Das haben Fabian und ich lange überlegt, alles abgesprochen. Den Kindern wird es an nichts mangeln. Fabian hat keinen Bürojob, administrative Dinge kann er von zu Hause aus regeln, ich kann mich mit der Wahl meiner Vorlesungen mit ihm absprechen. Und dann haben wir ja auch noch Oma Holper, unsere Nachbarin. Die Kinder lieben sie, sie springt jetzt schon ein, wie beispielsweise heute.«
Inge Auerbach sagte nichts, doch Ricky kannte ihre Mutter genau genug, um zu wissen, was die jetzt dachte.
»Mami, Frau Holper bekommt nur eine ganz kleine Rente. Sie ist froh, wenn sie etwas hinzuverdienen kann. Das Geld für sie bekomme ich übrigens von Opi. Die Großeltern sind ganz begeistert und wollen mich in jeder Hinsicht unterstützen. Sie wollen mir sogar ein kleines Auto kaufen, damit ich nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin.«
Ihr Ehemann!
Ihre Eltern!
Alle waren spontan dafür. War es jetzt an der Zeit für sie, umzudenken?
»Ricky, ich will wirklich nur das Beste für dich, deinen Mann und natürlich für die Kinder.«
Ricky stand auf, ging zu ihrer Mutter, umarmte sie, drückte ihr einen Kuss auf die Stirn.
»Mami, das weiß ich doch. Du bist die allerbeste Mami der Welt, und du bist mein Vorbild. Du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Welches Risiko gehe ich ein? Ich muss keine Entscheidung fürs Leben treffen wie die, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Wenn ich merke, dass etwas aus dem Ruder läuft, kann ich jederzeit das Studium abbrechen. Ich freue mich auf die Herausforderung, doch ich möchte mich nicht auf Kosten meiner Familie profilieren. Übrigens, Jörg, mein etwas stieseliger Bruder mit seinen überholten Ansichten über Familie, ist begeistert, er findet es großartig.«
»Würde er es auch finden, wenn Stella auf die Idee käme, plötzlich anfangen zu wollen zu studieren?«, wollte Inge Auerbach wissen.
»Die Frage stellt sich nicht. Stella ist zufrieden mit ihrem Leben, und, wie ihr wisst, ist sie ein wenig träge. Der Aufwand wäre ihr zu groß. Jetzt, wo sie das viele Geld geerbt hat, geht sie viel lieber shoppen.«
Das war für Inge und Werner Auerbach neu, und natürlich wollten sie wissen, was es mit dieser Erbschaft auf sich hatte.
»Ihre Tante Finchen hat es ihr vermacht.«
»Und Fabian?«, erkundigte Inge sich sofort. »Hat er auch etwas geerbt? Und überhaupt, Finchen hat doch eher einen ärmlichen Eindruck gemacht.«
»Stella ist die Alleinerbin, Finchen hat ihr alles vermacht.«
Am Blick ihrer Mutter sah Ricky, wie betroffen sie das machte.
Ihre Mutter, eine Gerechtigkeitsfanatikerin, hatte nie jemanden bevorzugt, und das tat sie auch bei ihren Enkeln nicht. Alle wurden gleich behandelt.
Weil sie wusste, dass das jetzt zu einer langen Diskussion führen würde, fuhr Ricky schnell fort: »Wir können damit leben. Fabian hatte ein etwas gestörtes Verhältnis zu dieser Tante, mit der eigentlich nur Ricky zurechtkam. Sie hat sie besucht, sich gekümmert, für sie eingekauft, sie zu den Feiertagen zu sich geholt. Und das alles hat sie getan, weil sie Finchen nicht nur mochte, sondern sich für sie auch verantwortlich fühlte. Niemand wusste, dass Finchen einen Batzen Geld unter dem Kopfkissen gehortet hatte. Man kann Stella also nicht unterstellen, eine Erbschleicherin zu sein. Es freut mich für sie, weil das Geld sie unabhängig von Jörg macht. Stella hat sich übrigens auch bereit erklärt, einzuspringen, wenn Not am Manne ist. Und in dieser Hinsicht ist auf sie wirklich Verlass.«
Das waren Neuigkeiten, die Inge erst einmal verarbeiten musste.
Die jungen Leute gingen mit einer Rasanz an alles heran …
Sie war ja auch noch nicht alt und stand mitten im Leben. War sie altmodisch?
Offensichtlich, denn selbst ihre Eltern, Magnus und Teresa von Roth, sahen das lockerer.
Sie war verunsichert.
Ihre Tochter, trotz ihrer vier Kinder, eine Studentin, ihre Schwiegertochter demnächst eine Shoppingqueen? Und sie? Ein trutschiges Hausmütterchen, zufrieden mit dem Leben, das sie führte? Eine Frau, die nie andere Ambitionen gehabt hatte, als Hausfrau und Mutter zu sein?
Inge warf ihrem Mann einen unsicheren Blick zu.
Werner lächelte sie an. »Liebes, fange jetzt bitte nicht an, dein Leben infrage zu stellen und bekomme bloß keine Minderwertigkeitskomplexe. Du bist großartig, wir haben wohlgeratene Kinder. Du hast mir stets den Rücken freigehalten. Ohne dich hätte ich nie das erreicht, was ich geworden bin. Du bist die Frau, die ich liebe, um die ich immer beneidet wurde und noch beneidet werde. Und, mein Herz, vergiss bitte nicht eines – hinter jedem starkem Mann steht eine starke Frau. Ich bin stolz auf dich, und du kannst es auch sein.«
Ricky wurde ganz warm ums Herz. Ja, ihre Eltern, das waren ihre Vorbilder, auch wenn sie und Fabian in ihrer Ehe so manches anders machten. Und das war auch gut so. Das Leben ging weiter, die Zeiten änderten sich.
Aber die Liebe … die Liebe überdauerte alles.
Werner und Inge schauten sich in die Augen, hielten einander mit den Händen fest.
Es war eine lange, eine alte Liebe, und Ricky hatte bis zu diesem Punkt mit ihrem Fabian noch einen sehr weiten Weg zurückzulegen.
Ehe die Stimmung ins Sentimentale zu kippen drohte, erkundigte sie sich. »Wo ist eigentlich Bambi?«
»In der Schule bei der Probe. Sie ist mit Feuereifer dabei und ganz stolz darauf, die Hauptrolle spielen zu dürfen, unsere Kleine.«
Ricky liebte ihre kleine Schwester über alles. Doch je älter Bambi wurde, umso unwohler fühlte Ricky sich, vor allem dann, wenn sie sah, mit welcher Selbstverständlichkeit sich Bambi als Auerbach-Spross fühlte und sogar allen Ernstes behauptete, ihrer Mami immer ähnlicher zu sehen.
Irgendwann mussten sie es Bambi sagen, und Ricky wünschte sich von ganzem Herzen, sie würden es bald tun.
Sie konnte ihre Eltern in dieser Hinsicht wirklich nicht verstehen. Sie saßen auf einem Pulverfass, das jeden Augenblick in die Luft fliegen konnte.
Nur wenige Menschen wussten, dass Bambi adoptiert war. Wenn nun jemand von denen, nicht einmal in böser Absicht, plauderte, und Bambi bekam es zufälligerweise mit?
Das wäre nicht auszudenken, es würde einen riesengroßen Schaden an Bambis empfindsamer Seele anrichten.
Ricky wurde ganz anders bei diesem Gedanken, und deswegen verdrängte sie es sofort wieder und begann stattdessen über ihre Kinder zu sprechen.
Das war ein Thema, über das ihre Eltern sich gern unterhielten und von dem sie nicht genug bekommen konnten.
»Wenn ihr wollt, dann könnt ihr sie euch übers Wochenende holen«, schlug Ricky vor.
Sie wusste, dass sie damit nicht nur ihre Eltern, sondern auch vor allem ihre Kinder glücklich machte, die ihre Großeltern und die nebenan wohnenden Urgroßeltern über alles liebten.
Ricky wusste, dass den Kindern so mancher Riegel Schokolade zugeschoben wurde, dass sie sich im Fernsehen eine Kindersendung ansehen durften, die verboten war, dass man es mit den Zubettgehzeiten nicht so genau nahm und dass natürlich das Lieblingsessen gekocht wurde, zu dem es dann Limo zu trinken gab.
Ricky und Fabian waren sich darin einig, es zuzulassen, denn ihre Großeltern hatten es auch nicht anders gemacht, und es hatte ihnen nicht geschadet.
Natürlich wurde dieser Vorschlag ganz begeistert aufgenommen.
Wenn die Enkel kamen, ob nun die von der Tochter oder die vom Sohn, dann legte Professor Werner Auerbach die Arbeit nieder und war nur noch für die Kinder da.
Für seine eigenen Kinder hatte er sich nicht die Zeit nehmen können, weil er als international gefragter Wissenschaftler stark angespannt gewesen war. Die Erziehung der Kinder hatte in erster Linie bei Inge Auerbach gelegen, die das allerdings ganz großartig gemacht hatte. Sie war eine wunderbare Mutter gewesen, war es immer noch. Natürlich war sie das auch als Großmutter.
Ricky wunderte sich allerdings manchmal, mit welcher Hingabe ihr Vater sich um die Enkel kümmerte. Er war ein guter Vater gewesen, doch als Großvater war er ganz großartig.
Ricky besuchte ihre Eltern und Großeltern im Sonnenwinkel sehr gern, und bedauerte manchmal, nicht mehr Zeit bei ihnen verbringen zu können. Und es würde leider noch weniger werden, wenn sie erst einmal ihr Studium aufgenommen hatte, und das würde sehr bald sein.
Sie konnte sich nur damit trösten, was Fabian immer sagte, nämlich, dass es nicht die Quantität machte, sondern die Qualität.
Ricky umarmte ihre Eltern und versprach, die Kinder vorbeizubringen.
Dann musste sie sich sputen.
Oma Holper war zwar großartig, doch überfordern durfte sie die alte Dame auch nicht.
Adieu, lieber Sonnenwinkel, murmelte sie vor sich hin, ehe sie in ihr Auto stieg, eine richtige, nicht mehr ganz neue Familienkutsche, und davonfuhr.
Sie atmete erleichtert auf, dass sie das jetzt hinter sich gebracht hatte und ihre Familie Bescheid wusste.
Um ihre Großeltern hatte sie sich keine Sorgen gemacht, deswegen war sie auch zuerst zu ihnen gegangen. Die waren jung im Herzen, klar und lebendig im Denken. Sie konnten sich auf alle Wechselfälle des Lebens einstellen. Das mochte daran liegen, dass die von Roths Kriegsopfer waren. Sie hatten alles verloren, ihre Heimat, ihren Besitz, ihr scheinbar vorbestimmtes Leben als reiche Gutsbesitzer, angesehen, mit einem guten, klangvollen Namen.
Nur der Name war ihnen geblieben, doch darum hatte niemand auch nur einen Pfifferling gegeben, zumal der Adel eh abgeschafft worden war und nur noch ein Bestandteil des Namens war.
Sie waren an ihrem Schicksal nicht zerbrochen und hatten sich von bitterer Armut mit Fleiß und Ausdauer hochgearbeitet, dafür viele Entbehrungen auf sich genommen. Aber ihren Stolz, den hatten sie nie verloren, auch nicht ihren Glauben an die Kraft des Guten, vor allem nicht an die Kraft ihrer Liebe.
Sie hatten es geschafft, und dabei waren sie sich immer treu geblieben.
Sie hatten die Familie zusammengehalten, ihre Tochter zu einem wunderbaren Menschen erzogen, sie hatten sich das Haus nebenan kaufen können und es zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht, der ihnen ein sorgenfreies Leben ermöglichte.
Und nun wollte ihr Opi sie auch noch unterstützen.
Ricky hatte Tränen in den Augen.
Florian und sie würden es auch so schaffen, doch Ricky wusste, dass sie das Angebot ihrer Großeltern nicht ablehnen durfte, die wären tödlich beleidigt gewesen. Sie genossen es, helfen zu können. Und ihr Opi sagte immer, es sei besser, mit einer warmen Hand zu geben und dass man nichts mitnehmen könne.
Ach ja, die Auerbachs und die von Roth …
Ricky wusste, was sie an ihrer Familie hatte, die herzlich und liebevoll war, großzügig und hilfsbereit.
Ihre Schwiegereltern waren auch sehr nett, da konnte sie sich nicht beklagen, doch sie waren emotional ziemlich gebremst und, obwohl sie viel Geld besaßen, auch geizig.
Welch ein Glück, dass Florian so ganz anders war, der im Scherz sogar manchmal sagte, dass er nach der Geburt wahrscheinlich vertauscht worden sei, weil er so überhaupt nicht auf seine Eltern kam, da könnte er eher ein Auerbach sein.
Und Stella.
Die schlug vermutlich manchmal über die Stränge, weil sie nicht mehr durch ihre Eltern kontrolliert werden konnte. An einer Ampel musste Ricky halten, und während sie darauf wartete, dass wieder Grün wurde, fragte sie sich, was ihre Schwiegereltern wohl dazu sagen würden, dass sie studieren wollte.
Ricky hatte keine Ahnung, weil man deren Reaktionen nicht immer voraussehen konnte.
Aber Sorgen machen musste sie sich nicht, Florian würde das übernehmen, und der war ganz auf ihrer Seite und würde seinen Eltern schon klar machen, dass sie sich da nicht einzumischen hatten.
Ihr Florian …
Sie war glücklich mit ihm. Er war ein fantastischer Ehemann und ein fürsorglicher, liebevoller Vater.
Mehr konnte man sich nicht wünschen, sondern nur darauf hoffen, dass es noch lange, lange so bleiben würde.
Vor Schicksalsschlägen war niemand sicher, und es konnte jeden treffen, wie beispielsweise ihre Freundin Lori, die mit ihrem Ehemann Heiner so unbeschreiblich glücklich gewesen war.
Ein Jahr waren die beiden verheiratet gewesen, hatten Pläne für die Zukunft geschmiedet, und dann hatte das Schicksal unerbittlich zugeschlagen. Heiner war unschuldig in einen Autounfall verwickelt worden, bei dem es eine Massenkarambolage gegeben hatte. Die besondere Tragik war, dass es zwar viele Verletzte gegeben hatte, Totalschäden bei den Fahrzeugen, doch nur einen einzigen Todesfall … Heiner.
Warum gerade er?
An dieser Frage wäre Lori beinahe zerbrochen, und es war gut, dass sie sich direkt in psychiatrische Behandlung begeben hatte. Vermutlich hätte es sonst ein böses Ende genommen, weil Lori stark suizidgefährdet gewesen war.
Allmählich fand sie ins Leben zurück, aber die schützenden Mauern des Krankenhauses wollte sie noch nicht verlassen.
Und es lag noch ein weiter Weg vor ihr.
Ricky, die ihre Freundin besuchte, so oft es ging, bekam noch jetzt eine Gänsehaut, als sie an deren letzten Satz dachte, der so traurig, so hoffnungslos geklungen hatte: »Was soll ich denn dort draußen? Ich habe keine Lust, den anderen Leuten beim Leben zuzusehen.«
Warum lebte man meistens so vor sich hin und machte sich nicht bewusst, dass jeder Tag der letzte des Lebens sein konnte?
Warum genoss man seine Tage nicht, ging nicht behutsam mit ihnen um?
Ricky schreckte zusammen, als jemand sie anhupte, an ihr vorbeizog und ihr, wie frech, sogar einen Vogel zeigte.
Sie war unaufmerksam gewesen, und das sollte man beim Autofahren nicht sein. Ab sofort fuhr sie konzentriert und umsichtig.
Sie machte das Autoradio an, leise, leichte Musik ertönte, und als ein Lied gespielt wurde, zu dem sie und Fabian zum ersten Mal miteinander getanzt hatten, wurde Ricky schon wieder sentimental, doch diesmal wollte sie es auch sein …
*
Sie hatten nicht in das Gespräch zwischen Eltern und Tochter hineinplatzen wollen, doch als Magnus und Teresa von Roth sahen, wie ihre Enkelin fortfuhr, machten sie sich auf den Weg nach nebenan.
Anfangs waren sie ja skeptisch gewesen, ob es richtig war, ihrer Tochter und Familie so dicht auf die Pelle zu rücken. Doch diese Entscheidung hatten sie niemals bereut, und eine solche Gelegenheit würde sich so schnell auch nicht wieder ergeben.
Anfangs hatte es nur sechs Häuser gegeben, zwei große und vier kleine und das Herrenhaus der von Riedings auf dem Sonnenhügel, malerisch unterhalb der Felsenburg gelegen, jener geschichtsträchtigen Ruine aus 1495.
Es war ein Glücksfall gewesen, dass Carlo von Heimberg, ein bekannter Architekt, die Siedlung Erlenried erbaut hatte, mit dreißig wunderschönen Einfamilienhäusern, von denen die von Roths, zum Glück, musste man sagen, eines erworben hatten. Inzwischen waren noch einige Häuser hinzugekommen. Man war wild hinter Bauland her, und sobald ein Grundstück erschlossen war, war es auch schon verkauft, zu horrenden Preisen.
Der Sonnenwinkel war hochbegehrt, um hier wohnen zu können, nahm man weite Wege bis zum Arbeitsplatz in Kauf, weil hier ganz einfach eine ganz besondere Lebensqualität mit einem sehr hohen Freizeitwert geboten wurde.
Was neu gebaut wurde war schön, doch nichts kam an die von Carlo Heimberg errichtete Siedlung Erlenried heran, die sogar mehrere Preise gewann.
Ja, es war gut, dass sie hergezogen waren.
Magnus von Roth hatte liebevoll einen Arm um die Schulter seiner Frau Teresa gelegt, als sie zum Nachbarhaus gingen, das nicht zur Neubausiedlung gehörte, sondern schon vorher da gestanden hatte und das mit seinem Walmdach, der großzügigen Bauweise, schon etwas Besonderes war.
Magnus und Teresa waren schlanke hochgewachsene Menschen, denen man ihr Alter nicht ansah, sie waren fit, was dann liegen mochte, dass sie sich viel bewegten und häufig den Sternsee umrundeten, was immerhin zehn Kilometer waren.
Es war eine geniale Entscheidung der Gemeinde gewesen, den See als Naherholungsgebiet einzustufen und nicht zuzulassen, dass Privathäuser bis direkt ans Seeufer gebaut wurden.
Eine Bebauung gab es nur am Sonnenwinkel, und die Häuser in erster Reihe, mit Blick zum See, durften erst nach ein paar Metern errichtet werden, die nötig waren, um einen breiten Wander- und Fahrradweg zu ermöglichen, mit Bänken oder sogar Tischen mit Bänken.
Gebadet werden durfte nur in den beiden Strandbädern, alles andere war verboten, weil es im See gefährliche Unterströmungen gab. Neben einem großen und einem kleinen Restaurant gab es eine Kite- und Surfschule und einen Hochseilgarten zum klettern.
Motorboote waren verboten, segeln, rudern und paddeln war erlaubt, und man konnte Tretboote mieten und mit denen über das Wasser strampeln, was ganz schön anstrengend war, wenn man mit Wind und Wellen zu kämpfen hatte.
Aber der See war wundervoll, und Menschen kamen auch von weiter her, um diese Idylle genießen zu können.
Und das taten die von Roths.
Sie lasen aber auch viel, waren kulturell interessiert, sie waren geistig fit.
Bambi sagte immer voller Bewunderung: »Omi und Opi, ihr seid fit wie zwei Turnschuhe.«
Ja, es ging ihnen gut.
In ihrem Leben hatte es mehr Tiefen als Höhen gegeben, doch sie hatten sich nie unterkriegen lassen, stets positiv gedacht. Und da hatte Magnus von Roth auch einen Satz parat: »Aus einem Ende entsteht immer ein Anfang.«
Ja, es ging ihnen gut.
Sie genossen den Herbst ihres Lebens, das Glück, eine wundervolle Familie zu haben, den Segen sich gefunden zu haben und zu lieben, unverbrüchlich, tief und fest … Haus und Geld waren eine Zugabe, die so manches einfacher machte. Doch das war nichts, woran man sich wärmen konnte.
Sie hatten die Haustür erreicht, Inge, die ihre Eltern schon von Weitem gesehen hatte, hatte sie ihnen geöffnet.
Sie hatten sich heute schon gesehen, und sie hatten auch schon miteinander telefoniert. Das taten sie jeden Tag.
Inge wusste, weswegen sie jetzt hier waren, sie wollten über Ricky sprechen.
Sie kochte einen Darjeeling, weil sie wusste, dass ihre Eltern den nachmittags lieber tranken, weil er bekömmlicher war, zumindest glaubten sie das. Dazu servierte sie ihnen einen selbst gebackenen Zitronenkuchen, von dem sie ihnen den Rest mitgeben würde, weil sie diesen Kuchen liebten.
Werner war nach Hohenborn gefahren, wo er etwas zu erledigen hatte. Auf dem Rückweg würde er Bambi mitbringen.
Inge war sich allerdings sicher, dass diese Besorgung nur vorgeschoben war. Werner wollte seiner kleinen Tochter, die so klein nun auch nicht mehr war, eine zweite Busfahrt ersparen.
Sie würde es auch nicht anders machen.
Bambi war ein so sonniges, herzerfrischendes, liebevolles Mädchen. Ihr gelang es mühelos, alle um den kleinen Finger zu wickeln.
Das wussten sie alle, und doch unternahmen sie nichts dagegen, weil sie Bambi über alles liebten.
Nachdem sie den leckeren Zitronenkuchen gebührend gelobt hatten, wandte Magnus von Roth sich an seine Tochter.
»Inge, du weißt, dass wir uns aus allem heraushalten, weil wir nicht das Recht haben, uns einzumischen. Das hätte uns nicht gefallen und das würde uns auch heute nicht gefallen, sollte jemand es versuchen. Wir möchten aber gern mit dir über Rickys Pläne sprechen, die wir beide ganz großartig finden und die wir in jeder Hinsicht unterstützen wollen.«
Er blickte seine Tochter an.
»Ohne mit ihm gesprochen zu haben, denken wir, dass Werner hocherfreut sein wird, weil er nie begreifen konnte, warum seine Tochter nicht eine akademische Laufbahn eingeschlagen hat. Aber du … nun, du bist ziemlich konservativ und hältst an der Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern fest. Was ja auch überhaupt nicht verkehrt ist. Nur … nun, mein Kind, du kannst manchmal unglaublich stur sein, und da kommst du, wie auch äußerlich, vollkommen auf meine Mutter, deine Großmutter Henriette. Die konnte tagelang schweigen wie die Taiga, wenn es nicht nach deren Kopf ging.«
Sofort begehrte Inge auf.
»Papa, ich bitte dich. Tagelang nichts zu sagen, könnte ich überhaupt nicht durchhalten.«
Magnus von Roth lachte.
»Na, das nicht, aber die beleidigte Leberwurst spielen kannst du schon, wenngleich das mit zunehmendem Alter immer besser wird. Als kleines Mädchen warst du manchmal unerträglich und hast Mama und mich zur Weißglut gebracht.«
Inge war in keiner Weise beleidigt. Sie fiel in sein Lachen mit ein.
»Papa, ich bitte dich, kram keine ollen Kamellen hervor, das alles ist ja wohl nun schon eine ganze Weile her und beinahe nicht mehr wahr.«
»Finde ich auch«, kam Teresa von Roth ihrer Tochter zur Hilfe. »Lasst uns nicht in der Vergangenheit herumwühlen, sondern über Ricky sprechen. Aber eines möchte ich noch sagen, auch wenn ich mich wiederhole, du warst insgesamt ein sehr pflegeleichtes, fleißiges, kluges Mädchen, das uns nur Freude gemacht hat.«
Sie warf Inge einen liebevollen Blick zu, ehe sie leise fortfuhr: »Das tust du noch immer. Wir können dem Himmel nicht dankbar genug sein, dich als Tochter zu haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Töchter so aufopferungsvoll um ihre alten Eltern kümmern. Oft werden die Alten doch in ein Heim abgeschoben, um sie loszuwerden. Magnus und ich reden immer wieder darüber und sagen uns, welches Glück wir doch haben.«
Inge war ganz gerührt.
Es war für sie eine Selbstverständlichkeit, ihren Eltern im Alter etwas von dem zurückzugeben, was sie von ihnen bekommen hatte. Neben sehr viel Liebe, was überhaupt das Wichtigste war, hatten sie ihr alles ermöglicht, eine exzellente Schulausbildung, Klavierunterricht, sie hatte Tennis spielen lernen dürfen, und sie hatten ihr Auslandsaufenthalte ermöglicht, damit sie Sprachen lernen konnte.
Gut, studiert hatte sie nicht, aber gebildet war sie, sie konnte mehrere Sprachen perfekt sprechen, und das hatte sie ihren Eltern zu verdanken, die, um ihr das zu ermöglichen, auf so manches verzichtet hatten.
»Mama, Papa, das kann ich voll wiedergeben, ich bin überglücklich, euch als meine Eltern zu haben, und ich bete jeden Tag, dass Ihr mir noch lange, lange erhalten bleibt.«
Das war jetzt ein Augenblick, in dem die Gefühle überzuschwappen drohten, in dem man sich vor lauter Nostalgie gegenseitig beweihräucherte.
Das musste nicht sein, das wollten, vor allem brauchten alle drei nicht, weil sie wussten, was sie aneinander hatten.
Außerdem saßen sie beisammen, um etwas zu besprechen, was sehr real war und nichts als die Gegenwart betraf, die sich, wenn für Ricky alles nach Plan verlief, zu einer wundervollen Zukunft entwickeln konnte.
»Reden wir über unsere Ricky«, rief Inge, und dann konnte es losgehen.
Es wurde ein sehr konstruktives Gespräch, weil sich die Drei einig waren und an einem Strang zogen.
*
Nachdem Ricky mit ihren Eltern und Großeltern persönlich über ihre Zukunftspläne gesprochen hatte, nachdem auch Jörg und Stella eingeweiht worden waren, war es allerhöchste Zeit, auch die Rückerts vorsichtig auf das Kommende vorzubereiten. Das war unumgänglich, denn die würden es ihnen niemals verzeihen, wenn sie diese Neuigkeit durch Fremde erführen.
Fabian hatte sich bereiterklärt, mit seinen Eltern zu sprechen.
Ricky war so froh, dass Fabian sich opferte, auch Stella hielt es für das Beste, dass ihr Bruder diese Rolle übernahm, weil er von den Rückerts das größte diplomatische Geschick besaß.
Der Notar und Rechtsanwalt Dr. Heinz Rückert und seine Ehefrau Rosmarie gehörten ganz eindeutig zu den wichtigsten und angesehensten Bürgern von Hohenborn, und das genossen sie auch. Sie waren freundlich, nett, im Grunde genommen war gegen sie nichts einzuwenden. Es fehlte ihnen halt die Herzlichkeit, die die Auerbachs und die von Roths auszeichnete.
Fabian war da, wie gesagt, ganz eindeutig aus der Art geschlagen, und auch Stella, nicht ganz so liebenswert wie ihr Bruder, war anders als ihre Eltern.
Es konnte durchaus sein, dass Fabian und Stella sich sehr früh gebunden und dann auch gleich geheiratet hatten, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und es kam gewiss auch nicht von ungefähr, dass sie sich beide für zwei Auerbach-Sprösslinge entschieden hatten.
Die Rückerts hatten erst kürzlich eine prachtvolle Villa bezogen, die ganz nach ihren Wünschen gebaut worden war.
Natürlich fragte sich so manch einer, warum sie sich das angetan hatten.
Zwei ältere Menschen allein in einem »Palazzo Protzo«, wie Stella ein wenig abfällig die Riesenvilla ihrer Eltern genannt hatte.
So eine Villa zu unterhalten, machte nicht nur viel Arbeit, der Unterhalt verschlang auch ein ganz schönes Sümmchen.
Mit dem Geld hätte man durchaus etwas anderes anfangen können.
Aber nun ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen …
Fabian saß seinen Eltern im »gelben Salon« gegenüber und fühlte sich mehr als unbehaglich.
Er hatte es ihnen gesagt, und dann war seitens seiner Eltern ein Sturm losgebrochen.
Das Verrückte dabei war, dass es nicht die Idee ihrer Schwiegertochter war, über die sie sich aufregten, sondern sie waren außer sich, weil dieser Spleen Geld kostete, für Studiengebühren, Bücher, die Tagesmutter.
Sie beschworen ihren Sohn, es seiner Frau auszureden.
»Wenn du es nicht willst oder kannst, mein Sohn«, bemerkte Heinz Rückert, »dann werde ich mal mit Ricky reden. Also wirklich, jetzt studieren zu wollen. So etwas Verrücktes habe ich noch nicht gehört. Wenn sie Langeweile hat und daheim nicht ausgelastet ist, dann soll sie sich einer karitativen Aufgabe zuwenden. Meinethalben kann sie auch ein Kochbuch schreiben oder eines über die Herstellung von Marmeladen. Davon versteht sie was. Die Himbeermarmelade, die sie uns gebracht hat, ist köstlich.«
Fabian hatte schweigend zugehört.
In ihm kochte es.
Wie war sein Vater denn drauf?
Er atmete tief durch, dann sagte er erstaunlich ruhig: »Papa, es ist alles besprochen. Wir sind uns einig, und wenn das nicht so wäre, findest du nicht auch, dass das eine Sache zwischen Ricky und mir ist? Wir sind keine Kinder mehr.«
Jetzt griff Rosmarie ein, die hektische rote Flecken auf ihrem Gesicht hatte, das allerdings nicht wegen des Gesprächs, sondern weil sie sich maßlos darüber ärgerte, dass die Auerbachs es vor ihr erfahren hatten.
Das durfte sie natürlich nicht aussprechen, weil Fabian das nicht verstehen würde. Er war der Meinung, dass sowohl seine Eltern, als auch seine Schwiegereltern, froh darüber sein konnten, dass man sie in alles mit einbezog, dass aber darüber, wann wer was zuerst erfahren hatte und erfahren durfte, keine Strichliste geführt wurde und man sich im Übrigen nicht bei irgendwelchen Ausscheidungskämpfen befand, in denen über den ersten oder zweiten Platz entschieden wurde.
»Apropos, Kinder«, sagte sie. »Ihr habt immerhin vier davon. Was soll denn aus denen werden? Du in der Schule, deine Frau in der Uni, weil sie sich als Spätberufene fühlt. Also, bei allem Wohlwollen, und wir lieben unsere Enkel sehr, eines möchte ich klarstellen. Bei uns könnt ihr sie nicht parken. Zu Besuch ja, als Dauerzustand … eindeutig nein. Papa und ich haben zu viele gesellschaftliche Verpflichtungen.«
Seine Mutter konnte wirklich sehr, sehr nett sein, und er mochte sie, schließlich war sie seine Mutter. Doch manchmal könnte er sie schütteln, so wie gerade jetzt.
Es fiel ihm schwer, ruhig und sachlich zu bleiben.
»Mama, diese gesellschaftlichen Verpflichtungen hattet ihr schon immer, die haben uns durch unser Leben begleitet. Stella und ich konnten eher die Namen unserer Kinderfrauen aussprechen als Mama und Papa sagen, weil wir diese Frauen kannten und ihr für uns nicht mehr als Besucher wart, die hier und da vorbeikamen. Oder wir wurden herausgeputzt, wenn es galt, für ein werbewirksames Familienfoto zu posieren.«
»Willst du damit sagen …«
Fabian unterbrach seine Mutter.
»Mama, es ist vorbei, Vergangenheit. Und aus Stella und mir ist ja was geworden, ihr könnt uns und unsere Familien für ›gut‹ mitnehmen. Also, keine Sorgen, aber auch keine Vorwürfe. Ich bin hier, um euch zu informieren, mehr nicht. Ricky und ich haben alles im Griff, und ich bin sehr stolz auf meine Frau, ich bewundere sie für das, was sie plant, und, wie gesagt, sie hat meine volle Unterstützung, die von Jörg und Stella im Übrigen auch.«
»Na ja, ich weiß nicht, ob Stella die Kompetenz besitzt, das beurteilen zu können«, wandte Heinz Rückert ein. Eine Leuchte war sie nie, und vom Ehrgeiz besessen auch nicht. Und jetzt die Erbschaft … Finchen hat da keine glückliche Entscheidung getroffen.«
Fabian hatte es niemals ausgesprochen, doch jetzt konnte er nicht anders. Einmal musste es gesagt werden.
»Papa, bei Stella wäre sicherlich so manches anders gelaufen, wenn du sie nicht ständig unter Druck gesetzt hättest, wenn nicht diese irre Erwartungshaltung von dir gewesen wäre. Nachdem du mich nicht dazu zwingen konntest, in deine Fußstapfen zu treten, weil ich viel lieber Lehrer geworden bin, hast du es bei Stella versucht. Wenn du deine Tochter nur ein wenig kennen würdest, hättest du dir sagen müssen, dass sie für diesen Beruf total ungeeignet ist, dass sie die Juristerei nicht die Bohne interessiert. Mit dem ständigen Druck, den du ausgeübt hast, hast du ihr die Lust am Lernen genommen. Und dennoch ist ein Abitur mit einer glatten Zwei doch ganz hervorragend. Andere Eltern hätten ihr Kind für diese Note auf einen Sockel gestellt, sie wären außer sich vor Freude gewesen. Euch war das nie genug, und in Stellas Fall war es ganz besonders schlimm, ihr habt ihr das Gefühl vermittelt, eine Versagerin zu sein.«
»Sie hätte es besser gekonnt, wenn sie fleißiger gewesen wäre«, versuchte Heinz Rückert sich zu entschuldigen, den die harten Worte seines Sohnes schon betroffen machten.
»Ach, Papa …«, sagte Fabian. »Lasst uns einfach davon aufhören. Stella ist mit ihrem Leben zufrieden, sie hat mit Jörg ihr Glück gefunden, und das Geld von Tante Finchen, ich gönne es Stella wirklich von ganzem Herzen, nun etwas Eigenes zu haben und nicht nur auf Jörg angewiesen zu sein, dem nichts vorzuwerfen ist, weil er sie wirklich verwöhnt und nur ihr Bestes will. Dieses Geld gibt ihr eine gewisse Unabhängigkeit und stärkt ihr Selbstwertgefühl.«
»Ach, und daran sind wir jetzt auch noch schuld, dass Stella kein Selbstwertgefühl hat?«, ereiferte Rosmarie sich.
Fabian kannte natürlich auch seine Mutter sehr gut und wusste, dass sie sich so ereiferte, so heftig reagierte, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte.
Von Rickys Großeltern wusste Fabian, dass seine Eltern sich mittlerweile durchaus bewusst waren, dass sie bei ihren Kindern eine ganze Menge falsch gemacht hatten.
Doch das würden sie ihnen gegenüber nicht zugeben. Sie konnten es nicht, weil bei den Rückerts Konflikte niemals offen ausgetragen wurden, sondern man kehrte es am liebsten unter den Tisch.
Irgendwie taten sie ihm leid. Sie konnten nicht aus ihrer Haut heraus und waren noch immer der Meinung, ihren Seelenfrieden im Außen finden zu können.
Wer nach der Devise lebte, mein Haus, mein Auto, mein, Boot, erlitt immer Schiffbruch.
Fabian war sich sicher, dass ihre Eltern sich auch von dieser Prachtvilla mehr versprochen hatten. Er wünschte sich um ihretwillen von ganzem Herzen, dass sie in diesem Leben noch die Kehrtwende schafften und endlich begriffen, worauf es wirklich ankam.
Sie taten ihm wirklich leid, und deswegen zeigte er sich versöhnlich und holte aus seiner Tasche Bilder, die die Kinder für ihre Großeltern gemalt hatten.
Und darüber freuten sich Heinz und Rosmarie wirklich.
Sein Vater wollte sogar ein von Sandra gemaltes Bild in seinem Büro aufhängen, und seine Mutter wollte zuerst alle Bilder ihren Freundinnen zeigen.
Das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
*
Es war vollbracht.
Dr. Roberta Steinfeld war, begafft von einer Reihe von neugierigen Zuschauern, in das ehemalige Riedel-Haus eingezogen, in dem mehr Platz war, als sie in Erinnerung hatte, und in dem ihre Möbel ein wenig verloren wirkten.
Vielleicht hätte sie doch nicht so großzügig auf das meiste verzichten sollen.
Nun, für solche Überlegungen war es zu spät.
Das, was sie brauchte, hatte sie, ein Bett, einen Schrank, mehr als nur einen Tisch und einen Stuhl.
Von den Riedels hatte sie die komplette Küche übernommen, die wirklich toll war.
Wenn sie ehrlich war, sah Roberta sich da nicht als die perfekte Hausfrau herumwerkeln.
Ihr Beruf war ihr Leben, deswegen hielten sich ihre Kochkünste in Grenzen. Bei einem Wettbewerb würde sie damit keinen Preis gewinnen.
Musste sie nicht.
Auf jeden Fall würde sie in ihrer Küche den Spruch aufhängen »Nobody is perfect«.
Sie hatte den Umzug mehr oder weniger allein bewältigt. Nicki, die doch noch darauf bestanden hatte, ihr zu helfen, und davon war sie nicht abzubringen gewesen, hatte absagen müssen, weil sie mit ihrem neuen Auftraggeber nach Brasilien reisen musste, um dort für ihn zu übersetzen.
Frau Hollenbrink, die auch schon Enno Riedels Sprechstundenhilfe gewesen war, war ein Schatz. Sie hatte ihr ein paar kräftige Männer besorgt, die die Möbel wenigstens schon mal in die dafür vorgesehenen Räume verteilt hatten.
Irgendwann würde sie es sich gemütlich machen, doch vorrangig war sie daran interessiert, die Praxis zu eröffnen.
Sie war aufgeregt wie an ihrem ersten Arbeitstag als junge Assistenzärztin, als sie die wirklich schönen, vor allem sehr zweckmäßigen Arbeitsräume betrat.
Es war alles vorhanden, was man brauchte. Was natürlich nicht mit dem zu vergleichen war, was sie aufgegeben hatte. Das hier war aber auch keine große Großstadtpraxis, sondern eine in einer ländlichen Idylle.
Ursel Hollenbrink hatte ihr als Willkommensgruß einen schönen Blumenstrauß hingestellt, und auch Enno hatte es sich nicht nehmen lassen, sie mit lieben Grüßen und ebenfalls einem Blumenstrauß in ihrem neuen Leben willkommen zu heißen.
Es war rührend.
Sie freute sich.
Doch wo blieben die Patienten?
Von Enno Riedel wusste sie, und das hatte Frau Hollenbrink auch bestätigt, und das bewiesen auch die ihr vorgelegten Abrechnungen, dass die Praxis jeden Tag rappelvoll gewesen war.
Heute war das Wartezimmer leer.
Am späten Vormittag verirrte sich ein älterer Herr in die Praxis, der allerdings sofort wieder das Weite suchte, als er statt des Doktors die Frau in Weiß erblickte.
»Die Leute werden sich daran gewöhnen«, wurde sie von ihrer Sprechstundenhilfe getröstet, »es muss sich erst noch herumsprechen.«
Das stimmte so nicht.
Von Enno Riedel wusste sie, dass er alle Patienten angeschrieben hatte, um sie über die Veränderung zu informieren. Und sie wusste auch, dass er sehr nett über sie geschrieben hatte und die Patienten gebeten hatte, ihr das Vertrauen zu schenken, das sie ihm entgegengebracht hatten.
Je mehr Zeit verging, ohne dass etwas geschah, umso nervöser wurde Roberta.
Hatte sie übereilt eine falsche Entscheidung getroffen?
Aus finanziellen Gründen musste sie jetzt nicht panisch werden. Da könnte sie durchaus eine längere Durststrecke überbrücken.
Darum ging es nicht.
Sie wollte arbeiten!
Gegen Mittag kamen der Professor Auerbach, den sie bereits kannte und sehr schätzte, und seine Frau vorbei, um ihr ebenfalls Blumen zu bringen.
Das munterte sie ein wenig auf, zumal sie Inge Auerbach sehr sympathisch fand.
»Die Leute vom Sonnenwinkel sind ein wenig schwerfällig, sie brauchen eine Weile, um mit Veränderungen fertig zu werden. Dr. Riedel war halt sehr beliebt, und man hat es ihm sehr übel genommen, dass er gegangen ist. Ich glaube, man überträgt das jetzt auf Sie, obschon Sie nichts dafür können, Frau Dr. Steinfeld. Vielleicht ist es nicht einmal verkehrt, nicht direkt überrannt zu werden. Da haben Sie Zeit, sich einzugewöhnen, sich mit allem vertraut zu machen. Schließlich ist hier im Sonnenwinkel alles neu für Sie.«
Roberta hätte ihr jetzt sagen können, dass sie sich in einer knappen Viertelstunde bereits den Überblick verschafft hatte und dass in dieser Praxis doch alles sehr überschaubar war.
Sie unterließ es, schließlich meinte die nette Frau Auerbach es ja nur gut mit ihr.
Sie hatten hinreichend Zeit, miteinander zu plaudern, weil einfach kein Patient kam, und das war zermürbend, sehr zermürbend.
*
Die Mittagspause verbrachte Roberta im Haus. Sie kochte sich einen Kaffee, und eigentlich hätte sie auch etwas essen müssen, doch sie war unfähig, sich auch nur ein Butterbrot zu schmieren.
Wellen der Enttäuschung durchfluteten sie, die von Wellen der Zweifel abgelöst wurden.
Man hatte sie gewarnt, allen voran ihre Freundin Nicki, und sie hatte es nicht wahrhaben wollen, dass die Menschen in der Provinz so anders sein sollten, als die in der Großstadt.
Nun hatte sie die Quittung.
Roberta neigte weder zu Depressionen noch zu Pessimismus, im Gegenteil. Wenn sie nicht ein so positiver Mensch wäre, hätte sie es mit ihrem Ex nicht so viele Jahre ausgehalten.
Nein, was hier geschah, konnte sie nicht beeinflussen. Und das war es, was sie so durcheinanderbrachte.
Was hatten die Leute hier gegen sie? Warum gab man ihr nicht eine Chance, zumal Dr. Riedel, der allseits Beliebte, sie seinen Patienten empfohlen hatte.
Natürlich hatte ein Arzt keine Sonderstellung, auch hier gab es Sympathie und Antipathie, aber eine kollektive Ablehnung der gesamten Bevölkerung, davon hatte sie noch nichts gehört.
Roberta begann sich alle nur möglichen Gedanken zu machen, und dann kam ihr doch tatsächlich in den Sinn, was Nicki ihr gesagt hatte, die sie beschworen hatte, auf keinen Fall am Montag die Praxis zu eröffnen. Sie hatte es zuvor noch nie gehört und während ihrer immerhin schon recht langen beruflichen Laufbahn hatte es weder bei ihr noch den zahlreichen Angestellten eine Rolle gespielt.
»Wer Montag beginnt, der bleibt nicht lange«, hatte Nicki gesagt und behauptet, das gelte für Angestellte, aber auch für freie Berufe.
Nun, sie hatte es ignoriert und montags die Praxis eröffnet. Sollte das tatsächlich ein schlechtes Omen sein?
Roberta stand auf, begann wie ein gefangener Tiger im Raum herumzulaufen, ging hinaus in den Garten.
Am liebsten würde sie jetzt einen langen Spaziergang zum See machen, um den Kopf frei zu bekommen.
Doch sie war im Augenblick so empfindlich, dass ihr der neugierige Blick eines einzigen Menschen wie ein Spießrutenlaufen vorkäme.
Sie ging wieder hinein, weil ihr einfiel, dass sie mit Enno Riedel überhaupt nicht darüber gesprochen hatte, ob es für den doch recht großen Garten, der auch sehr schön angelegt war, überhaupt einen Gärtner gab.
Das war auch so etwas, mit Gärten kannte sie sich nicht aus, allenfalls mit bepflanzten Terrassen. Und was da herumstand, in Kübeln und Töpfen wuchs, war nicht nur überschaubar, sondern pflegeleicht. Das hatte ihre Haushaltshilfe so ganz nebenbei mit erledigt.
Und da war sie schon beim nächsten Problem.
Fürs Haus brauchte sie auch jemanden, am besten eine Frau, die auch noch gut kochen konnte, halt so etwas wie eine gute Fee.
Das hatte sie gehabt, all die Jahre über. Und wenn es gegangen wäre, hätte sie ihre Erna am liebsten mitgenommen.
Sie kochte sich noch einen Kaffee.
Es war falsch gewesen, eindeutig falsch.
Sie war zwar noch jung genug, um auch flexibel zu sein.
Für sie wäre es vermutlich einfacher gewesen, einen Job in New York anzunehmen, in San Francisco oder London, irgendwo in einer Großstadt. Trotz aller Verschiedenartigkeit glichen sich Großstädte, ebenso wie die Menschen, die in den Städten lebten. Sie hatten eine andere Selbstverständlichkeit.
Was also, zum Teufel, hatte sie getrieben, sich auf das hier einzulassen?
Weil sie es als so eine Art von Zeichen gesehen hatte?
Ja, vermutlich schon, weil sie eine gefühlte Ewigkeiten von Enno Riedel nichts gehört hatte und weil alles so ganz wunderbar passte.
Enno hatte ihr das Leben im Sonnenwinkel in den allerschönsten Farben geschildert. Für ihn waren seine Patienten etwas ganz Besonderes gewesen.
Doch gerade weil sie sich eine so lange Zeit nicht gesehen und nichts voneinander gehört hatten, hatte sie ganz vergessen, dass Enno Riedel sich sehr schnell und enthusiastisch für etwas begeistern konnte.
Und sie hatte überhaupt nicht daran gedacht, dass er nicht als Single im Sonnenwinkel gelebt hatte, sondern als ein glücklich verheirateter Mann mit einer sehr patenten Ehefrau und entzückenden Kindern.
Das war schon ein Unterschied, ein gewaltiger sogar!
Roberta merkte, dass sie sich immer mehr in einen Zorn hineinsteigerte, der sie ungerecht werden ließ, ihr jegliche Objektivität nahm.
Sie zog ihren weißen Kittel wieder an, dann lief sie hinüber in die Praxis. Es war viel zu früh, doch das war ihr so ziemlich egal.
Das einzig Positive, was sie augenblicklich sah, war die Tatsache, dass es schon sehr komfortabel war, ihren Arbeitsplatz direkt im Haus zu haben. Das war besonders angenehm bei schlechtem Wetter.
Nur …
Sie würde liebend gern eine halbe Stunde durch Sturm und Regen laufen oder ebenso lange mit dem Auto im Stau stehen, wenn sie wüsste, dass sie danach in eine gut besuchte Praxis käme, in der viele Patienten auf sie warteten, die sich freuten, sie zu sehen, damit sie ihnen helfen konnte.
Das hatte sie gehabt.
Es hatte sogar Wartelisten gegeben.
Roberta seufzte.
Waren die Leute im Sonnenwinkel plötzlich alle gesund und hatten keinen Arzt mehr nötig?
Sie schaute auf die wunderschönen Blumensträuße, las noch einmal Ennos Karte mit all seinen guten Wünschen.
An ihm lag es nicht.
Er hatte sie nicht übers Ohr gehauen.
Er konnte in die Menschen nicht hineinschauen. Er hatte nun wirklich nicht voraussehen können, dass er ihr den Schritt in eine Katastrophe geebnet hatte.
Nun verrannte sie sich in etwas, was gefährlich war, und so war sie doch nicht. Wo war die Kämpferin Roberta Steinfeld geblieben?
Die Praxiseinrichtung war okay, wenngleich es noch eine Menge zu verbessern gab, ehe ihre Standards erreicht waren. Vielleicht musste sie die nicht erreichen und sollte sich mit dem zufriedengeben, was Enno ihr hinterlassen hatte.
Stopp!
Bis hierher und nicht weiter!
Heute war ihr erster Tag, morgen konnte die Welt schon ganz anders aussehen, und wenn nicht morgen, dann übermorgen.
Sie war eine gute Ärztin, eine sehr gute sogar, und es wäre doch gelacht, wenn sie das hier nicht unter Beweis stellen dürfte.
Als Ursel Hollenbrink in die Praxis kam, auch zu früh, bemerkte sie ganz verwundert. »Oh, Frau Doktor, Sie sind ja schon da.«
Es lag Roberta auf der Zunge zu sagen: ›Ja, um die nächsten Stunden mit nichtstun zu verbringen‹, doch das verkniff sie sich, stattdessen ließ sie sich von ihrer Sprechstundenhilfe erklären, wie Enno alles gehandhabt hatte. Ein wenig umständlich, stellte sie sehr schnell fest und sagte direkt, was sie anders haben wollte.
Sie hatten sehr viel Zeit, das alles zu besprechen, was Ursel Hollenbrink übrigens gut und auf jeden Fall effektiver fand, weil ihnen auch in der Nachmittagssprechstunde niemand zu nahe trat.
*
Die Sprechstunde war beinahe vorbei, als doch tatsächlich zwei Patienten sich in die Praxis verirrten, die von Frau Hollenbrink freundlich und sehr erleichtert begrüßt wurden.
Es waren Teresa und Magnus von Roth, die sich durchchecken lassen wollten.
Als Roberta deren Patientendaten sah, bemerkte sie, dass eine Generaluntersuchung gerade erst vor drei Wochen stattgefunden hatte, bei der es keinerlei Auffälligkeiten gegeben hatte. Alle Werte und Ergebnisse waren ganz hervorragend gewesen. Und auch heute machten die beiden Herrschaften einen fitten Eindruck.
Man konnte daran fühlen, dass Inge Auerbach die treibende Kraft gewesen war, die ihre Eltern gebeten hatte in die Praxis zu gehen.
Das war nett gemeint gewesen, verbesserte Robertas Laune allerdings nicht gerade.
Wenn es ihr darum ginge, Geld in die Kasse zu bekommen, hätte sie jetzt natürlich das ganze Programm abspulen, die von Roths für den nächsten Morgen für die Laboruntersuchungen in die Praxis bestellen können.
So war sie nicht drauf.
Roberta beschloss, mit offenen Karten zu spielen, kam auf die Untersuchungsergebnisse zurück, die alle top waren, dann erkundigte sie sich: »Oder hat jemand von Ihnen ein akutes Problem?«
Weder Magnus noch Teresa waren so etwas wie Staatsschauspieler. Sie konnten und wollten nicht lügen. Also gaben sie zu, von ihrer Tochter geschickt worden zu sein.
»Aber mit uns können Sie rechnen, Frau Doktor«, beteuerte Magnus von Roth. »Wir werden auf jeden Fall als Patienten zu Ihnen kommen, und glauben Sie, es wird sich im Sonnenwinkel herumsprechen, welch sympathische Frau Sie sind. Ehrlich gesagt glauben wir wirklich, dass es nichts mit Ihnen zu tun hat, sondern dass alle sauer sind, weil Dr. Riedel gegangen ist.«
»Hier gehen die Uhren ein wenig langsamer«, fügte seine Frau hinzu. »Wir mussten uns auch erst daran gewöhnen, doch jetzt sind wir sehr glücklich hier, und das werden Sie auch schon sehr bald sein.«
Die von Roths und Roberta waren sich von der ersten Sekunde an sympathisch, und insgeheim war Roberta froh, dass sie gekommen waren. Und das lag nicht daran, dass sie mit ihnen die restliche Zeit der Nachmittagssprechstunde totgeschlagen hatte, sondern dass sie sich sagen konnte, dass sie neben Frau Hollenbrink, die wirklich ein Goldschatz war, die Auerbachs hier lebten, die von Roths, alles ganz wunderbare Menschen.
Das war doch schon mal ein Anfang, oder?
Ehe die von Roths gingen, gaben sie ihr noch den Tipp, dass man im Gasthof »Seeblick« ganz ordentlich essen könne.
Und da sie das auch schon von Enno erfahren hatte, beschloss Roberta, genau dorthin zu gehen. Vielleicht war es gar nicht so verkehrt, sich zu zeigen, präsent zu sein, damit die Menschen hier sich wenigstens schon mal an ihren Anblick gewöhnen konnten und mitbekamen, dass auch sie ein ganz normaler Mensch war und nicht ein feuerspeiendes Ungeheuer oder eine Krake mit hunderten von Fangarmen.
»Danke, dass Sie gekommen sind«, bedankte Roberta sich. »Es freut mich, Sie kennengelernt zu haben.«
»Nun, gebracht hat es Ihnen ja leider nichts, weil Sie uns auf die Schliche gekommen sind«, bedauerte Teresa.
»Doch, es hat mir sehr viel gebracht. Ich habe Sie kennengelernt, zwei ganz wunderbare Menschen.«
»Und wir freuen uns, dass Sie die Praxis übernommen haben, Frau Doktor. Von unserem Schwiegersohn wissen wir, wie qualifiziert Sie sind, eine Bereicherung für den Sonnenwinkel. Wenn die Leute erst mal dahinterkommen, was für ein Juwel sich hier bei uns angesiedelt hat, werden Sie die Praxis stürmen.«
Es fielen noch viele nette Worte, auf allen Seiten, und als Roberta sich wenig später von Frau Hollenbrink verabschiedete und ihr einen schönen Feierabend wünschte, fühlte sie sich schon sehr viel besser und war nicht mehr so niedergeschlagen.
Ihr Kampfgeist erwachte wieder.
Sie musste gelassener sein.
Sie hatte eine Arztpraxis eröffnet, nicht eine Boutique, in die man gleich am ersten Tag strömte, um eventuell ein Schnäppchen zu ergattern.
Dieser Gedanke erheiterte sie.
Im Geiste sah sie sich vor der Praxistür stehen und aus einem Korb Ärztemuster verteilen, davon hatte sie im Medikamentenschrank eine ganze Menge gesehen. Vieles davon würde sie nicht verteilen, sondern fachgerecht entsorgen, weil sie die Schul- und Gerätemedizin nicht ablehnte, wenn es unumgänglich war, sie selbst jedoch eine Anhängerin der Naturheilkunde war, in der sie sich ganz hervorragend auskannte und auch immer weiterbildete.
Das war für die Menschen aus dem Sonnenwinkel ebenfalls neu, doch Enno hatte darin kein Problem gesehen, ganz im Gegenteil. Wer es vorzog, in der Natur zu leben, war auch der Naturheilkunde gegenüber aufgeschlossen. Er kannte sich da nicht aus, hatte seinen Patienten aber auch schon klargemacht, dass es besser war, auf die Selbstheilungskräfte des Körpers zu vertrauen als sofort beim Anflug eines kleinen Schnupfens oder Hustens zur Chemiekeule zu greifen.
Ach ja, am grauen Himmel zeichnete sich für Roberta ein schmaler Lichtstreif ab.
Sie würde es schaffen, das war das Mantra, das sie sich immer wieder vorsagen musste.
Und damit sie es nicht gleich wieder vergaß, sondern verinnerlichte, begann sie direkt damit …
*
Der Gasthof »Seeblick« lag am Ortsrand von Erlenried, Richtung Hohenborn.
Es war ein umgebauter alter kleiner Bauernhof, den man gerade so umgestaltet hatte, um ihn funktionsfähig zu machen. Doch das machte auch den Charme dieses Landgasthofes aus, der sehr malerisch oberhalb des Sees lag.
Der Name »Seeblick« war zutreffend, man hatte von hier aus einen ganz wunderbaren Blick auf den See.
Neben dem Eingang gab es eine sehr schöne große Sonnenterrasse, die bei schönem Wetter und an den Wochenenden bestimmt stark frequentiert wurde.
Jetzt waren die Tische und Stühle verwaist.
Nun, es war abends, die Sonne schien nicht, sondern war hinter dunklen Wolken versteckt. Es sah ganz nach Regen aus, und es war windig.
Roberta atmete tief durch, ehe sie die Gaststube betrat, die, wie es bei alten Häusern oftmals der Fall war, nur eine geringe Raumhöhe hatte. Innen war sehr viel Holz verarbeitet worden. Dieses dunkle Gebälk zwischen den weiß gekalkten Wänden machte die verwinkelte Gaststube gemütlich.
Es waren nur wenige Gäste da.
Roberta fragte sich, ob das immer so war und die Leute hier lieber daheim in ihren hübschen Häusern blieben.
Das war auch so etwas, was die Menschen hier von den Großstädtern unterschied. Da lud man sich gegenseitig nicht nach Hause zum Essen ein, sondern verabredete sich entweder in seinem Lieblingsrestaurant miteinander oder besuchte eines, das gerade angesagt war.
So, das reichte jetzt!
Schon wieder musste sie sich zur Ordnung rufen, weil sie bereits erneut Vergleiche anstellte.
Sie lebte jetzt hier, freiwillig. Niemand hatte sie mit vorgehaltener Waffe gezwungen, herzuziehen. Und nun musste sie sich an die Gepflogenheiten der Menschen hier anpassen, nicht umgekehrt!
Neugierige Blicke trafen sie, und Roberta wusste sofort, dass die Gäste sie als die neue Ärztin erkannten.
Roberta ignorierte die Blicke, grüßte freundlich, dann setzte sie sich an einen Tisch, von dem aus sie nicht so genau beobachtet werden konnte.
Der Wirt kam um den Tresen herum, er war ein massiger Mann, der sich ihr behäbig näherte.
Sein Gesicht war leicht gerötet, er war schweratmig, für sie als Ärztin sofort als ein Blutdruckpatient erkennbar, der hoffentlich medikamentös richtig eingestellt war.
Er musste abnehmen, sich mehr bewegen.
Sie war keine Anhängerin von der Bewegung »Fit for life«, bei der man an Salatblättchen herumnagte und sich die Seele aus dem Leib rannte.
Eine gesunde Lebensführung war lebensverlängernd und ließ einen ohne oder nur mit wenigen Medikamenten auskommen.
Verflixt noch mal!
Sie war hier als Gast, nicht als Ärztin. Sie konnte es einfach nicht lassen.
Sie sagte dem Wirt, dass sie gern etwas essen würde.
Er musterte sie.»Groß ist die Auswahl bei uns nicht«, entschuldigte er sich beinahe.
»Ich glaube, dass ich etwas finden werde«, erwiderte Roberta freundlich und schenkte ihm ein Lächeln, das er allerdings ignorierte und weiterhin mürrisch dreinblickte. Er gehörte offensichtlich zu den Menschen, die zum Lachen in den Keller gingen. Für einen Wirt nicht gerade die richtige Einstellung.
Er schlurfte zum Tresen zurück, holte von da eine in grünes Plastik eingebundene Karte, brachte sie Roberta, ehe er sich wieder abwandte, brummelte er: »Sie können auch noch Zanderfilet vom Grill haben mit Gemüse und Rosmarinkartoffeln, dazu einen Salat, steht nicht auf der Karte.«
Roberta gab ihm die Karte zurück.
»Wunderbar, dann nehme ich den Zander, dazu hätte ich gern einen trockenen Weißwein und ein Mineralwasser mit nur wenig Kohlensäure.«
Er staunte sie so richtig an.
Es kam wohl nicht häufig vor, dass jemand sich so spontan entschied, ohne vorher in die Karte zu blicken und ohne sich nach dem Preis zu erkundigen.
»Mineralwasser haben wir nur mit und ohne, mit wenig Kohlensäure haben wir keines.«
»Macht nichts, dann bitte ohne Kohlensäure.«
Er sagte nicht, welchen Wein er im Angebot hatte, hoffentlich erlebte sie keine böse Überraschung. Ringsum und am Tresen wurde nämlich ausschließlich Bier getrunken.
Ach was, sie durfte nicht so pessimistisch sein. Wer in dieser ländlichen Idylle Zanderfilet anbot, der hatte auch einen guten Wein dazu.
Es dauerte nicht lange, da bekam sie Wasser und Wein serviert und kurz darauf den Salat, serviert auf einem hübschen Teller, bestehend aus mehreren Salaten, angemacht mit einem köstlichen Dressing.
In diesem Augenblick beschloss Roberta, keine Vorurteile mehr zu haben.
Der Fisch war frisch, auf den Punkt gegrillt, dazu wurde mediterranes Gemüse serviert, und die Rosmarinkartoffeln waren ebenfalls hervorragend.
Hier stand jemand in der Küche, der von seinem Handwerk etwas verstand, und Roberta fragte sich, wie sich das für den Wirt rechnete. Spitzenköche kosteten viel Geld.
Sie war mehr als zufrieden, all ihr Ärger war vergessen. Sie wollte gerade den Wirt heranwinken, um zu zahlen, als sie sah, wie eine Frau aus der Küche kam, ohne Zweifel seine Frau. Obwohl man eigentlich eher bei einem Koch oder einer Köchin eine gewisse Beleibtheit vermutete, war sie schlank, aber sie machte einen erschöpften Eindruck.
Da stimmte etwas nicht.
Ein Eindruck, der sich verstärkte, als sie durch das Lokal ging, um Gäste, die sie kannte, zu begrüßen.
Höflichkeitshalber blieb sie auch an Robertas Tisch stehen, die bemerkte sofort die feinen Schweißperlen auf der Stirn der Frau, die verkrampfte Körperhaltung.
Sie hatte Schmerzen, die sie tapfer zu unterdrücken suchte.
Alles deutete auf einen Herzinfarkt hin, die Körperhaltung, der feine Schweiß, die fahle Gesichtshaut.
Sie war hier zwar Gast, aber sie war in erster Linie Ärztin. Sie sprach die Frau auf die von ihr erkannten Symptome an, die sie bestätigte.
Sie bat sie, Platz zu nehmen, dann fühlte sie den Puls der Frau, der ihr praktisch um die Ohren flog.
Sie fragte nicht, sie erklärte nichts, sondern zog ihr Handy aus der Tasche, drückte die eingespeicherte Notruftaste und erklärte, worum es ging und dass eine dringende Einweisung ins Krankenhaus zu erfolgen hatte.
Die Frau stand neben sich, sie hing mehr als sie saß auf dem Stuhl.
Mittlerweile hatten sich nicht nur der Wirt, sondern auch alle Gäste um sie gescharrt.
»Können Sie mir mal sagen, was das hier zu bedeuten hat?«, blaffte der Wirt sie an. »Möchten Sie sich profilieren und demonstrieren, dass Sie die Nachfolgerin vom Dr. Riedel sind? Das wäre nicht nötig gewesen. Wir wissen, wer Sie sind.«
Roberta musste ihren Zorn unterdrücken.
Dieser Mann hatte das Gemüt eines Fleischerhundes. Seine Frau hatte einen Herzinfarkt, Eile war geboten, um deren Leben zu retten, was sie gerade versucht hatte, weil sie für alle Notfälle immer ein Fläschchen Nitro in der Tasche hatte, zum Glück auch jetzt, was ihr ein wenig Erleichterung verschaffte, weil es die Herzfrequenz ein wenig herunterbrachte.
Er redete dummes Zeug daher!
Sie blieb ganz ruhig.
»Ihre Frau hat einen Herzinfarkt«, sagte sie ganz ruhig. »Jetzt zählt jede Minute. Das, was hier geschehen ist, ist erste Hilfeleistung und hat nichts mit Profilierung oder einer Demonstration zu tun.«
Dann wandte sie sich der Frau zu, versuchte, sie zu stabilisieren, dank des Nitros ging der Puls ein wenig herunter.
Der Krankenwagen war erstaunlich rasch da, und sie legte einfach Geld auf den Tisch, von dem sie hoffte, dass es genug war, dann entschloss sie sich, mit dem Krankenwagen mitzufahren und dem Notarzt, der sich voll auf sie verließ und nicht durch weitere Untersuchungen und Befragungen Zeit verlor, zu assistieren.
Er war ein netter junger Mann mit noch wenig Berufserfahrung, der froh war, eine so erfahrene Kollegin an seiner Seite zu haben.
Als sie das Kreiskrankenhaus erreichten, war es ihnen gemeinsam gelungen, die Patientin noch ein wenig zu stabilisieren.
Sie konnten sie jetzt dem bereitstehenden Krankenhaus-Team überlassen.
»Das war knapp«, sagte der junge Kollege und blickte sie bewundernd an, als er hinzufügte: »Ohne Sie und Ihr umsichtiges Handeln hätte die Frau die Attacke nicht überlebt.«
Er stammte aus der Gegend, kannte sich aus, hatte natürlich die Frau des Wirtes erkannt.
Es wunderte Roberta nicht, als er sie angrinste und bemerkte: »Normalerweise müssten Sie ab sofort Ihr Leben lang im ›Seeblick‹ freies Essen haben. Hoffentlich hat Hubert kapiert, was da abgelaufen ist.«
Roberta hörte ihm kaum zu. Sie war mit ihren Gedanken ganz woanders. Sie hatte in ihrer Praxis einen grottenschlechten Tag ohne Patienten gehabt, denn die von Roths waren ja keine gewesen, aber die hatten ihr den Rat gegeben, im Gasthaus zu essen.
Es hatte wohl alles so sollen sein.
Ohne ihr Eingreifen hätte die Frau nicht überlebt, sie hatte versucht, alles herunterzuspielen, und ihm war es überhaupt nicht bewusst gewesen, was da mit seiner Frau passiert war.
Nun ja, sie hatte es bereits gesagt, er hatte halt das Gemüt eines Fleischerhundes.
Trotzdem würde sie wieder hingehen, um dort zu essen, aber erst, wenn seine Frau aus dem Krankenhaus entlassen war und wieder in der Küche stehen konnte.
Jetzt aber wollte sie erst einmal nach Hause. Es war ein ereignisreicher Tag gewesen, zumindest was das Ende betraf.
Sie fragte ihren jungen Kollegen, wo sie ein Taxi finden konnte, und als er ihr anbot, sie mit seinem Auto nach Hause zu bringen, freute sie das, und sie sagte ja. Das Angebot nahm sie gern an.
Sie unterhielten sich angeregt, und als sie ausstieg, verabschiedete Roberta sich mit der Gewissheit, nun schon wieder einen sympathischen Menschen kennengelernt zu haben.
Das war angesichts der vorherigen Frustration ganz wunderbar.
*
Bambi Auerbach kam ins Haus gerannt, stürzte sich in die Arme ihrer Mutter, umarmte und herzte sie stürmisch.
Inge Auerbach wusste überhaupt nicht, wie ihr geschah.
Gut, Bambi war ein sehr liebevolles Mädchen, und mit Umarmungen und Küsschen geizte sie nicht.
Heute allerdings war sie außer Rand und Band.
Nach noch einer Umarmung rief Bambi voller Begeisterung aus: »Mami, du bist die Allergrößte. Alle waren bei der Generalprobe hin und weg von meinem roten Prinzessinenkleid, das du mir genäht hast. Sogar die Lehrer konnten sich nicht einkriegen. Und stell dir mal vor, die Cordelia, diese dumme Pute, die ich überhaupt nicht leiden kann, hätte mir das Samtkleid am liebsten vom Körper gerissen, so toll findet sie es.« Bambi kicherte. »Und, Mami, weißt du, was das Allerschönste ist? Sie will es mir doch tatsächlich abkaufen, wenn die Aufführung vorüber ist. Oder sie will zu uns kommen und dich bitten, ihr auch so ein Kleid zu nähen. Sie sagt, dass das total couturig ist. Ist das nicht toll, Mami?«
Nun kam über die offene Terrassentür Jonny hereingeschossen, um Bambi zu begrüßen. Die Beiden waren halt ein Herz und eine Seele, und obschon Jonny bereits ein betagter Hundeherr war, benahm er sich manchmal noch wie ein Welpe, ganz besonders, wenn er sich freute. Und so kam es, dass er gegen einen Stuhl rannte, der umstürzte.
Das lockte auch Professor Auerbach herbei, der neugierig aus seinem Arbeitszimmer kam und sich erkundigte: »Was ist denn hier los?«
Bambi wiederholte das Begrüßungszeremoniell auch bei ihrem Vater, der sich das lächelnd gefallen ließ.
»Papi, du wirst es nicht glauben. Die Mami wird berühmt, so was wie der Karl Lagerfeld.«
Dann erzählte sie auch ihrem Vater, was sie ihrer Mutter schon berichtet hatte.
Und Jonny stupste sie nacheinander alle drei an, um auf diese Weise zu demonstrieren, dass er auch noch da war.
Als sich die Aufregung um das rote Samtkleid wieder gelegt hatte, rief Bambi ganz enthusiastisch aus: »Ihr glaubt überhaupt nicht, wie glücklich es mich macht, dass Ihr euch entschlossen habt, nach den drei Großen noch ein Kind zu bekommen. Ich liebe meine Geschwister ja über alles, doch ich genieße es, als Nesthäkchen eure ganze Aufmerksamkeit für mich allein zu haben.«
Sie umarmte ihre Eltern abwechselnd noch einmal ganz stürmisch.
»Ich habe die allerbesten Eltern der Welt, und ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Es ist ganz wundervoll, eine Auerbach zu sein.«
Als habe sie bereits zu viel gesagt, rief sie: »Jonny, komm, wir gehen jetzt hinüber zu den Großeltern, die müssen auch erfahren, was für eine tolle Frau die Mama ist.«
Sie lachte, und wenn sie das tat, dann wurde einem ganz warm ums Herz. Da hatte man das Gefühl, die Sonne ginge auf.
Heute war das Lächeln sowohl von Professor Auerbach als auch seiner Frau ein wenig gequält, doch das bekam Bambi schon überhaupt nicht mehr mit, weil sie, gemeinsam mit Jonny, der nicht von ihrer Seite wich, auf dem Weg zu den Großeltern war, die praktischerweise gleich nebenan wohnten.
Als sie sich sicher sein konnten, dass Bambi nichts mehr mitbekommen würde, wandte Inge sich an ihren Mann, der auch ziemlich ratlos und betroffen dreinblickte.
»Werner, ich dachte eben, mein Herz müsse stehen bleiben. Mit welcher Selbstverständlichkeit sie annimmt, unser jüngstes Kind, ein gewollter Nachzügler zu sein.«
Werner Auerbach nahm seine Frau in den Arm.
»Liebes, sie weiß es nicht anders, weil wir ihr die Wahrheit nie gesagt haben und auch Jörg, Ricky und Hannes dicht hielten.«
»Aber wir können sie nicht länger belügen. Je mehr Zeit vergeht, umso schlimmer wird es. Ich habe eine panische Angst davor, sie könnte es von einem Außenstehenden erfahren. Das wäre eine Katastrophe.«
Er versuchte, seine Frau zu beruhigen.
»Dazu wird es nicht kommen. Es weiß doch niemand, nur die vom Amt, und die unterliegen der Schweigepflicht. Also beruhige dich bitte, mein Liebes. Aber das war jetzt wieder mal eine Situation, die auch mir klargemacht hat, dass wir nicht länger schweigen, es nicht länger hinausschieben dürfen. Bei nächster Gelegenheit müssen wir es Bambi sagen, und ich bete schon jetzt zu Gott, dass Er uns dann die richtigen Worte finden lässt.«
»Wir sollten es unter Umständen im großen Familienkreis tun, und Jörg, Ricky und Hannes dabeihaben. Die sind unverkrampfter als wir und können Bambi bei der Gelegenheit auch sagen, wie sehr sie sie lieben, immer geliebt haben, und wie glücklich sie doch waren, auf einmal eine so niedliche kleine Schwester zu haben.«
Ehe der Professor dazu etwas sagen konnte, wurde es laut. Bambi und Jonny kamen zurück.
»Die Großeltern sind nicht daheim«, sagte Bambi ganz enttäuscht. »Dann müssen sie es halt später erfahren. Aber ich habe einen Bärenhunger, Mami. Was gibt es denn heute Schönes zu essen?«
Inge verriet es ihr, und als Werner sich wieder in sein Arbeitszimmer zurückziehen wollte, bat sie ihn, gleich zu bleiben.
Dagegen konnte er nichts machen, um nicht auffällig zu werden. Bambi war eine sehr gute Beobachterin, vor allem war sie ein sehr intuitiver Mensch und bekam die kleinsten Stimmungsschwankungen mit.
Ihm wäre es schon recht gewesen, sich zunächst einmal in seinem Allerheiligsten ein wenig sammeln zu können.
Er war ein Mann, der in der Regel sehr entscheidungsfreudig war, der wusste, wo es längs ging, der international bekannt war und sehr geschätzt wurde.
Das mit Bambi überforderte ihn, zumal sich die Gelegenheiten häuften, in denen er und Inge sich darüber unterhielten. Und auch die Großen erwähnten es immer wieder.
Na klar mussten sie es ihr irgendwann sagen.
Denn eine Geburtsurkunde konnte man nicht ein Leben lang unterschlagen. Das wäre schön, und gäbe es die Möglichkeit, würde er sie auch ergreifen.
Bambi hakte sich bei ihm ein.
»Papi, stimmt etwas nicht? Hast du Probleme? Kann ich dir helfen?«, erkundigte sie sich.
Ihre liebevolle Art, ihre Arglosigkeit, zerrissen ihn fast. »Ach, nichts Wichtiges. Ich habe da in einer Sache ein wissenschaftliches Problem, das ich noch lösen muss.«
Sie lächelte ihn an.
»Dabei kann ich dir leider noch nicht helfen, Papi«, sagte Bambi ganz ernsthaft. »Da musst du noch ein paar Jahre warten, bis ich das Abitur gemacht und studiert habe und in deine Fußstapfen treten werde. Welch ein Glück, dass ich deine Gene geerbt habe, wenigstens eines von deinen Kindern.«
Es stimmte.
Bambi war in den naturwissenschaftlichen Fächern unschlagbar.
Aber das jetzt, das war mehr als er ertragen konnte. Mochte es feige sein, und gemein war es auch, weil er Inge das Heft in die Hand gab.
Er strich Bambi die wilden Locken aus dem Gesicht, dann drückte er ihr einen Kuss auf die Stirn, und seine Stimme klang ganz rau, als er sagte: »Ich hätte keine Ruhe, esst schon mal ohne mich.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte er sich abrupt um und rannte förmlich in sein Arbeitszimmer.
Unglücklich blickte Inge ihrem Mann nach.
Das bekam Bambi natürlich mit, sie schmiegte sich ganz fest in die Arme ihrer Mutter.
»Ach, Mami, so ist er halt, der Papi – seine Arbeit ist ihm halt sehr wichtig. Und das ist ja auch gut so, denn sonst ginge es uns nicht so gut. Wir haben alles und können sehr glücklich sein, dass es so ist. Mami, dann essen wir zwei eben allein. Ich erzähle dir alles von der Probe, da ist nämlich noch eine ganze Menge passiert. Und so was interessiert unseren Papi eh nicht, er ist halt ein zerstreuter Professor, der nur seine Arbeit im Sinn hat … aber ich habe unseren Professor-Papi ganz doll lieb, und dich natürlich auch.«
Wenig später saßen sie am Küchentisch und aßen, und Bambi plauderte ohne Unterlass, sie war so sehr dabei, dass sie überhaupt nicht mitbekam, wie einsilbig ihre Mutter war.
Sie mussten es Bambi endlich sagen!
Das war der Gedanke, der Inge in erster Linie beschäftigte und quälte.
Sie waren gerade mit ihrem Essen fertig, als es draußen an der Tür klingelte.
Es war Manuel Münster, der unbedingt etwas mit Bambi besprechen wollte. Obwohl er ein wenig älter war und noch dazu ein Junge, die in diesem Alter ziemlich schwierig waren, mochten die beiden sich gern und waren sehr gute Freunde.
Inge merkte, dass sie Kopfschmerzen bekam, deswegen bereitete sie sich einen doppelten Espresso zu.
Manuels Leben war anfangs auch nicht leicht gewesen. Mit nur einem Jahr hatte er seine Mutter verloren, und die Tante, die sich danach um seine Erziehung gekümmert hatte, war nicht an ihm interessiert gewesen, sondern an seinem stattlichen, vor allem aber reichen Vater.
Manuels Leben hatte eine Wende zum Guten genommen, als sein Vater, der Fabrikant Felix Münster, den Erlenhof kaufen wollte, den herrschaftlichen Wohnsitz der beiden Damen von Rieding. Der Mutter Marlene und der Tochter Alexandra, die allerdings nur Sandra genannt wurde.
Zu dem Zeitpunkt waren die beiden Damen ziemlich überfordert gewesen, sie hatten den Herrensitz erst nach dem Tod des alten Barons geerbt, der sie zu Lebzeiten nicht anerkannt und auch nicht gesehen hatte.
Es war schon eine Fügung des Schicksals gewesen. Felix Münster hatte zwar nicht das Herrenhaus gekauft, aber für sehr viel Geld die Dependance, die er nach seinen Wünschen hatte umbauen lassen.
Nicht nur er hatte sich sofort in Sandra verliebt, sondern vor allem auch sein kleiner Sohn, der Sandra sofort ans Mutter und Marianne von Rieding als Oma haben wollte.
Das Schicksal hatte es mit allen gut gemeint, an die Vergangenheit erinnerte sich niemand mehr, weil sie eine glückliche Gegenwart hatten.
Obwohl Marianne es ihnen mehrfach angeboten hatte, einen Tausch vorzunehmen, wohnten sie noch in der Dependance. Und sie hatten eine gemeinsame kleine Tochter bekommen, Babette, die alle, ganz besonders ihren großen Bruder, um den Finger wickelte.
Inge Auerbach seufzte.
Für die Herrschaften oben auf dem Erlenhof war alles gut gegangen.
Auch für Marianne, die in dem Architekten Carlo Heimberg einen liebevollen Ehemann gefunden hatte.
Sie seufzte erneut.
Auch da oben hatte es Höhen und Tiefen gegeben, denn Titel, Besitz und Geld schützten vor Schicksalsschlägen nicht.
Aber eines hatten sie getan, immer mit offenen Karten gespielt.
Das taten die Auerbachs normalerweise auch, sie waren grundehrliche Menschen. Und vermutlich belastete es sie deswegen so sehr, dass sie leider eine Leiche im Keller hatten.
*
Roberta Steinfeld dachte nicht länger darüber nach, dass sie nun wirklich, wenn auch zufällig und vorübergehend, eine Patientin gehabt hatte.
Die Wirtin des Seeblicks, der sie das Leben gerettet hatte, das stand nun endgültig fest. Ohne ihr beherztes Eingreifen hätte die Frau nicht überlebt. Das hatte ihr gerade der behandelnde Arzt des Kreiskrankenhauses erzählt, der sie angerufen hatte, um ihr mitzuteilen, dass man Marion Lingen zwei Stents gesetzt hatte und dass es ihr verhältnismäßig gut ging.
Roberta freute sich darüber.
Es war ihr Beruf, Menschenleben zu retten. Monika Lingen hatte wirklich sehr viel Glück gehabt, dass sie zufällig im Lokal gewesen war und die Situation erkannt hatte.
Sie hatte Glück gehabt, war noch nicht an der Reihe gewesen.
Ihre Freundin Nicki nannte es Vorbestimmung und führte dann immer das bekannte Beispiel des Flugzeugs an, das abgestürzt war und dass diesen Absturz nur ein einziger Passagier überlebt hatte.
Das half ihr nicht, das brachte sie nicht weiter.
Auch heute war ein zermürbender Vormittag, das Wartezimmer blieb leer.
Irgendwann kam eine alte Frau in die Praxis, die sich in den Finger geschnitten hatte. Eine Verletzung, die man selbst mit einem Pflaster behandeln konnte.
Man konnte daran fühlen, es war ganz eindeutig, dass diese Frau allein die Neugier hergetrieben hatte. Roberta fragte sich sogar insgeheim, ob die Frau sich nicht absichtlich in den Finger geschnitten hatte, um einen Grund zu haben, herzukommen.
Ursel Hollenbrink hätte die Patientin verarzten können, aber die wollte natürlich von der Frau Doktor höchstpersönlich behandelt werden.
Roberta desinfizierte diese Bagatellwunde, machte ein Pflaster drauf.
»So, das wär’s«, sagte sie.
»Dann komme ich morgen zum Nachsehen?«, erkundigte sich die Patientin und blickte Roberta beinahe herausfordernd an.
Roberta mochte ältere Patienten und Patientinnen, die oftmals Angst vor den Göttern in Weiß hatten und verunsichert waren. Denen nahm sie rasch die Angst, und manchmal zog sie sogar den weißen Kittel aus, um den Leuten zu zeigen, dass darunter auch nur ein ganz normaler Mensch steckte.
Diese Frau hier hatte Haare auf den Zähnen!
»Oh nein«, widersprach Roberta sofort, »morgen wird von dem Schnitt überhaupt nichts mehr zu sehen sein.«
So leicht gab die Frau nicht auf.
»Mir wäre aber lieber, wenn Sie noch mal einen Blick auf die Wunde werfen würden«, beharrte die Frau.
Roberta biss insgeheim die Zähne zusammen, eine solche Dreistigkeit hatte sie in all den Jahren ihrer Berufstätigkeit noch nicht erlebt.
»Nein.«
Sie sagte nur dieses eine Wort, doch wenn sie geglaubt hätte, sich damit klar ausgedrückt zu haben, dann sah sie sich getäuscht. So schnell gab die Frau nicht auf.
»Seien Sie doch froh, dass ich kommen will. Sie haben eh nichts zu tun, keine Patienten. Sie müssen doch vor Langeweile sterben. Außerdem verdienen Sie an mir. Sie bekommen Geld von meiner Krankenkasse.«
Normalerweise ließ Roberta sich auf solche Gespräche nicht ein. Doch ihre Nerven waren eh zum Zerreißen gespannt, das brauchte sie jetzt nicht auch noch. Sie blieb ganz ruhig.
»Frau Schulze, es ist richtig, ich bekomme Geld von der Krankenkasse, doch nicht für jeden Besuch, sondern eine sehr geringe Pauschale für ein ganzes Quartal. Das ist so wenig, dass Sie vermutlich bei einem Einkauf im Supermarkt mehr ausgeben.«
»Wenn das so ist, dann kann ich im Quartal kommen, so oft ich will.«
Roberta blieb ganz ruhig.
»Das stimmt, aber nur, wenn Sie krank sind, nicht, um Zeit totzuschlagen oder um Ihre Neugier zu befriedigen. Ich muss nämlich Ihrer Krankenkasse über jeden Besuch haarklein berichten, auch wenn es nur diese geringe Pauschale gibt. Ich weiß nicht, wie Ihre Kasse dann reagieren wird.«
Frau Schulze erhob sich.
»Na gut, wie Sie meinen … Ich werde Sie ganz bestimmt nicht weiterempfehlen.«
Sie rauschte hinaus, und zum Glück kam sofort die nette Frau Hollenbrink herein.
»Frau Doktor, diese Frau hat Haare auf den Zähnen, sie kann sich selbst nicht leiden und hat schon den Doktor zur Weißglut gebracht. Wir können nur beten, dass sie wegbleibt. Schaden anrichten kann sie nicht, weil sie sich mit jedem anlegt und niemand sie ernst nimmt.«
Roberta bedankte sich, das war wirklich nett, doch sollte das ihr Leben sein, keine Patienten und wenn, dann solche wie diese Frau?
Frau Hollenbrink verließ den Behandlungsraum, und Roberta machte sich wieder über die Medikamentenbestände her, von denen sie das meiste entsorgen konnte.
Eine tolle Beschäftigung.
Sie hätte das natürlich auch ihre Sprechstundenhilfe machen lassen können, die kannte sich aus, und Roberta hatte längst schon erkannt, welches Juwel sie da übernommen hatte. Hoffentlich bekam die Gute keine kalten Füße und schmiss hin, weil sie mit Nichtstun nicht ihre Tage verbringen wollte.
Sie schreckte hoch, als ihr Telefon klingelte.
»Frau Doktor, da ist ein Herr Doktor Steinfeld am Telefon, der Sie unbedingt sprechen möchte. Soll ich durchstellen?«
Sie hatte kurz erwähnt, dass sie geschieden war, und Ursel Hollenbrink war klug genug, bei diesem Anrufer direkt ihre Rückschlüsse zu ziehen und sich vorsichtshalber vorher zu erkundigen.
Sie konnte ihrem Ex nicht ausweichen, fragte sich allerdings, was er von ihr wollte.
Sie bedankte sich und nahm das Gespräch an.
»Schön, dass du dir die Zeit für mich nimmst, Roberta«, sagte er, »bestimmt ist die Praxis hackeknacke voll, und ich weiß, wie ungehalten du werden kannst, wenn man dich bei der Arbeit stört.«
Sie war mittlerweile schon so verunsichert, dass sie sich jetzt fragte, ob er einen Detektiv auf sie angesetzt hatte und wusste, dass bei ihr nichts los war.
Sie entschloss sich, auf nichts einzugehen, sondern erkundigte sich ziemlich unwirsch: »Max, was willst du?«
»Ach so, ja. Nun – es ist mir beinahe ein wenig peinlich, doch es ist wichtig für mich. Ich kann bei einer großartigen Frau Pluspunkte sammeln.«
Hatte er überhaupt kein Hirn mehr? Nun, vermutlich nicht, wenn es um seine Eroberungen ging.
Es tat nicht mehr weh, doch es machte sie noch immer wütend.
Sie war nicht sein Kumpel, dem gegenüber man mit seinen Errungenschaften prahlte. Sie war seine Exfrau, hatte die schönsten Jahre ihres Lebens mit ihm verbracht, hatte sich von ihm demütigen und verletzen lassen und hatte ihm dann noch beinahe alles überlassen.
Sie wiederholte, diesmal noch eine Spur unfreundlicher: »Also, was willst du?«
»Ich hab dir vor Jahren mal einen Elefanten aus Elfenbein geschenkt, den du nicht haben wolltest, wegen Artenschutzes oder so was. Nun, den kann ich nicht finden. Hast du ihn gar mitgenommen? Wenn ja, kann ich ihn wiederhaben, da er dir doch nichts bedeutet?«
Es schlug dem Fass wirklich den Boden aus.
»Wenn ich den Elefanten hätte, dann würde ich ihn dir herzlich gern überlassen, weil ich noch immer etwas dagegen habe, dass diese wunderbaren Tiere wegen ihrer Stoßzähne auf grausame Weise umgebracht werden. Und ich werde niemals verstehen, dass man sich einen Elefanten aus Elfenbein in die Vitrine oder sonst wohin stellt und sich mit Ringen und Ketten schmückt.«
Sie machte eine kurze, bedeutsame Pause, ehe sie sagte: »Erinnere dich bitte, Max. Du hattest mal eine Dolly, Holly oder Molly, die du beeindrucken wolltest. Und der hast du diesen Elefanten geschenkt, ohne mich zu fragen. Es war immerhin ein Geschenk. Erstaunlich, dass du jetzt fragst. Aber, wie gesagt, ich kann dir nicht helfen.«
Damit wollte sie das Gespräch beenden, doch er hatte noch etwas auf dem Herzen.
»Roberta, du hast hier eine große Lücke hinterlassen, du fehlst den Kollegen, den Assistentinnen, Helferinnen, und natürlich ganz besonders den Patienten … also, wir würden uns alle freuen, wenn du dich ….«
Sie ließ ihn den Satz nicht beenden.
»Vergiss es, Max. Wie sagt man doch so schön? Kein Fluss fließt zurück … ich hoffe, du kannst deine neue Flamme auch ohne diesen Elefanten beeindrucken.«
Damit legte sie auf.
Er war wirklich schmerzfrei, ihr Ex. Doch dass man sie vermisste, gefiel ihr. Sie vermisste auch ihr altes Leben, zumal in ihrem neuen so überhaupt nichts los war.
Sie legte das Telefon weg, trat ans Fenster.
Von hier aus hatte man einen Blick in den Garten, doch wie schön der war, nahm sie überhaupt nicht bewusst wahr.
Zwei Erlebnisse der besonderen Art hatte sie heute bereits gehabt.
Zuerst diese schreckliche alte Frau, und dann der Anruf ihres Exmannes, der auch so unnötig war wie ein Kropf.
Sagte man nicht … aller guten Dinge sind drei?
Bloß das nicht!
Noch etwas Negatives, und sie würde schreiend ums Haus rennen.
Roberta hatte es noch nicht einmal zu Ende gedacht, als sich die Tür öffnete und Ursel Hollenbrink hereinkam.
Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit machte sie die Tür sorgsam hinter sich zu.
So kannte Roberta ihre resolute Mitarbeiterin nicht.
Ihr schwante nichts Gutes!
Ein drittes Erlebnis der besonderen Art? Es sah alles ganz danach aus.
»Was gibt es, Frau Hollenbrink?«, erkundigte sie sich. »Hat sich etwa noch ein Patient hierher verirrt? So etwas wie diese schreckliche Frau Schulze?«
Ursel Hollenbrink schüttelte den Köpf.
»Nein, kein Patient … Herr Lingen ist draußen, der Wirt vom Seeblick. Der möchte Sie sprechen. Möchten Sie mit ihm reden, oder soll ich ihn wegschicken?«
Roberta hatte ihrer Mitarbeiterin von dem Zwischenfall erzählt, und sie hatte auch darüber gesprochen, wie unmöglich der Wirt sich verhalten hatte.
Am liebsten würde sie ihn wegschicken, doch was sollte es!
»Lassen Sie ihn rein«, sagte sie, dann setzte sie sich hinter ihren Schreibtisch, als könne sie da Schutz finden.
Weswegen war er hier?
Weil das Geld nicht ausreichte, das sie in aller Eile auf den Tisch gelegt hatte?
Um ihr weitere Vorwürfe zu machen, mit denen er, weiß Gott, nicht gespart hatte?
Das war eigentlich kaum denkbar, denn mittlerweile musste er erfahren und vor allem auch begriffen haben, dass sie sich nicht profilieren wollte, sondern das Leben seiner Frau retten.
Er war das personifizierte schlechte Gewissen, und Roberta entschloss sich, unter das Gewesene einen Schlussstrich zu ziehen.
Hubert Lingen entschuldigte sich in aller Form und bedankte sich bei ihr, dann holte er aus seiner Jackentasche einen zerknitterten Geldschein, legte ihn auf den Schreibtisch.
»Das, was Sie für meine Monika getan haben, ist mit Geld überhaupt nicht aufzuwiegen. Ich möchte Ihnen Ihr Geld wiedergeben und zu dem Essen einladen … es tut mir wirklich alles so leid, manchmal vergesse ich meine guten Manieren …«, er versuchte ein schiefes Grinsen. »Soll nicht wieder vorkommen … Sie werden uns doch hoffentlich wieder besuchen? Zunächst mal bleibt allerdings im Seeblick die Küche kalt, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Meine Monika ist nicht zu ersetzen, und die wird erst mal für eine Weile ausfallen. Sie muss in die Reha, und der Arzt im Krankenhaus hat gesagt, dass wir dann weitersehen werden.«
Er rutschte auf seinem Stuhl hin und her, zerrte am Kragen seines Hemdes.
Er hatte ganz offensichtlich noch etwas auf dem Herzen.
»Frau Doktor, können Sie sich die Akte im Krankenhaus nicht mal ansehen, mal mit dem behandelden Arzt sprechen?«
Sie zögerte.
»Monika möchte sich auch persönlich bei Ihnen bedanken.«.
Sie erklärte ihm, dass sie seine Frau gern im Krankenhaus besuchen wolle, um mit den Ärzten sprechen zu können, müsse Monika ihre Patientin sein.
Das war für ihn überhaupt kein Problem, auf einmal nicht mehr, er erzählte, dass es doch von Dr. Riedel noch die Kartei gebe und dass man selbstverständlich in Zukunft auch zu ihr kommen werde.
Roberta sah in ihrem Computer nach, tatsächlich, es gab die Patientendatei von beiden, doch sie stellte sehr schnell fest, dass sie keine regelmäßigen Arztbesucher waren, ganz besonders er nicht.
Sie wollte ihm keine Angst machen, doch da sie nun offiziell die Ärztin der Lingens war, war es ganz einfach ihre Pflicht, ihn auf das aufmerksam zu machen, was sie vermutete und dass es unumgänglich war, eine große Untersuchung vorzunehmen.
Das mit dem Abnehmen, das dringend notwendig war, konnte sie ihm beim nächsten Besuch sagen.
Bei Patienten wie Hubert Lingen musste man ganz behutsam vorgehen.
»Herr Lingen, darf ich mal Ihren Blutdruck messen?«, erkundigte sie sich.
Er blickte sie verunsichert an.
»Ich glaub, da ist alles in Ordnung, Frau Doktor. Ich bin zwar manchmal ein wenig kurzatmig, doch das liegt an meinem Übergewicht. Die Monika meckert deswegen auch immer. Aber Sie sehen, meine Frau ist dünn, und dennoch hat sie einen Herzinfarkt bekommen. Aber gut, messen Sie.«
Sie tat es, und ihr Verdacht bestätigte sich.
Als sie ihm zeigte, was auf dem Messgerät zu lesen war, erschrak er doch. Und vielleicht hätte er das nicht so ernst genommen, wäre das mit seiner Frau nicht passiert.
»Also gut, verschreiben Sie mir ein paar Pillen, und ich verspreche, sie zu nehmen.«
Da machte sie ihm erst einmal klar, dass das so einfach nicht ging.
»Herr Lingen, Sie müssen gründlich untersucht werden, und dann muss ich etwas über Ihre Lebensgewohnheiten erfahren, wir machen eine Langzeitmessung. Und dann müssen wir überlegen, mit welchem Blutdrucksenker Sie medikamentös am besten eingestellt werden können. Bei hohem Blutdruck schluckt man nicht einfach, so wie bunte Smarties, eine Pille. Erst wenn man sich ein genaues Bild über den Patienten gemacht hat, kann man sich an die Medikation herantasten.«
»Betablocker sollen gut sein«, bemerkte er, weil man in einer Gaststätte natürlich eine ganze Menge mitbekam, besonders von Leuten, die bei einem Bier am Tresen saßen.
Sie nickte.
»Für gewisse Patienten schon, ich würde Ihnen aber keine Betablocker verschreiben, das weiß ich schon jetzt, ohne genaue Untersuchungsergebnisse zu haben.«
Er hatte sein Verhalten wirklich verändert.
Roberta glaubte ihren Ohren kaum zu trauen, als sie ihn sagen hörte: »Sie sind der Boss, Frau Doktor.«
Auch wenn es ein tragischer Fall war, der sie zusammengeführt hatte, Roberta freute sich, dass Hubert Lingen sich von ihr helfen lassen wollte. Das war zumindest schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und wenn seine Frau ihn ebenfalls schon wegen seines Übergewichts angesprochen hatte, würde sie in ihr eine Verbündete haben.
Roberta bat den Wirt, mit Frau Hollenbrink für die Blutabnahme einen Termin zu machen, dann verabschiedete sie sich von ihm und nahm hin, dass er ihr vor lauter Dankbarkeit und Begeisterung beinahe die Hand zerquetschte.
Mit den Lingens hatte sie nun schon drei Patienten.
Sollte der Knoten geplatzt sein, und die Patienten würden sich so nach und nach einfinden?
Hubert Lingen hatte sie jetzt auf ihrer Seite, der würde nur noch positiv über sie sprechen und jedem, der es hören wollte oder nicht, erzählen, dass sie seiner Frau Monika das Leben gerettet hatte.
Gemessen an dem, was sie täglich an Patienten gesehen hatte, war es lächerlich, sich zu freuen.
»Eine Blume macht noch lange keinen Sommer«, würde ihre Freundin Nicki jetzt sagen, die für alle Lebenslagen einen Spruch auf den Lippen hatte.
Roberta entschied sich dafür, den Dingen ihren Lauf zu lassen.
Abwarten …
Ein Bauer konnte auch nicht aufs Feld gehen und an den Halmen ziehen, damit das Getreide schneller wuchs.
Hier gingen die Uhren halt anders, und je eher sie sich daran gewöhnte, umso besser.
Das Gespräch mit dem Wirt war in dieser Hinsicht ganz aufschlussreich gewesen.
Der musste jetzt auch sehen, wie es mit ihm und seinem »Seeblick« weiterging.
Ein jeder hatte sein Päckchen zu tragen, und das Leben konnte sich von jetzt auf gleich verändern.
Sie blickte auf ihre Uhr.
Mittagspause.
Diesmal würde sie sich nicht im Haus verkriechen, sondern einen Spaziergang durch die Siedlung machen, vielleicht sogar bis zum See hinunter.
Morgen, an ihrem freien Nachmittag, wenn die Praxis geschlossen war, würde sie um den Sternsee herumwandern und sich auch einmal im Ruderklub umsehen. Als Studentin hatte sie mit dem Ruderverein der Uni so manchen Pokal gewonnen. Das war zwar schon eine Weile her, doch mit dem Rudern war es wie mit dem Fahrrad fahren. Wenn man es einmal konnte, dann verlernte man es nicht mehr.
Segeln war auch eine Option.
Sie und Max waren begeisterte Segler gewesen, bis seine Interessen sich verlagert hatten und er am schönen Geschlecht mehr Spaß hatte als am Sport.
Wie immer es sich auch entwickeln würde, eines konnte man auf jeden Fall sagen … der Sonnenwinkel besaß einen hohen Freizeitwert …
*
Dr. Roberta Steinfeld würde sich gewiss sehr viel wohler fühlen, wenn sie wüsste, dass Menschen sich ihretwegen sorgten, die sie überhaupt nicht kannten.
Sandra Münster hatte zufällig Inge Auerbach getroffen, und die hatte ihr natürlich von dem Fiasko um die Praxis von Dr. Riedel erzählt, in der Dr. Roberta Steinfeld kein Bein auf die Erde bekam.
Ihr Mann Felix war ein stark beschäftiger Unternehmer, und deswegen vermied Sandra es, ihn anzurufen oder zu besuchen, während er in der Fabrik war.
Das tat sie wirklich nur in Ausnahmefällen, und Felix wusste das zu schätzen. Sie waren ein gutes Team, zogen an einem Strang, und sie waren verliebt wie am ersten Tag, sie hatten noch immer Schmetterlinge im Bauch, wenn sie sich sahen, wenn sie sich berührten, wenn sie aneinander dachten.
Das jetzt war ein Ausnahmefall.
Sandra parkte ihren weißen Sportwagen direkt vor dem Portal des beeindruckenden Verwaltungsgebäudes der Münster-Werke.
Sie wurde voller Hochachtung vom Portier im Eingangsbereich begrüßt.
Die Münsters wurden vom Personal geschätzt, weil Felix Münster ein fantastischer Arbeitgeber war, dem das Wohl seiner Angestellten sehr am Herzen lag. Alle arbeiteten gern hier, und auch die Auszubildende blieben nach bestandener Prüfung im Betrieb.
Sandra fuhr nach oben in die oberste Etage, auf der Felix seine Büro- und auch die Konferenzräume untergebracht hatte.
Neben ihm und seinen Sekretärinnen arbeiteten hier seine engsten Mitarbeiter, die auch allesamt für ihren Chef durchs Feuer gehen würden.
Um in das Büro ihres Mannes zu kommen, konnte Sandra durch das große Sekretariat gehen, es gab jedoch auch einen unauffälligen Seiteneingang, wo man zum Büro seiner langjährigen Sekretärin Frau Brandt kam, und dahinter residierte dann ihr Felix.
Lilo Brandt freute sich, die Frau ihres Chefs zu sehen. Heimlich bewunderte sie Sandra, die nicht nur das Aussehen einer Dame besaß, sondern sich auch entsprechend kleidete. Für Lilo war sie auf jeden Fall, in jeder Hinsicht, ein großes Vorbild, dem sie, so gut es ging, nacheiferte.
Sandra hatte Glück.
Felix hatte keinen Besuch, und für die nächste halbe Stunde waren auch keine Besucher angemeldet.
Mehr als eine halbe Stunde brauchte sie nicht, zumal Frau Brandt ihr versprach, keine Telefongespräche durchzustellen. Als Sandra in das wirklich erlesen, aber doch schlichtelegant eingerichtete Büro ihres Mannes eintrat, blickte er ihr ganz erstaunt entgegen, stand auf, kam um den Schreibtisch gelaufen und nahm sie zärtlich in die Arme.
»Mein Herz, das ist aber eine angenehme Überraschung, dich hier zu sehen … es ist doch nichts passiert?«
Sie konnte ihn beruhigen, und nach einem liebevollen Kuss nahmen sie Platz, und Sandra sagte: »Felix, wir haben im Sonnenwinkel ein Problem. Du weißt doch, dass eine ganz hervorragende Ärztin die Praxis von Dr. Riedel übernommen hat.«
Er nickte.
»Ja, Riedel war des Lobes voll und war sogar der Meinung, dass sie für den Job hier überqualifiziert ist.«
Sandra nickte.
Er konnte seine Frau nicht ganz verstehen.
»Und wo ist das Problem?«
»Sie hat keine Patienten, die Leute hier meiden sie, warum auch immer. Und wenn sich da nicht bald etwas ändert, wird sie wohl schneller wieder verschwunden sein als wir gucken können. Das wäre für uns nicht nur ein herber Verlust, weil sie so gut ist, sondern man kann sich ja wohl ausmalen, dass wir dann so schnell keinen Nachfolger oder eine Nachfolgerin finden werden. Wer will denn schon eine Landarztpraxis übernehmen? Die Verdienstmöglichkeiten in der Großstadt sind sehr viel lukrativer.«
Er schenkte ihr einen liebevollen Blick, und am liebsten wäre er jetzt aufgestanden, um sie erneut in seine Arme zu nehmen.
Wie sehr er sie doch liebte!
Ach, seine Sandra.
Es gab gar nicht genug Worte, um sie zu beschreiben, um ihr gerecht zu werden. Sie war eine Frau mit einem großen Herzen. Sie kümmerte sich um andere, sie half dort, wo Hilfe gebraucht wurde, und das still, ohne viel Aufhebens davon zu machen.
Sie waren reich und er war großzügig, sie hätten ihre Tage damit verbringen können, shoppen zu gehen, sie könnte die Kreditkarten glühen lassen.
Nichts davon wollte sie.
Sein Manuel hatte das sofort erkannt. Kinder besaßen noch ein reines Herz, gingen unvoreingenommen auf Menschen zu.
Sandra und Manuel liebten einander, und sie machte zwischen ihm und Babette keinen Unterschied.
Sandra wollte nie etwas von ihm, und nun trat sie wegen dieser Ärztin an ihn heran.
»Und was soll ich tun?«, erkundigte er sich.
So ganz genau wusste Sandra das auch nicht.
»Ich weiß nicht, Ihr habt zwar einen Werksarzt, aber kann Frau Dr. Steinfeld nicht Patienten von euch übernehmen? Vielleicht die leitenden Angestellten?«
Davon wollte Felix nichts wissen, weil das unter der Belegschaft nur böses Blut schaffen würde.
Felix Münster machte keine Unterschiede, er behandelte alle Leute, die für ihn arbeiteten, gleich, ob es nun der Portier, die Reinemachefrau oder sein Stellvertreter waren. Für ihn zählten keine Positionen, sondern nur die Menschen.
»Wir könnten sie einladen, noch ein paar Leute dazu, so eine Art Willkommensparty veranstalten. Da kann man sich unverbindlich ein wenig beschnuppern, und da ich mal davon ausgehe, dass diese Frau Dr. Steinfeld eine patente Frau ist, wird sie im Nu die Sympathien gewinnen.«
Jetzt sprang Sandra auf, stürzte sich in die Arme ihres Mannes.
»Felix, mein Liebster, dass ich nicht von allein darauf gekommen bin. Natürlich machen wir das. Und ich werde auch sofort alle Vorbereitungen treffen.«
Ehe er seine Frau küsste, bemerkte Felix Münster: »Vorher solltest du aber Frau Dr. Steinfeld fragen, ob ihr das überhaupt recht ist.«
Natürlich würde sie das tun, doch wenn sie nun schon mal hier war, konnte sie das Zusammentreffen mit ihrem Ehemann auch mal ganz eigensüchtig sehen und ihn küssen, ihm sagen, wie lieb sie ihn hatte, und seine Antwort, die kannte sie schon, doch sie würde ihn nicht daran hindern, das alles noch einmal auszusprechen.
Ganz besonders von drei einfachen Worten konnte sie nicht genug bekommen, und die lauteten … ich liebe dich.
*
Am Mittwochmorgen verirrten sich zwei Patienten in die Praxis. Die hatte der Wirt vom Seeblick ihr geschickt. Roberta hatte beinahe das Gefühl, dass er sie gezwungen hatte.
Er selbst war brav zu seinem Termin gekommen, und Ursel Hollenbrink konnte endlich unter Beweis stellen, was sie alles konnte.
Als er mit seinen Untersuchungen fertig war, kam er noch einmal zu Roberta ins Behandlungszimmer, weil er ihr unbedingt etwas sagen wollte.
»Meine Monika hat mir gesagt, dass Sie sie gestern besucht haben. Das hat sie sehr aufgebaut, zumal Sie ihr mit einfachen Worten erklärt haben, was eigentlich mit ihr los ist. Sie ist ganz begeistert von Ihnen, und das bin ich übrigens auch. Wir hier im Sonnenwinkel können uns nur wünschen, dass Sie uns noch lange erhalten bleiben … ehrlich mal, so was wie Sie kriegen wir nie wieder. Aber jetzt muss ich gehen. Die Ursel hat mir schon gesagt, wann ich wiederkommen soll, weil dann die Laborwerte da sind.«
Es war unglaublich, wie sehr dieser Mann sein Verhalten geändert hatte. Er konnte ja so richtig nett sein.
Sandra Münster hatte eigentlich auch in die Praxis kommen wollen, um mit Roberta zu sprechen, doch dann entschied sie sich dafür, einen privaten Besuch zu machen und mit der Ärztin über die Willkommensparty zu sprechen, von der alle Eingeladenen bereits im Vorfeld begeistert waren.
Doch als sie an der Haustür klingelte, öffnete niemand.
Sie hatte dummerweise vergessen, dass Mittwoch war.
Nun, dann musste sie halt noch einmal wiederkommen. Wer es nicht im Kopf hatte, der hatte es in den Beinen.
Sie mussten sich kennenlernen, eine Einladung am Telefon auszusprechen war ein absolutes no go.
Als sie wieder zu ihrem Auto gehen wollte, traf Sandra auf Bambi, die mit ihrem Jonny einen Spaziergang machte.
»Wenn du zu der Frau Doktor willst, Sandra, dann musst du runter zum See gehen, da habe ich sie vorhin getroffen. Ich musste ihr den Weg zum Ruderklub beschreiben. Sie ist sehr freundlich und unheimlich nett. Und obwohl sie doch eine Ärztin für uns Menschen ist, hat sie mir geraten, mit Jonny mal zum Tierarzt zu gehen. Sie meint, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Ich glaub, sie ist so richtig gut. Sie hat auch direkt gesehen, dass er lahmt, dabei konnte sie nur ein paar Schritte von ihm beobachtet haben.«
»Nun, sie wird eine gute Diagnostikerin sein, das ist nicht jeder Arzt, auch so mancher nicht, der ein Prädikatexamen gemacht hat. Es lässt sich halt nicht alles im Pschyrembel nachlesen.«
»Und was ist, bitte schön, das?«, erkundigte Bambi sich.
Sandra lachte.
»Ein klinisches Wörterbuch, praktisch die Bibel für Medizinstudenten. Wo willst du eigentlich hin, Bambi?«
»Nur ein wenig herumlaufen.«
»Das ist nicht viel. Komm doch mit zu uns, Manuel freut sich immer, dich zu sehen, und Babette bewundert dich und möchte auch mal so aussehen wie du. Meine Mama hat übrigens diese Schokoladendonuts gebacken, von denen du nie genug bekommen kannst. Ist das ein Angebot?«
Das war es.
Sandra musste keine weiteren Überredungskünste aufwenden, um Bambi zu überzeugen.
Schokoladendonuts, das war es doch!
Jonny wurde auf den ein wenig engen Rücksitz geschoben, Bambi nahm auf dem Beifahrersitz Platz, und dann fuhr Sandra auch schon los.
Sie war eine ganz schön rasante Fahrerin, und gäbe es im Sonnenwinkel eine Polizeistation, dann hätte Sandra ganz gewiss schon so manches Ticket wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen bekommen.
Sandra war ein warmherziger, liebenswerter Mensch, eher zurückhaltend, was nicht bedeutete, dass sie nicht wusste, wo es längs ging.
Was allerdings das Autofahren betraf …
Da schlug die gute Sandra so manches Mal ganz ordentlich über die Stränge, und man konnte dann den Eindruck bekommen, sie fühle sich als Formel-Eins-Fahrer.
Nun ja, eine Macke hatte jeder. Und bei Sandra Münster war es nur eine ganz kleine Macke, weil ihre guten Eigenschaften einfach überwogen.
In erster Linie war sie wunderbar.
Bambi war hingerissen von ihrer großen Freundin, denn das war Sandra für sie, war es von Anfang an gewesen.
Sandra, damals noch von Rieding, hatte die Auerbachs, als sie in den Sonnenwinkel gezogen waren, herzlich und unvoreingenommen empfangen. Sie hatte sich ganz besonders um sie und ihren Bruder Hannes gekümmert und war mit ihnen hinauf zur Felsenburg gewandert, der geschichtsträchtigen Ruine, die hoch über dem Herrenhaus lag, in das Sandra sie auch direkt mitgenommen hatte. Und Marianne von Rieding, Sandras Mutter, hatte es sich nicht nehmen lassen, sofort Waffeln mit Schokoladensauce für die Kinder zu backen. So etwas vergaß man natürlich nie.
Die von Riedings waren kein bisschen eingebildet, und das waren die Münsters, Sandra war ja jetzt eine von ihnen, auch nicht. Sie waren reich, doch das zeigten sie nicht.
Ja, und dann war da natürlich Manuel Münster, der war ihr Freund, von Anfang an, als er, sehr zurückhaltend und unglaublich schüchtern, mit seinem Vater hierhergezogen war.
Welch ein Glück für ihn, dass nicht nur er sich direkt in Sandra verliebt hatte, sondern sein Vater ebenfalls. Und so hatte sich für die beiden Münsters alles zum Guten gewendet, und für Sandra ebenfalls, denn auch sie war von Amors Pfeil direkt getroffen worden.
Ja, es war eine sehr gute Idee, jetzt mit hinauf zum Erlenhof zu fahren. Da war es immer schön, und sie hatte ja eh nichts zu tun gehabt, sondern wäre mit ihrem Hund nur etwas in der Gegend herumgelaufen.
Bambi lehnte sich zurück, genoss den Fahrtwind und fand wieder einmal, wie froh sie doch sein konnte, dass es ihr so gut ging, sehr gut. Ja, wirklich.
Auch Jonny war ganz still, als Bambi sich jedoch einmal kurz nach ihm umdrehte, war sie nicht so sicher, ob der alte Herr die Autofahrt ebenfalls so genoss. Er hockte ganz still auf der Rückbank.
*
Sie waren gerade aus dem Auto ausgestiegen, als Manuel mit seinem Fahrrad um die Ecke gebogen kam.
»Hey, Bambi, was machst du denn hier?«, erkundigte er sich.
»Wenn du willst, kann ich sofort wieder gehen«, bemerkte sie.
Sandra lachte.
»Bambi, ich denke, das wirst du nicht tun. Aber bitte sehr, tragt es untereinander aus, was ihr wollt oder was ihr nicht wollt.«
Damit winkte sie den beiden zu und verschwand in der Dependance, die nach dem Umbau, der seinerzeit für viel Geld durchgeführt worden war, ein wahres Schmuckstück war.
Bambi und Manuel, wirklich allerbeste Freunde, befanden sich in einem Alter, in dem man das eine oder andere schon mal austesten wollte oder wo man herumzickte.
»Bambi, wie bist du denn drauf?«, erkundigte Manuel sich sofort.
»Wie soll ich denn drauf sein? Ist nicht gerade cool, von dir mit den Worten empfangen zu werden, was ich hier mache, Freude sieht anders aus. So, wie du es gesagt hast, hörte es sich an, dass du genervt davon bist, dass Sandra mich mit nach oben genommen hat.«
Manuel blickte Bambi an, sagte eine Weile nichts, dann grinste er.
»Der Tonfall macht die Musik, liebe Bambi. Wenn du nicht gleich auf Krawall gebürstet gewesen wärst, hättest du bemerkt, dass ich mich freue, dich unerwartet bei uns hier oben zu sehen. Kannst du jetzt wieder normal sein? Ich freue mich nämlich wirklich.«
Das reichte, Bambi war nicht nachtragend, außerdem hatte sie wirklich dämlich reagiert. Manuel freute sich immer, wenn sie sich trafen. Warum also sollte es jetzt anders gewesen sein?
»Tut mir leid, Manuel«, sagte sie.
»Jonny scheint sich allerdings nicht so wohlzufühlen, Bambi!«, sagte Manuel, nachdem er sein Fahrrad abgestellt hatte. »Guck mal, wie er daliegt, beinahe schon so, wie nicht mehr von dieser Welt, und ich …«
Manuel brach seinen Satz ab, blickte ganz schuldbewusst zu ihr.
»Bambi, entschuldige, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, ich weiß doch, wie du an Jonny hängst. Manchmal plappert man einfach etwas daher, ohne darüber nachzudenken.«
Bambi seufzte abgrundtief auf.
»Ach, Manuel, irgendwo hast du ja recht. Es ist ein Wunder, dass Jonny noch immer lebt. Ich weiß, dass er über kurz oder lang gehen muss. Nichts dauert ewig, aber ich mag noch nicht daran denken. Ich verdränge alle Gedanken an seinen Tod, und deswegen wird es mich vermutlich, wenn es so weit sein wird, umhauen. Die Ricky sagt immer, dass man sich jeder Situation stellen und ihr fest ins Auge sehen muss.«
Manuel winkte ab.
»Die Ricky ist ganz anders als du. Aber ich finde es schon cool, dass sie, obwohl sie vier Kinder hat, tatsächlich studieren will. Dazu gehört schon was.«
»Unsere Ricky«, Bambis Stimme klang schwärmerisch, »die ist etwas Besonderes. Die hat immer gewusst, was sie wollte, und das hat sie durchgezogen, ob es nun darum ging, sich Fabian an Land zu ziehen, ihn zu heiraten oder dann die vier Kinder unbedingt haben zu wollen. Ricky schafft alles, sie wird das mit dem Studium ebenfalls durchziehen. Ich könnte das auf keinen Fall.«
»Du bist anders, du hast andere Qualitäten. Du bist etwas, was es kein zweites Mal auf der Welt gibt. Und das, Bambi, das stammt nicht von mir, obwohl ich es auch bestätigen kann, das sagt immer die Oma Marianne.«
Wie auf ein Stichwort öffnete sich ein Fenster, Sandra blickte hinaus und rief: »Geht bitte hinüber zum Herrenhaus, dort wartet eine Überraschung auf euch.«
»Unsere kleine Prinzessin Babette?«
Sandra lachte.
»Die auch, die kann es kaum erwarten, Bambi zu sehen. Es wundert mich ohnehin, dass sie noch nicht bei euch ist.«
»Wahrscheinlich hat Omi sie zurückgehalten«, bemerkte Manuel.
»Kann sein, aber die eigentliche Überraschung ist eine andere, deswegen rate ich euch, schleunigst ins Herrenhaus zu gehen.«
Das ließen Bambi und Manuel sich nicht zweimal sagen, die Überraschungen von der Baronin von Rieding waren nicht zu verachten.
Manuel lief los, Bambi sagte: »Komm, Jonny.«
Der rührte sich nicht. Auch als sie ihn zu locken versuchte mit: »Im Herrenhaus gibt es Leckerli«, hob er nur den Kopf und blieb sitzen.
Sandra hatte es mitbekommen, sie rief: »Geh nur, Bambi, ich kümmere mich um Jonny. Ich werde ihm auf jeden Fall erst mal ein Schälchen Wasser bringen.«
Bambi war noch ein wenig unschlüssig, erst als Manuel sie aufforderte: »Komm, Bambi«, setzte sie sich in Bewegung.
Auf Sandra war Verlass, die würde sich kümmern, und sie selbst sollte wohl den Rat von Frau Dr. Steinfeld befolgen und mit Jonny zum Tierarzt gehen.
Sie hatte die Worte der Ärztin nicht vergessen, sie wäre ja auch längst zum Tierarzt gegangen, wenn sie nicht eine so schreckliche Angst davor hätte, der könnte eine schreckliche Diagnose stellen.
Sie hielt noch mal inne, drehte sich um, lief zu Jonny.
Dann kniete sie sich neben ihn, umarmte und streichelte ihn.
»Ich weiß ja, dass du ein alter Herr bist, mein Jonnylein, aber eine Weile hältst du doch noch durch, nicht wahr? Du und ich, wir gehören zusammen.«
Jonny machte »wuff«, was ganz eindeutig eine Bestätigung war.
Bambi streichelte ihn noch einmal, murmelte: »Bis später«, dann lief sie zu Manuel, der bereits ungeduldig auf sie wartete.
Gemeinsam liefen sie zum Herrenhaus, und da kam auch schon die kleine Babette aus dem Haus gelaufen und stürzte sich in Bambis Arme.
»Bambi, die Omi hat ganz viele leckere Sachen gebacken. Und soll ich dir mal was verraten? Du kriegst auch von allem etwas mit für deine Eltern und deine Großeltern.«
»Babette, kannst du eigentlich überhaupt nichts für dich behalten? Irgendwann schreibe ich mal ein Buch über dich, und den Titel kenne ich bereits – ›Babette, die kleine Plaudertasche‹.«
Babette quitschte vor lauter Freude. »Oh ja, Manu, das ist toll.«
Sie bestand darauf, dass sowohl Bambi als auch ihr Bruder sie bei der Hand nahmen, und gemeinsam gingen sie ins Herrenhaus hinein.
Es duftete verlockend, und dann kam auch schon Marianne von Rieding zu ihnen.
Sie strich Manuel übers Haar, dann sagte sie: »Es ist schön, dass du da bist, Bambi.«
Marianne von Rieding war eben eine herzliche Frau, und sie liebte Kinder, und Bambi hatte sie ganz besonders in ihr Herz geschlossen. Das war vom ersten Augenblick an so gewesen. »So, meine Süßen, setzt euch. Es ist schön, dass Ihr da seid.«
*
Der Gedanke, sich nach dem Bootsverleih zu erkundigen, war Roberta eigentlich erst gekommen, als sie die kleine Auerbach, ein entzückendes Mädchen, mit ihrem Collie Jonny gesehen hatte.
Und danach war alles ganz schnell gegangen, sie war beinahe wie fremdgesteuert zum Bootsverleih gelaufen.
Dort traf sie direkt auf den Besitzer, der dabei war, ein Paddelboot zu reparieren und dabei sehr geschickt agierte.
Er war ein junger, ein wenig verwegen aussehender Mann, der sofort mit seiner Arbeit aufhörte und ihr interessiert entgegenblickte.
»Hi, ich bin Kay … Kay Holl«, sagte er, »und wer bist du?« Er duzte sie wie selbstverständlich, und Roberta widersprach nicht.
»Roberta«, sagte sie, und mehr erwartete er auch nicht. »Ein schöner Name, passt zu dir. Und jetzt willst du ein Ruderboot mieten.«
Er setzte das als so selbstverständlich voraus, dass Roberta ihn nur staunend ansehen konnte.
»Wieso Ruderboot? Es gibt auch Paddelboote, Segelboote«, sagte sie.
Er lachte, zeigte ein so makelloses Gebiss, dass er sehr gut als Model für eine Zahnpastawerbung durchgehen könnte.
Er war überhaupt ein guter Typ, dieser Kay Holl, er sah sehr gut aus, wirkte offen und sehr sympathisch. Wäre sie durch ihre gescheiterte Ehe nicht so vorgeschädigt, und wäre er nicht jünger als sie, wäre er genau der Typ Mann, der ihr gefiel. Ein Mann, der in ihr Beuteschema passte, würde ihre Freundin Nicki jetzt keck behaupten. Gegen solche Bemerkungen wehrte Roberta sich immer, denn das Wort »Beuteschema« bedeutete für sie einen ganz ordentlichen Verschleiß an Männern. Das war bei ihr niemals der Fall gewesen. Aber sie war nicht hier, um eine Eroberung zu machen, sondern sich die Boote anzusehen.
»Paddeln ist auch nichts für dich«, sagte er nach einem weiteren abschätzenden Blick. »Segeln ja, bei entsprechendem Wind, den wir heute nicht haben. Rudern, ja, ich denke, davon verstehst du etwas, und ich glaube auch, dass du dich jetzt mal so richtig auspowern willst. Habe ich recht? Sag einfach ja, und der Einer da drüben ist deiner.«
Es war unglaublich. Sie hatte nicht daran gedacht, schon heute aufs Wasser zu gehen, sondern sie hatte sich eigentlich nur informieren wollen.
Ehe sie ihm eine Antwort geben konnte, ging er zum Boot, blieb davor stehen.
»Komm, überleg nicht lange. Du willst es doch, das sieht man dir an. Spontane Entscheidungen sind immer die besten.« Was sollte es.
Roberta hatte sich für einen Marsch um den See sportlich angezogen. So konnte sie auch auf jeden Fall in ein Ruderboot steigen. Und es war überhaupt keine schlechte Idee, Frust abzubauen, davon hatte sie genug.
»Okay, überredet«, lachte sie.
Er schüttelte den Kopf, grinste.
»Nö, nicht überredet, überzeugt. Viel Spaß, bleib draußen, solange du willst. Ich hab noch zu tun. Und heute herrscht kein großer Andrang bei mir, und auf dem See ist auch nicht viel los. Du kannst dich also so richtig ins Zeug legen. An den Wochenenden ist es ganz anders. Da prügeln sie sich beinahe um die Boote … nun ja, bei entsprechendem Wetter.«
Er zuckte die Achseln.
»Es ist, wie es ist.«
Roberta war ganz schön aufgeregt, als er den Einer ins Wasser gleiten ließ. Doch als sie ein wenig später im Boot saß, war es nach wenigen Ruderschlägen so, als habe sie erst gestern zum letzten Male im Boot gesessen.
Kay Holl winkte ihr zu, sie winkte zurück, dann ruderte sie zügig los.
*
Es war unglaublich.
Roberta fühlte sich plötzlich so frei, so unbeschwert und vor allem so unglaublich jung.
Bilder aus der Vergangenheit tauchten auf.
Es war eine herrliche Zeit gewesen, als sie und ihre Mädels mit ihrer Studentenmannschaft Sieg um Sieg errungen hatten.
Wie stolz waren sie gewesen, vor allem wie glücklich und froh.
In einem Einer war sie nur zum Spaß gerudert, und sie freute sich noch jetzt, dass ihr großartiger Coach sie dazu ermutigt hatte.
Im Einer war man unabhängig, da war man der Chef und konnte alles bestimmen, Ruderschläge, Tempo, einfach alles.
Roberta ruderte zügig zur Mitte des Sees und stellte fest, dass sie völlig aus der Übung war und dass es ganz schön anstrengend war.
Sie ließ es langsamer angehen, dümpelte streckenweise träge vor sich hin, beobachtete Schwäne, die majestätisch über das Wasser glitten, stolz und schön.
Und wenn man sie so sah, war es beinahe unvorstellbar, wie plump sie an Land aussahen.
Enten näherten sich neugierig dem Boot, drehten jedoch sehr rasch wieder ab, als sie merkten, dass bei ihr nichts zu holen war.
Sie waren verwöhnt, die Enten, denn die Wanderer, die Spaziergänger, brachten Brot mit, das sie an die Enten verfütterten, und das führte dazu, dass sie es ganz einfach erwarteten.
Roberta musste lächeln.
Es war schön!
Es war wunderschön!
Und es war friedlich, und das Wasser, das gegen das Boot schlug, hatte eine einschläfernde Wirkung. Nicht nur das, all ihre Probleme, all der Ärger schienen ganz weit weg zu sein.
Roberta ruderte entspannt an der nicht bewohnten Seite des Sees entlang. Eine Spaziergängerin winkte ihr zu, sie winkte fröhlich zurück.
Ja, fröhlich!
Hier und jetzt beschloss Roberta, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern die Herausforderung anzunehmen. Es wäre doch gelacht, sie hatte bislang immer alles geschafft, warum nicht hier?
Schon wollte sie umkehren und das Boot zurückbringen, als sie plötzlich das Gefühl hatte, auch noch am bewohnten Teil des Sees vorbeirudern zu müssen.
Es war an überhaupt nichts festzumachen. Es war einfach nur ein Gefühl, was allerdings verwunderlich war, weil Roberta sich normalerweise nicht von ihren Gefühlen leiten ließ.
Ein bitterer Zug umspielte ihre Lippen.
Das hatte sie einmal gemacht, sich von ihren Gefühlen leiten lassen, obschon ihr Verstand direkt etwas anderes gesagt hatte. Damals bei Max. Das Ergebnis war bekannt.
Es würde wohl noch eine ganze Weile dauern, bis sie das alles hinter sich hatte. Es tat nicht mehr weh, aber die Enttäuschung saß einfach noch zu tief. Es ging nicht nur ihr allein so. Kein Mensch konnte seine Vergangenheit einfach zu den Akten legen oder wegwerfen wie ein altes Kleidungsstück.
Sie konnte es auf jeden Fall nicht, Erinnerungen tauchten immer wieder auf, manche waren schön, manche waren schmerzlich. Es war nicht alles schlecht gewesen, am Anfang war es wundervoll, doch das mochte auch daran gelegen haben, dass sie noch die rosarote Brille aufgesetzt hatte.
Vorbei!
Vorbei für immer, und es machte jetzt auch überhaupt keinen Sinn, sich wegen der vielen, unnütz vertanen Jahre zu grämen.
Die Zeit heilte alle Wunden. Daran wollte sie glauben.
Ein Vierer glitt an ihr vorüber, in dem junge Männer saßen, die ihr ein paar launige Worte zuriefen. Fast war sie geneigt, sich an sie dranzuhängen und ihnen zu zeigen, wie man es richtig machte. Vom Rudern verstanden sie nicht viel, aber sie hatten gute Laune, und das war ja schon mal etwas, und sie war nicht hier, um sich oder anderen Menschen etwas zu beweisen.
Hier und da war doch noch das eine oder andere Boot zu sehen. Ruderboote, Paddelboote. Segelboote waren nicht auf dem See, doch das lag einzig und allein daran, dass es beinahe windstill war.
Roberta konnte die Gefühle, die sie durchfluteten, überhaupt nicht beschreiben. Sie glitt pfeilschnell dahin, dann ließ sie sich wieder treiben. Sie hatte keine Eile.
Sie befand sich bereits in der Nähe des bewohnten Teils des Sees und überlegte gerade, ob sie nicht doch umkehren sollte, weil das andere, das Ursprüngliche, doch viel spannender war.
Sie gehörte weder zu den Menschen, die neugierig waren, noch zu denen, die gern Häuser besichtigten. Außerdem konnte man von denen auch nicht viel sehen, weil die teils hohen Bäume, mit denen der Uferweg bewachsen war, die Sicht auf die Häuser größtenteils versperrte, was für die Hausbesitzer auf jeden Fall von Vorteil war.
Wer ließ sich denn schon gern auf den Kaffeetisch oder ins Schlafzimmer blicken?
Roberta ruderte entspannt Richtung Ortsausgang.
Hier standen keine Häuser mehr, weil der Teil oberhalb des Wanderweges Naturschutzgebiet war, durch das man lediglich auf den freigegebenen Wegen spazieren durfte.
Nun gut, jetzt war sie schon ziemlich auf dem See herumgekreuzt, da musste sie das jetzt auch nicht mehr auslassen.
Aber danach würde sie das Boot zurückbringen. Sie war untrainiert und spürte bereits ihre Arme. Morgen würde sie einen ausgewachsenen Muskelkater haben. Um das zu wissen, musste man kein Prophet sein.
Sie ruderte auf das Ufer zu und entdeckte zwei junge Frauen, die sich angeregt unterhielten.
Die beiden mussten sich ja viel zu erzählen haben.
Vermutlich war das immer so, wenn Frauen aufeinandertrafen.
Wenn sie an sich und Nicki dachte, da gab es auch immer wieder Themen, die so spannend waren, dass sie darüber reden konnten, als gäbe es kein Morgen. Ach, Nicki, die fehlte ihr sehr, und sie würde gleich heute Abend alles dransetzen, sie zu beschwatzen, so schnell wie möglich zu ihr zu kommen.
Aber diese beiden schwatzsüchtigen Frauen waren jetzt nicht das, was sie sich länger ansehen musste. Sie wandte sich ab, blickte, warum auch immer, noch einmal zurück. Und dann glaubte sie, ihr Herz müsse stehen bleiben.
Roberta sah, wie ein kleines Kind unaufhaltsam den Hügel hinunterkletterte, sich gefährlich dem Ufer näherte.
Roberta begann zu rufen, zu winken.
Die Frauen unterhielten sich weiter.
Das Kind kam dem Wasser immer näher.
Roberta stand auf, das Boot schwankte ganz bedenklich. Sie schrie noch lauter, winkte noch heftiger.
Es war nicht zu fassen!
Eine der Frauen winkte doch tatsächlich zurück, ehe sie sich erneut ihrer Gesprächspartnerin zuwandte.
Das konnte wirklich nicht wahr sein!
Roberta setzte sich wieder hin, dann ruderte sie los, als gelte es, olympisches Gold zu gewinnen.
Auf das Ufer zu!
Dabei behielt sie das Kind im Auge, das immer schneller wurde, ganz offensichtlich fasziniert vom Wasser und den darauf schwimmenden Enten.
Und dann …
Roberta schloss für eine Schrecksekunde die Augen, als sie sah, wie das Kind ins Wasser stürzte.
Sie begann zu handeln!
Die beiden jungen Frauen standen noch immer gut gelaunt beieinander und unterhielten sich.
Es war nicht zu fassen.
Roberta sprang, ohne weiter zu überlegen, ins Wasser, schwamm auf das Kind zu und konnte es gerade noch packen, ehe es untertauchte.
Sie zog es nach oben, brachte es ans Ufer, und dort versuchte sie, es aus seiner Schockstarre zu befreien.
Das Kind kam zu sich, sah das fremde Gesicht und begann lautstark zu schreien. Roberta, die gut mit Kindern umgehen konnte, war nicht in der Lage, es zu beruhigen.
Das Geschrei bekamen endlich auch die beiden Frauen mit. Eine von ihnen, ganz eindeutig die Mutter, kam den Hügel hinuntergelaufen.
»Mein Herzblättchen, was machst du denn für Sachen?«, rief die junge Frau. »Du darfst doch nicht so nahe ans Wasser gehen. Du wärst hineingefallen, wenn die nette Dame das nicht verhindert hätte.«
Was war das denn jetzt für ein Film?
Roberta starrte die Frau an. Wie war die denn drauf?
Sah sie nicht, dass ihr Kind klitschnass war?
»Das Herzblättchen war im Wasser«, sagte Roberta, »und wenn ich nicht zufällig hinzugekommen wäre, hätte es böse ausgehen können. Sie sollten in Zukunft besser auf Ihr Kind aufpassen.«
Für sie gab es hier nichts mehr zu tun. Sie hatte ein ganz anderes Problem.
Ihr Boot trieb ab!
Auch das noch. Sie hatte keine andere Wahl, als erneut ins Wasser zu springen und auf das Boot zuzuschwimmen.
Die Kindesmutter rief ihr etwas hinterher, doch das bekam Roberta schon überhaupt nicht mehr mit.
Sie hatte das Boot erreicht, hievte sich hinein. Dort blieb sie erst einmal sitzen, atmete tief durch.
Sie war pitschnass, um sie herum bildeten sich große Wasserlachen. Na klar, sie war schließlich in voller Montur ins Wasser gesprungen. Das war nicht schlimm, eines allerdings war dumm. Sie hatte vergessen, ihr Handy aus der Hosentasche zu nehmen.
Das tat sie jetzt.
Natürlich war es ebenfalls vollkommen nass, und im Inneren des Displays befand sich Wasser.
Ob es noch zu retten war?
Darüber machte Roberta sich jetzt keine Gedanken. Ein Handy war zu ersetzen, ein Menschenleben nicht. Wäre sie nicht zufällig hinzugekommen, dann wäre das Kind vor den Augen seiner Mutter ertrunken, und die hätte es nicht einmal bemerkt.
Es war alles so unheimlich schnell gegangen, dass Roberta nicht einmal wusste, ob sie einem Jungen oder einem Mädchen das Leben gerettet hatte. Sie war einzig und allein auf das fixiert gewesen, was in einem solchen Fall zu tun war.
Es fühlte sich gut an, rechtzeitig vor Ort gewesen zu sein, und es war beinahe so, als sei sie dorthin geführt worden, um das Kind zu retten.
Eigentlich hatte sie nicht in diese Richtung rudern wollen.
Nicki würde jetzt von Vorbestimmung oder so was reden, diesen Zwischenfall würde sie in ihrem nächsten Telefonat ausklammern, weil sie es mit den Fügungen, Führungen und Vorbestimmungen nicht so hatte.
Sie war zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen, zum Glück!
Roberta ruderte in eine Ecke, wo der See einen Knick machte, wo sich eine bewaldete Landzunge in den See schob. Dort ruderte sie dicht an das Ufer heran und begann, sich auszuziehen und ihre nassen Sachen auszuwringen.
Ihre Schuhe waren voller Wasser. Es platschte richtig, als sie das in den See kippte.
Die Schuhe konnte sie vergessen, die waren dahin, und die musste sie jetzt auch nicht mehr anziehen.
Es war sehr unangenehm, wieder die nassen Sachen anziehen zu müssen, aber sie hatte keine Wahl. Sie konnte schlecht nackt das Boot zurückbringen und dann nackt durch den Sonnenwinkel laufen.
Wie auch immer, da musste sie jetzt durch.
Ein bisschen peinlich würde die Begegnung mit dem Bootsverleiher werden. Roberta sah jetzt schon sein breites, spöttisches Grinsen, wenn sie, nass wie ein begossener Pudel, das Boot zurückbrachte.
Was sollte sie dem jungen Mann erzählen?
Dass sie ins Wasser gefallen war?
Dass sie mal kurz ausprobieren wollte, wie es sich anfühlte, voll bekleidet ins Wasser zu springen?
Nichts davon.
Sie würde gar nichts sagen. Mit Schweigen, mit den Mund halten, war sie bislang in ihrem Leben immer am besten gefahren.
Verrückt, dass ihr in diesem Augenblick ihre Freundin Nicki einfiel, die selbstverständlich auch dazu wieder einen Spruch auf Lager hätte zu »Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.«
Sie entschied sich für Gold, und so ruderte sie zum Bootsverleih, stieg aus dem Boot, zog es an Land.
Er sah sie lange an.
Es war ganz erstaunlich, er sagte nichts, fragte nichts, machte keine dumme Bemerkung.
Als er sah, dass sein Boot in Ordnung war, erkundigte er sich nur: »Aber du kommst doch wieder?«
Roberta wäre ihm am liebsten um den Hals gefallen. Mit einem derartigen Verhalten hätte sie nicht gerechnet. Das war ganz großartig und zeugte von Größe.
»Na klar, da kannst du Gift drauf nehmen«, erwiderte sie ganz cool. »Ich bin ja gerade erst wieder auf den Geschmack gekommen.«
Als sie bezahlen wollte, winkte er ab.
»Betrachte es als Probestunde.«
Sie bedankte sich, dann hatte sie es eilig. Nachdem sie sich verabschiedet hatte, versuchte sie schnell und möglichst unauffällig zu ihrem Haus zu kommen.
Das Glück war auf ihrer Seite.
Nur ein kleiner weißer Hund kam ihr kläffend entgegengerannt, wollte zur Begrüßung an ihr hochspringen, merkte, dass sie nass war. Er machte eine Kehrtwendung und lief wieder davon.
Roberta atmete erleichtert auf, als sie das Gartentor erreichte und ungesehen ins Haus laufen konnte.
Wenn sie jemand gesehen hätte, dann hätte es sehr schnell die Runde gemacht, dass die Frau Doktor ins Wasser gefallen sei.
Und, was Gerüchte so an sich hatten, jeder, der es weiter verbreitete, schmückte es aus.
Und es hätte Roberta überhaupt nicht gewundert, wenn ihr schließlich zu Ohren gekommen wäre, sie sei betrunken gewesen und in den See gefallen.
Gerüchte konnten ganz übel sein.
Es war alles gut gegangen, in jeder Hinsicht. Das Kind war viel zu kurz im Wasser gewesen, um dauerhaft einen Schaden davonzutragen, die Mutter würde künftig ganz gewiss besser auf ihr Kind aufpassen, und natürlich würde sie sich wieder ein Ruderboot ausleihen. Bis auf diesen Zwischenfall war es herrlich gewesen …
*
Damit der Zeitungsbote und der Briefträger nicht den langen Weg bis zum Haus machen mussten, hatten die Auerbachs ihren Briefkasten vorn am Gartentor anbringen lassen. Und Bambi hatte es übernommen, morgens die Zeitung aus dem Briefkasten zu holen.
Professor Auerbach war ganz heiß darauf, morgens seine Zeitung zu bekommen, das war ein lieb gewordenes Ritual. Doch ehe ihr Vater die Zeitung bekam, warf Bambi schon mal einen ersten Blick darauf, zumindest auf die erste Seite.
Spannendes war meistens nicht zu lesen, weil im Sonnenwinkel nicht viel geschah. Das konnte man so oder so sehen.
Eher aus Gewohnheit als mit einer Erwartungshaltung faltete Bambi die Zeitung auseinander, und dann blieb sie vor lauter Überraschung mit geöffnetem Mund stehen.
Das glaubte sie jetzt nicht.
Das konnte nicht wahr sein.
Sie sah ein Foto von Frau Doktor Steinfeld, wie die gerade ein Kind aus dem Wasser zog.
Und darüber stand die reißerisch aufgemachte Überschrift: Wer ist die unbekannte Frau, die diesem Kind das Leben gerettet hat, es vor dem sicheren Ertrinkenstod bewahrte?
Bambi kam aus dem Staunen nicht heraus. Also, das musste sie jetzt noch einmal lesen. Das alles konnte ja nun überhaupt nicht wahr sein. Doch wieso unbekannte Frau – wusste derjenige, der das Foto gemacht hatte, nicht, dass es sich dabei um die neue Ärztin des Sonnenwinkels handelte? Das wusste mittlerweile ja wohl jeder.
Als Bambi den Artikel mehr als nur einmal gelesen hatte, rannte sie ins Haus, zu ihren Eltern, die längst am Frühstückstisch saßen.
Ihrem Vater war anzusehen, dass er ungeduldig auf die Zeitung wartete.
»Wo warst du, mein Kind? Musste die Zeitung erst noch gedruckt werden?«, neckte er sie.
Bambi hing an ihrem Vater, sie und er waren ein Herz und eine Seele. Sie umarmte ihn, drückte ihm ein kleines Küsschen auf die Wange.
»Nein, Papi. Ich musste erst einmal einen Blick in die Zeitung werfen, und dann war ich fix und fertig und musste es ein zweites und ein drittes Mal lesen. Es ist nicht zu glauben, es zieht einem die Schuhe aus.«
Bambi war jetzt in einem Alter, in dem es einem gefiel, »cool« zu sagen oder eben »es zieht einem die Schuhe aus«, aus Erfahrung wussten die Auerbachs, dass sich das schnell änderte. Wenn sie hier und da glaubten, ihrer Tochter mit einem solchen Ausspruch einen Gefallen zu tun, verdrehte Bambi nur die Augen, weil das alles längst Schnee von gestern war.
Inge Auerbach lachte.
»Was ist los, Bambi? Du bist ja reinweg aus dem Häuschen.«
»Die Frau Doktor hat ein Kind vor dem Ertrinken gerettet, und das hat zufällig ein Landschaftsfotograf mitbekommen und es im Bild festgehalten. Die Frau Doktor ist jetzt berühmt.«
»Gib her«, rief der Professor und riss seiner Jüngsten die Zeitung förmlich aus der Hand.
Und auch Inge platzte vor lauter Neugier, was sonst nicht ihre Art war. Sie stand auf, ging um den Tisch herum, dann zog sie sich einen Stuhl heran, setzte sich neben ihren Mann und rief: »Werner, leg die Zeitung bitte so auf den Tisch, dass ich gleich mitlesen kann.«
Werner Auerbach tat seiner Frau den Gefallen, und gemeinsam lasen sie, was Bambi ihnen vorab erzählt hatte.
Bambi trank derweil ganz genüsslich ihren Kakao, den sie noch immer über alles liebte, wo sie doch eigentlich schon beinahe erwachsen sein wollte. Und sie tauchte ihr Croissant mitten hinein, um es sich dann voller Hingabe in den Mund zu schieben. Dass die aufgeweichte Masse teilweise zurück in den Kakaobecher plumpste, bekam ihre Mutter zum Glück nicht mit.
Inge ließ ihrer Tochter so manches durchgehen. Was die Tischmanieren anging, da war sie streng. Und das war auch so bei ihren großen Kindern gewesen.
Der Landschaftsfotograf war wegen einer Auftragsarbeit in den Sonnenwinkel gekommen, und als Profi hatte er sich diese Chance, auf die erste Seite zu kommen, natürlich nicht entgehen lassen. Er hatte auch Fotos von exzellenter Qualität gemacht.
Die Rettung des Kindes sah richtig dramatisch aus, selbst ein Blinder konnte erkennen, dass es in höchster Lebensgefahr schwebte.
Inge erhob sich.
So spannend der Artikel auch war. Sie war informiert, wusste worum es ging.
Jetzt hatte sie erst einmal wieder Lust auf eine Tasse Kaffee. Den Kaffee brauchte sie morgens einfach, um in die Spur zu kommen. Und sie genoss ihn, ihren ersten Morgenkaffee. Wobei gesagt werden musste, dass es bereits ihr zweiter war.
»Also, wenn die Menschen im Sonnenwinkel jetzt noch immer nicht begreifen, welches Juwel der Doktor Riedel uns da besorgt hat, dann weiß ich nicht«, sagte sie. »Wie selbstlos unsere Frau Doktor ist, wie besonnen und tatkräftig. Stellt euch mal vor, hätte dieser Fotograf nicht auf den Auslöser gedrückt, dann hätten wir nichts von dieser Heldentat erfahren.«
Professor Auerbach warf seiner Frau einen liebevollen Blick zu, was Bambi wohlgefällig registrierte. Es machte sie sehr glücklich, dass ihre Eltern sich so gut verstanden, dass ihre Familie überhaupt intakt war.
Von Schulkameradinnen und Schulkameraden wusste sie anderes. Ihre Banknachbarin, mit der sie sich sehr gut verstand, musste gerade eine schreckliche Scheidung ihrer Eltern erleben, in der nicht nur um Hab und Gut gestritten wurde, sondern auch um das einzige Kind.
So etwas würde bei ihnen niemals eintreten, und das machte sie sehr froh.
Professor Auerbach sagte: »Es ist wirklich großartig, was unsere Frau Doktor da gemacht hat. Aber die Sonnenwinkler wären auch irgendwann so dahinter gekommen, was für eine großartige Frau sich hier bei uns als Ärztin niedergelassen hat. Ich könnte darauf wetten, dass sie jetzt natürlich alle in die Praxis strömen werden, was mich für Frau Dr. Steinfeld auch sehr freut. Sie hat es verdient. Doch sag mal, mein Schatz, dann ist doch nun die Begrüßungsparty bei den Münsters überflüssig geworden, oder?«
Der Professor, als Wissenschaftler weltweit noch immer sehr gefragt, war froh, wenn er es sich daheim gemütlich machen konnte. Er vermied, wenn es ging, gesellschaftliche Zusammenkünfte, weil er davon mehr hatte als ihm lieb war.
Natürlich wusste seine Frau das. Wenn man so lange zusammen war wie die beiden, dann kannte man sich, wusste um jede Marotte, um die Vorlieben und das, was man nicht so schätzte.
Sie lachte.
»Oh nein, mein Lieber. Ich finde, jetzt gibt es erst recht einen Anlass für dieses Fest. Das muss gebührend gefeiert werden.«
Jonny machte sich bellend bemerkbar. Er war schließlich auch noch hier und wollte seine Streicheleinheiten haben, die er natürlich postwendend bekam.
*
Der Professor und seine Frau diskutierten noch immer über den Zwischenfall am See, Bambi hockte neben ihrem geliebten Jonny und kraulte ihn hingebungsvoll, als über die geöffnete Terrassentür Manuel Münster ins Haus gestürmt kam.
Nachdem er allen einen guten Morgen gewünscht hatte, rief er: »Bambi, Oma Marianne fährt in die Stadt und will uns bis zur Schule mitnehmen, also, schnapp dir deine Tasche und komm.«
Das ließ Bambi sich nicht zweimal sagen.
Ehe sie mit Manuel auf diesem Weg, den er gekommen war, hinauslief, erkundigte der sich: »Ist eigentlich eure Klingel kaputt? Der Jörg steht draußen vor der Haustür und klingelt sich die Finger wund.«
Inge sprang auf. Von ihrem Mann war das nicht zu erwarten, und das lag nicht etwa daran, dass er faul oder bequem war, sondern dass er mit seinen Gedanken meistens anderswo war.
Er konnte vor anerkannten Wissenschaftlern brillante Vorträge halten, für die er standing ovations bekam. Für den normalen Alltag war er nicht zu gebrauchen, der Herr Professor, doch deswegen liebte sie ihren Werner, und das von Jahr zu Jahr mehr.
Sie lief zur Haustür, riss sie auf.
»Ich wollte gerade wieder gehen, guten Morgen, Mama«, rief ihr Ältester ihr entgegen, umarmte sie. Herzlichkeit wurde bei den Auerbachs groß geschrieben.
»Das ist aber mal eine nette Überraschung, mein Junge«, sagte Inge. »Warum hast du nicht einfach deinen Schlüssel benutzt oder bist hintenrum gekommen?«
»Der Schlüssel ist nur für Notfälle, oder wenn Ihr verreist seid und einer von uns hier nach dem Rechten sehen muss. Ihn einfach so zu benutzen gehört sich nicht. Und hinten herum, Mama, aus dem Alter bin ich raus. Das kann Bambi machen, die ist gerade bei mir vorbeigestürmt, sie wird immer hübscher, unsere Kleine. Ich glaube, wir müssen sie bald an die Leine legen, damit sie uns nicht abhanden kommt.«
Sie hatten die Küche erreicht, auch Werner Auerbach freute sich, seinen Sohn zu sehen, und auch er war freudig überrascht.
Jörg ließ sich auf einen Stuhl fallen.
»Ich hab gleich noch einen Termin bei meinem Schwiegervater, und da dachte ich, dass ich die paar Kilometer zu euch noch fahren kann, um hallo zu sagen. Der Hauptgrund ist allerdings, dass ich unserer Omi ihre uralte Kaffemühle bringen möchte. Es ist mir tatsächlich gelungen, sie noch einmal zu reparieren, wenngleich ich nicht verstehen kann, warum sie an dem alten Ding so hängt. Es gibt moderne Kaffeemühlen, die viel leichter zu handhaben sind.«
»Es gibt eben Dinge, an denen man hängt, weil zum Teil an sie auch so viele Erinnerungen verknüpft sind. Werd selbst mal älter, dann wirst du begreifen, was ich meine. Mama wird überglücklich sein. Hast du gut gemacht, mein Junge. Möchtest du einen Kaffee?«
»Oh ja, gern, Mama, der von dir gekochte ist immer noch der beste. Aber sagt mal, warum habt ihr das Klingeln nicht gehört?«
Sie erzählten es ihm, auch Jörg war beeindruckt, doch als das Thema durch war, wurde Inge resolut.
»So, und nun möchte ich wissen, wie es meinen beiden kleinen Zuckerbeinchen Nele und Carolin geht.«
Jörg war ein stolzer Vater, der seine beiden Mädchen über alles liebte, und deswegen ließ er sich nicht zweimal bitten.
Werner und Inge Auerbach, seine Eltern, lauschten hingerissen. Sie waren nicht nur liebevolle Eltern, sondern hingebungsvolle Großeltern. Das betraf die beiden Töchter ihres Sohnes und die vier Rangen von Ricky. Sie liebten ihre Enkel gleichermaßen und machten keine Unterschiede.
»Und wie geht es Stella?«
Sie mochten auch ihre Schwiegertochter sehr und waren sehr glücklich gewesen, nach ein paar nicht so nach ihrem Geschmack gewesenen jungen Frauen, Stella präsentiert bekommen zu haben, die schon ihre Wahl gewesen war, ehe Jörg sich für die Schwester seines Schwagers Fabian zu interessieren begann.
»Stella geht es gut. Sie ist nur ein wenig verunsichert, weil Ricky jetzt in die Vollen geht mit dem Studium.«
»Will sie jetzt auch studieren?«, wollte Inge wissen.
Jörg wehrte lachend ab.
»Nein, Mama, das ist nicht ihr Ding. Sie freut sich für Ricky, will sie ja auch unterstützen. Nein, es macht ihr zu schaffen, dass ihre Eltern sich ihr gegenüber so unmöglich verhalten. Sie haben sie bereits als Schulkind niedergemacht, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Rückerts haben auch ihre guten Seiten, und niemand kann aus seiner Haut heraus. Aber manchmal haben sie wirklich das Gemüt eines Fleischerhundes. Ihnen mangelt es an Sensibilität, leider auch an Elternliebe. Stella weiß das, und dennoch tappt sie immer wieder in die Falle hinein.«
Weder der Professor noch seine Frau äußerten sich dazu, sie waren klug genug, sich da herauszuhalten. Und sie bezogen Stellung zu etwas nur, wenn sie gefragt wurden.
Jörg trank etwas von seinem Kaffee, dann sagte er: »Ich habe ein Attentat auf euch vor. Um Nele ein wenig abzulenken, möchte ich sie mit einer Wochenendreise nach Paris überraschen. Kann ich Nele und Caro bei euch parken?«
Inge bekam vor lauter Freude ein hochrotes Gesicht. »Nichts lieber als das«, rief sie begeistert aus, um danach leise zu fragen: »Und die Rückerts?«
Die Auerbachs und die Rückerts mochten einander, dennoch bestand in gewissen Dingen eine Rivalität, ganz besonders, was die Enkel betraf.
Jörg sah das locker.
»Ich will Stella mit der Reise überraschen, es geht von mir aus, ist es dann nicht zwangsläufig so, dass ich zuerst meine Eltern und nicht meine Schwiegereltern frage?«
Inge freute sich viel zu sehr, um sich jetzt weitere Gedanken zu machen. Und auch Werner war begeistert. Er war nicht leicht aus seinem Arbeitszimmer zu locken, seine Enkelkinder schafften das, was seine Kinder leider nicht immer erreicht hatten.
Jörg bedankte sich, und gerade als er gehen wollte, kam seine Oma herein, die nahm, wie Bambi und Manuel es gemacht hatten, den Terrasseneingang, was eigentlich auch naheliegend war. Haus lag an Haus und durch den Garten war es eindeutig der kürzere und bequemere Weg, zumindest bei schönem Wetter.
Jörg sprang auf, lief auf seine Großmutter zu, nahm sie in den Arm.
»Omi, zu dir wäre ich auch gleich noch gekommen, du wirst es nicht glauben, ich habe das mit deiner Kaffeemühle hingekriegt.«
Teresa von Roth begann zu strahlen, als habe man ihr soeben ein Königreich versprochen. Sie bedankte sich, dann sagte sie voller Stolz: »Ich wusste es, dass du es schaffen wirst, mein Bub.«
Inge bot ihrer Mutter einen Platz an, doch die lehnte ab, sie brannte darauf, ihre reparierte Kaffeemühle auszuprobieren, und so verließ Jörg gemeinsam mit seiner Oma das Haus, diesmal durch die Vordertür, weil er aus seinem Auto das heißbegehrte Teil noch holen musste.
Er verabschiedete sich von seinen Eltern, umfasste liebevoll seine Omi. Werner und Inge sahen ihnen nach, Inge mit Tränen in den Augen. Es war schön zu sehen, wie sehr Jörg an seiner Großmutter hing.
Würde es mit ihr und ihren Enkeln irgendwann auch einmal so sein?
Sie wusste es nicht. Selbst ein Zukunftsforscher konnte derzeitige Prognosen zu keinem so frühen Zeitpunkt stellen.
Sie liebten ihre Enkel, ihr Werner und sie, und das war schon mal ein gutes Zeichen.
Nele und Carolin würden zu ihnen kommen, und das für ein ganzes Wochenende.
»Werner, wir müssen uns unbedingt Gedanken darüber machen, was wir mit unseren Süßen unternehmen werden.«
Werner Auerbach stand auf, er hatte viel Zeit vertrödelt, auf ihn wartete Arbeit.
Er nahm seine Frau in den Arm, küsste sie, und das war schön.
Als er sie losließ, meinte er: »Ich denke, wir sollten es auf uns zukommen lassen. Es kommt immer anders als man denkt, oder um es noch mal auf andere Weise zu sagen: »Du machst Pläne, und der liebe Gott lacht sich kaputt.«
Dem war nichts hinzuzufügen. Werner wandte sich ab und ging in sein Arbeitszimmer, und Inge genehmigte sich noch einen Kaffee, den brauchte sie nämlich nicht nur um wach zu werden, sondern auch beim Nachdenken.
Sie freute sich auf das Wochenende, und was Bambi wohl sagen würde?
Die war in ihre Nichten und Neffen vernarrt und hatte einen unbändigen Spaß daran, eine so junge Tante zu sein.
Jörg hatte mit gemischten Gefühlen die alte Kaffeemühle seiner Großmutter entgegengenommen und sie auch nur recht halbherzig repariert.
Doch als er jetzt sah, wie glücklich seine Omi war, wie sie dieses olle Ding an sich presste, bekam er ein schlechtes Gewissen.
»Jörg, wir müssen sie jetzt sofort ausprobieren«, rief Teresa von Roth, »nicht, dass ich dir misstraue. Ich bin nur so aufgeregt, du glaubst überhaupt nicht, wie sehr ich mein Maschinchen vermisst habe, und ich wäre untröstlich gewesen, wenn es mit der Reparatur nicht geklappt hätte. So etwas kann man nicht mehr kaufen, und eine solche Qualität gibt es heutzutage in unserer Wegwerfgesellschaft nicht mehr.«
Jörg folgte seiner Großmutter ins Haus, zu dem er keinen so rechten Bezug hatte, wie zum Sonnenwinkel überhaupt. Er war bereits Student gewesen, als seine Eltern zuerst, später dann auch seine Großeltern hergezogen waren. Am meisten hatten Hannes und Bambi davon profitiert und oftmals mehr Zeit bei den Großeltern als bei den Eltern verbracht.
Das bedeutete jedoch nicht, dass er sie weniger liebte als Ricky, Hannes und Bambi.
Magnus von Roth gesellte sich zu ihnen, begrüßte seinen Enkel, dann sagte er, als er die Kaffeemühle bemerkte: »Jörg, deine Großmutter liebt dich über alles, doch jetzt wird ihre Liebe für dich ins Unermessliche steigen. Komm, lass uns direkt in die Küche gehen, denn ich weiß, was jetzt gleich passieren wird.«
»Aber den Kaffee, den ich koche, den genießt du schon. Und ich kann mich noch sehr gut an deine Worte erinnern, als du mir sagtest, dass der selbstgemahlene Kaffee sehr viel besser schmeckt.«
Magnus von Roth lachte, gab es zu.
Er und seine Teresa waren ein eingeschworenes Team. Es konnte sie nichts mehr erschüttern. Sie waren durch Höhen und Tiefen gegangen, viele Tiefen. So etwas schweißte zusammen.
Teresa strich glücklich über ihre alte Kaffeemühle, der anzusehen war, dass sie die besten Zeiten hinter sich hatte und die auf junge Menschen wie ein Museumsstück wirkte. Sie holte Kaffee aus dem Schrank, füllte ihn in die Mühle, und dann schloss sie beglückt die Augen, als das wohlvertraute Geräusch ertönte und es sehr bald ganz herrlich nach frisch gemahlenem Kaffee duftete.
Davon bekamen die beiden Männer nichts mit, denn es gab andere Themen. Vor allem interessierte Magnus von Roth sich für die berufliche Karriere seines Enkels.
»Und, wirst du bei den Münster-Werken bleiben? Ich habe gehört, dass ein großer Betrieb in den neuen Bundesländern gebaut werden soll.«
Das bestätigte Jörg.
»Und wäre es eine Herausforderung für dich, dort einen leitenden Posten zu übernehmen?«, erkundigte Magnus von Roth sich.
Jörg schüttelte entschieden den Kopf.
»Nein, auf keinen Fall, und das weiß Felix Münster auch. Einen Wechsel innerhalb der Firma möchte ich nicht vornehmen.« Interessiert blickte Magnus seinen Enkel an.
»Denkst du überhaupt an einen Wechsel? Besser als in den Münster-Werken kannst du es nicht antreffen, da bist du doch schon ganz oben auf der Karriereleiter.«
»Das stimmt, Opi, besser kann ich es nirgendwo antreffen, aber doch anders. Stella und ich haben hier und da schon mal das eine oder andere durchgesponnen. Das muss auch so sein, denn schließlich sind sie und die Kinder bei jeder Veränderung involviert. Also, denkbar für uns wäre, eine Zeit im Ausland zu verbringen, oder verlockend wäre auch, mich selbstständig zu machen.«
Magnus von Roth blickte seinen Enkel, von dem er sehr viel hielt, nachdenklich an.
»Das hört sich alles gut an, mein Junge. Nur weißt du, ob Stella das mit dem Ausland wirklich will, oder ob sie nicht nur so weit wie möglich von ihren Eltern entfernt sein möchte? Und die Selbstständigkeit. Das klingt wirklich gut, du bist frei, dein eigener Herr, kannst deine Entscheidungen treffen, ohne dass dir da jemand hineinredet. Aber … du trägst auch allein die Verantwortung. Was ist, wenn du krank wirst, nicht arbeiten kannst und demzufolge kein Geld reinkommt? Du hast eine Familie, für die du verantwortlich bist. Da ist jedes Für und Wider genauestens abzuwägen.«
Jörg konnte so gut verstehen, dass sein Opa so dachte. Er und die Oma hatten alles verloren, standen vor dem Nichts, und es hatte viel Fleiß und Arbeit gebraucht, um dorthin zu kommen, wo sie jetzt waren. Sein Sicherheitsdenken war zu verstehen.
»Opa, es steht derzeit überhaupt keine Entscheidung an. Ich denke, dass sich manches von selbst ergibt, wenn es an der Zeit ist. Ich war auch schon während meines Studiums sehr flexibel, und ich habe auch lange genug im Ausland gelebt um zu wissen, dass, wohin man auch geht, nicht alles Sonnenschein ist. Aber ich bin noch jung, noch kann ich alles wagen. Ich möchte irgendwann nicht einmal den verpassten Möglichkeiten nachweinen. Auf ewig werde ich auf keinen Fall bei Felix arbeiten. Da hätte ich auch gleich Beamter werden können. Ich gehöre einfach nicht zu den Menschen, die mit ihrer beruflichen Laufbahn irgendwo starten und dort auch aufhören.«
Magnus musste lachen, weil ihm ein derartiger Gedanke bei Jörg in der Tat unvorstellbar war, Sicherheitsdenken hin oder her.
»Was sagen denn deine Eltern zu solchen Überlegungen?«, wollte er wissen.
»Opi, darüber habe ich mit ihnen nicht gesprochen, und das werde ich auch erst tun, wenn die Zeit reif dafür ist, wenn Stella und ich eine Entscheidung getroffen haben. Mal ganz ehrlich, ich liebe meine Eltern über alles, sie sind weltoffen, verständnisvoll … Nur manches Mal habe ich den Eindruck, dass es eigentlich umgekehrt sein müsste, die Omi und du müsstet unsere Eltern sein, und die beiden unsere Großeltern. Ihr seid, wie man so schön sagt, in eurem Kopf viel jünger. Das ist übrigens auch Rickys Meinung.«
Magnus von Roth war höchst erfreut über dieses Kompliment, doch ehe er etwas sagen konnte, kam seine Teresa zu ihnen an den Tisch.
»Jetzt wird erst einmal Kaffee getrunken, meine Herren, frisch gemahlen und frisch aufgebrüht, und dann möchte ich denjenigen hören, der mir sagt, dass alte Kaffeemühlen entsorgt werden müssen, weil die modernen besser sind.«
Jörg strahlte seine Omi an.
»So etwas zu sagen, würde ich niemals wagen.«
Er fühlte sich wohl, er hatte tolle Eltern, aber seine Großeltern, die waren einmalig, »der Knaller«, würde Bambi in der Sprache der Jugend sagen.