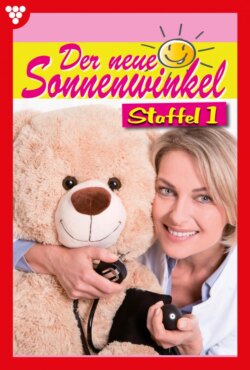Читать книгу Der neue Sonnenwinkel Staffel 1 – Familienroman - Michaela Dornberg - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie junge Ärztin Dr. Roberta Steinfeld war an diesem Morgen so richtig entspannt. Zum ersten Mal, seit sie in den Sonnenwinkel gezogen war und die Praxis ihres alten Freundes Dr. Enno Riedel übernommen hatte.
Das sie so entspannt war, lag ganz gewiss nicht daran, dass sie mittlerweile doch tatsächlich schon fünf Patienten hatte.
Das war lächerlich und kein Grund zum freuen. Sie durfte überhaupt nicht daran denken, was früher in ihrer alten Praxis abgegangen war, die sie ihrem Exmann überlassen hatte. Da hatten sie Patienten abweisen müssen, weil die Kapazität erschöpft gewesen war.
Das war vorbei!
Roberta war fest entschlossen, ihre Vergangenheit endgültig loszulassen und nicht mehr daran zu denken, was sie verloren hatte, was gewesen war. Nichts ließ sich zurückholen, nichts ließ sich festhalten, und es brachte auch nichts, in der Vergangenheit zu leben.
Entscheidend war das Hier und Jetzt, und wenn man das gut bewältigte, dann brauchte man sich auch um seine Zukunft keine Sorgen zu machen, die sich immer aus der Gegenwart ergab.
Roberta würde ab jetzt alles auf sich zukommen lassen, es hinnehmen ohne zu jammern. Irgendeinen Sinn musste es doch haben, dass sie ausgerechnet im Sonnenwinkel gelandet war.
Ja, so und nicht anders durfte sie es sehen, und sie durfte nicht zweifeln und hadern, weil sie sich zu schnell und zu unüberlegt auf das Abenteuer Sonnenwinkel eingelassen hatte.
Niemand hatte sie gezwungen, die Praxis zu übernehmen. Sie hatte sich freiwillig dazu entschlossen. Und eine große Praxis in der Großstadt war nicht vergleichbar mit der eines Landarztes. Und das war sie jetzt, eine Landärztin. Und das hatte sie vorher gewusst und sich sogar auf dieses Abenteuer gefreut!
Vermutlich war ihre Erwartungshaltung einfach nur zu groß gewesen und demzufolge natürlich jetzt auch ihre Enttäuschung, dass man sich nicht die Türklinke in die Hand gab, um sich von ihr behandeln zu lassen.
Hier gingen die Uhren eben anders.
Es war ja auch nicht alles enttäuschend. Sie hatte wundervolle Menschen kennengelernt, den Professor Auerbach und seine sympathische Ehefrau, und nicht zu vergessen, deren reizende Tochter Bambi. Und dann Inges Eltern, Magnus und Teres von Roth, das waren zwei ganz besondere Menschen.
Wenn Roberta an die beiden dachte, dann wurde ihr ganz warm ums Herz. Die von Roths hatten so getan, als seien sie als Patienten zu ihr gekommen, damit sie den Tag nicht ohne einen einzigen Patienten hatte beenden müssen. Und ihre Tochter Inge hatte sie geschickt.
Alles wirklich ganz warmherzige Menschen, die sich um andere Gedanken machten und helfen wollten.
Es war diese Geste der Menschlichkeit, die Roberta zutiefst berührt hatte, und so etwas erlebte man an Orten, die überschaubar waren, wo jeder jeden kannte und jeder erfuhr, wenn jemand neu hinzukam.
In der Großstadt war das anders. Da kannte man häufig noch nicht einmal seinen nächsten Nachbarn, und es hatte schon viele Fälle gegeben und gab sie immer wieder, dass Menschen wochenlang tot in ihrer Wohnung lagen, ohne dass es jemandem aufgefallen war.
Außerdem hatte sie hier ja wirklich als Ärztin tätig werden können, auch wenn das außerhalb der Praxisräume geschehen war.
Sie hatte so ganz nebenbei während eines Abendessens im Gasthof »Seeblick« einen Herzinfarkt erkannt und der Wirtin durch ihr beherztes, kompetentes Eingreifen das Leben gerettet.
Und ohne sie wäre das kleine Kind im Sternsee ertrunken, weil die Mutter so sehr in ein Gespräch vertieft gewesen war, dass sie nicht mitbekommen hatte, dass das Kind immer weiter zum Wasser gelaufen und schließlich hineingefallen war.
Welch ein Glück, dass sie das mitbekommen hatte und eingreifen konnte. Sie hatte dem Kind das Leben gerettet.
Und auf noch etwas konnte sie stolz sein. Sie hatte den mürrischen Wirt des Seeblicks als Patienten gewonnen. Er ließ sich jetzt wegen seines extrem hohen Blutdrucks von ihr behandeln, und er hatte ihr sogar versprochen, seine Lebensgewohnheiten zu verändern, sich vor allem mehr zu bewegen und sein Übergewicht abzubauen.
Im Grunde genommen war das alles nichts im Vergleich zu dem, was sie vorher in ihrer alten Praxis alles bewegt hatte.
Stopp! Sie wollte nicht mehr an die Vergangenheit denken. Ihr Leben spielte sich hier ab, und für das Leben hier war es bereits etwas. Es war auf jeden Fall besser, als überhaupt nichts vorweisen zu können.
Und auf die Schulter klopfen musste sie sich jetzt nicht vor lauter Begeisterung. Was sie getan hatte, waren Selbstverständlichkeiten. Schließlich war sie Ärztin, hatte den hippokratischen Eid abgelegt. Menschen zu helfen, sie zu retten, das war ihr Beruf, den sie über alles liebte.
Ihre gute Laune hatte nichts mit alldem zu tun. Sie war gut drauf, weil sich bei ihr als Person, nicht als Ärztin, etwas verändert hatte, weil sie dabei war, sich zu verändern.
Sie musste nicht funktionieren wie eine gut geölte Maschine, sondern sie hatte ein Recht darauf, ihr Leben entschleunigt anzugehen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Das war Roberta bewusst geworden, als sie an ihrem freien Nachmittag stundenlang im Ruderboot auf dem Sternsee unterwegs gewesen war, inmitten von einer Stille, die man fühlen konnte, inmitten einer unglaublichen Natur, die einen einhüllte wie ein weiches, warmes Tuch.
Hätte es diesen Zwischenfall mit dem Kind nicht gegeben, das sie gerettet hatte, dann wäre es für Roberta das ultimative Erlebnis gewesen. Etwas, was sie vor unendlich langer Zeit zum letzten Mal erlebt hatte, als unbeschwerte, junge Studentin, der die Welt offen stand und die die Welt vor lauter Glück ständig umarmt hatte.
Sie hatte nicht geglaubt, zu solchen Empfindungen überhaupt noch fähig zu sein.
Vermutlich lag das auch ein wenig an dem jungen Bootsverleiher Kay Holl, der so unglaublich entspannt, so richtig gut drauf war.
Das war ihr aufgefallen, als sie ihn kennengelernt hatte, und mehr noch nach ihrer etwas anders verlaufenen Bootstour.
Er hatte keine dumme Bemerkung gemacht, als sie pitschnass aus dem Boot geklettert war.
Er hatte das Boot in Augenschein genommen, festgestellt, dass nichts beschädigt war, sondern nur nass.
Er war großzügig gewesen, hatte ihr nicht einmal Geld abgenommen, sondern sie gebeten, doch wiederzukommen.
Ein anderer hätte ihr das Geld abgenommen, vielleicht sogar noch mehr, weil das Boot ja aufgedockt und getrocknet werden musste.
Und ein anderer hätte sie mit Fragen bestürmt oder gar ein paar hämische Bemerkungen gemacht …, ein nasses Boot, eine nasse Insassin. Daraus ließen sich Rückschlüsse ziehen.
Er hatte nichts gesagt, war freundlich und nett gewesen.
Dieser Mann betrieb den Bootsverleih nur in den Sommermonaten, war während dieser Zeit dringend auf schönes Wetter angewiesen, weil sonst niemand ein Boot ausleihen wollte.
Wovon lebte er eigentlich in den übrigen Monaten?
Roberta hatte keine Ahnung, und er schien sich darum keine Gedanken zu machen, sonst wäre er nicht so tiefenentspannt. Und sonst hätte er sich vermutlich auch auf eine so unsichere Geschichte wie diesen Bootsverleih nicht eingelassen.
Roberta war ein wenig irritiert, weil sie sich so sehr für ihn interessierte, an ihn dachte. Keine Frage, er gefiel ihr, weil er so anders war, so beruhigend anders.
Als Mann interessierte er sie nicht, dafür war er zu jung. Und außerdem war eine neue Beziehung das Letzte, woran sie dachte. Nein, von ihm konnte man sich etwas abgucken, was das Leben, ein entspanntes Leben, betraf.
Am Wochenende würde sie sich wieder ein Boot leihen. Sie hatte den Sternsee in seiner ganzen Pracht längst noch nicht ganz erkundet, und es war auch nicht davon auszugehen, dass wieder ein Kind ins Wasser fallen würde, das sie retten musste.
Tja, und ansonsten …
Ansonsten hatte Dr. Roberta Steinfeld sich entschieden, sich ohne wenn und aber auf den Sonnenwinkel einzulassen, ganz ohne wenn und aber.
Es war noch früh, viel zu früh, um hinüber in die Praxis zu gehen, dennoch stellte Roberta ihre Kaffeetasse weg und erhob sich.
Sie wollte ab sofort auch die Praxis mit anderen Augen sehen, frei von Ehrgeiz, frei von Erwartungshaltungen. Sie wollte sich freuen, da arbeiten zu können wo andere Leute ihren Urlaub verbrachten.
Und Patienten?
Die würden kommen, ganz gewiss. Sie wusste, was sie konnte und das würde sich irgendwann herumsprechen.
Sorgen machen musste Roberta sich nicht, sie würde derweil nicht am Hungertuch nagen müssen, weil sie finanziell ganz gut abgesichert war.
Sie musste nur darauf achten, dass ihre Mitarbeiterin ihr nicht abhanden kam, weil das Nichtstun sie nervte.
Ursel Hellenbrink war ein Juwel. Das hatte Roberta längst erkannt, und sie war glücklich, dass sie diese Frau hatte übernehmen dürfen, dass Ursel Hellenbrink sich hatte übernehmen lassen.
Ursel war nicht nur kompetent. Sie war auch ein ganz wunderbarer Mensch, immer freundlich, hilfsbereit. Und es war ganz rührend, wie sie versuchte sie zu trösten, weil keine Patienten in die Praxis kamen, die bei Enno immer rappelvoll gewesen war.
Das war vorbei.
Sie würde nicht mehr jammern, nicht mehr griesgrämig herumlaufen.
Sie würde Ursel sagen, wie sehr sie sie schätzte und dass sie das gemeinsam durchstehen würden. Einmal musste die Durststrecke vorüber sein, und einmal mussten die Sonnenwinkler sich daran gewöhnen, dass jetzt statt eines Mannes eine Frau da war, um sich ihrer Probleme oder auch nur Problemchen anzunehmen.
Roberta zog ihren blütenweißen Kittel an.
In ihrer früheren Praxis war sie in Zivil herumgelaufen. Doch von Enno wusste sie, dass die Leute hier ihren Doktor in Weiß sehen wollten. Wenn sie das brauchten, sie hatte überhaupt kein Problem damit. Früher wäre es ja auch undenkbar gewesen, einen Arzt als Autoritätsperson ohne weißen Kittel zu sehen, das hatte sich geändert, weil man mittlerweile dahinter gekommen war, dass dieser weiße Kittel zwischen Arzt und Patient hinderlich sein konnte, weil er eine Barriere aufbaute.
Ihr Ex lief nur in Weiß herum, weil es ihm stand und er sich in dem weißen Kittel unwiderstehlich fand.
Ach Gott, das alles schien in einem anderen Leben gewesen zu sein. Roberta warf einen letzten Blick in den Garten und entdeckte zu ihrer Freude, dass der Gärtner, den Ursel Hellenbrink ihr besorgt hatte, da bereits eifrig werkelte.
Ach ja, Ursel war wirklich ein Schatz, ein Goldschatz!
Mit einem Lächeln wandte Roberta sich ab, um in die Praxis zu gehen. Sie genoss das Privileg immer mehr, ihren Arbeitsplatz im Haus zu haben.
*
Zu ihrer Verwunderung stellte Roberta fest, dass Ursel Hellenbrink auch schon an ihrem Arbeitsplatz war, in eine Zeitung vertieft, die sie allerdings, als sie ihre Chefin bemerkte, rasch zur Seite legte.
»Entschuldigung, Frau Doktor.«
Roberta begrüßte ihre Mitarbeiterin freundlich, dann sagte sie: »Frau Hellenbrink, wofür entschuldigen Sie sich? Sie sind viel zu früh, und selbst wenn es nicht so wäre, hätte ich überhaupt nichts dagegen, dass Sie einen Blick in die Zeitung werfen, wenn keine Patienten da sind und wenn sonst nichts zu tun ist.« Roberta lächelte. »Über einen Patientenansturm können wir uns derzeit ja leider noch nicht beklagen, und wir können derzeit beide sogar Romane lesen, ohne dass uns jemand zu nahe tritt.«
Roberta dachte an ihre guten Vorsätze. Noch fiel es ihr ein wenig schwer, sich daran zu halten, noch wurde sie immer wieder rückfällig.
»Aber es wird schon, Frau Hellenbrink, davon bin ich überzeugt. Sie müssen nur bei der Stange bleiben. Ohne Sie wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Und, auch wenn keine Patienten kommen, um Ihr Gehalt müssen Sie sich keine Sorgen machen. Das ist Ihnen sicher. Das kann ich auf jeden Fall zahlen, ohne dabei selbst am Hungertuch nagen zu müssen.«
Ursel Hellenbrink schaute ihre Chefin ganz entsetzt an.
»Aber Frau Doktor, um Himmels willen, an so etwas würde ich niemals denken. Und ich mache mir keine Sorgen, überhaupt nicht. Ich bin glücklich, bei Ihnen hier in der Praxis arbeiten zu dürfen. Freiwillig würde ich niemals gehen. Und ich finden übrigens, dass der Herr Dr. Riedel maßlos untertrieben hat, als er Sie beschrieb. In Wirklichkeit sind Sie noch viel, viel netter und vor allem noch viel, viel klüger.«
Dieses spontane Lob ließ Roberta erröten, doch vor allem fiel ihr ein riesengroßer Stein vom Herzen, dass sie auf jeden Fall auf Ursel Hellenbrink zählen konnte.
»Danke, Frau Hellenbrink. Ich bin sehr froh darum, dass wir zwei so gut miteinander auskommen, dass die Chemie zwischen uns stimmt. Und, wie gesagt, irgendwann werden auch die Patienten den Weg zu uns finden.«
»Das haben Sie schon. Es ist bereits eingetreten, Frau Doktor. Das Wartezimmer ist hackeknackevoll, wie in alten Zeiten. Bestimmt hängt das mit dem zusammen, was über Sie in der Zeitung stand. War ja auch großartig, das Kind zu retten.«
Roberta, im Allgemeinen wirklich nicht auf den Kopf gefallen, wusste im ersten Augenblick nicht, was ihre Mitarbeiterin da sagte.
Wartezimmer voll?
Wieso stand etwas über sie in der Zeitung?
Und wer hatte das mit der Kindesrettung mitbekommen? So richtig doch nicht einmal die Mutter.
Ein Interview hatte sie auch niemandem gegeben.
Alles höchst merkwürdig!
Ursel Hellenbrink bemerkte die Verwirrung ihrer Chefin, deswegen schob sie ihr kommentarlos die Zeitung zu. Und Roberta glaubte, ihren Augen nicht zu trauen.
Sie ganz groß auf der ersten Seite!
Die ganze Rettungsaktion des Kindes war im Bild festgehalten worden, wie zu lesen war vom einem Landschaftsfotografen, der zufällig in der Nähe gewesen war und natürlich fleißig auf den Auslöser gedrückt hatte.
Das war eine Aufmerksamkeit, die sie nicht wollte, die so überhaupt nicht in ihrem Sinne war.
»Auf jeden Fall hat es die Sonnenwinkler in Bewegung gesetzt«, freute Ursel Hellenbrink sich. »Sie sind nicht nur eine Ärztin, sondern eine Heldin. Das wollen die Leute sich aus der Nähe ansehen.«
Man konnte vom Vorzimmer ins Wartezimmer blicken, ohne gesehen zu werden. Und das tat Roberta jetzt. Sie musste sich selbst überzeugen.
Es stimmte. Das Wartezimmer war gefüllt, dabei begann die Sprechstunde erst eine ganze Weile später.
Ursel stellte sich neben sie.
»Alles Patienten, die immer kommen. Manche, weil ihnen wirklich etwas fehlt, andere, weil die Neugier sie hertrieb. Das war schon zu Dr. Riedels Zeiten so. Das Wartezimmer eines Arztes ist beinahe vergleichbar mit dem Friseur. Man findet die neuesten Zeitschriften, um sich die Zeit totschlagen zu können, bis man dran ist. Oder aber man redet, zuerst über die Krankheit, dann kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen.«
Roberta musste sich erst einmal davon erholen. Noch war sie vor Kurzem jammervoll gewesen, und nun das jetzt.
»Und was tun wir jetzt? Die Sprechstunde vorzeitig beginnen?«, erkundigte sie sich ein wenig ratlos.
Davon wollte Ursel Hellenbrink allerdings nichts wissen.
»Oh nein, Frau Doktor. Das fangen wir erst gar nicht an. Dr. Riedel hat auf die Minute genau pünktlich begonnen, keine Sekunde früher. Und ich denke, dabei sollten wir es belassen.«
Roberta war damit einverstanden. Sie setzte sich auf einen Stuhl, der eigentlich für die Patienten bestimmt war, dann nahm sie sich die Zeitung noch einmal vor, um die Geschichte erneut zu lesen …
Sandra Münster hatte es gut gemeint, als sie, mit der vollen Unterstützung ihres Mannes Felix, eine Empfangsparty für die neue Ärztin geplant hatte, um ihr auf diese Weise zu Patienten zu verhelfen.
Sie war entsetzt gewesen, als Inge Auerbach ihr erzählt hatte, dass niemand in die Praxis ging, dass man die Frau Doktor boykottierte. Nicht nur das, ihre Besorgnis war noch größer gewesen, weil eigentlich allen hätte klar sein müssen, dass man, sollte die Ärztin gehen, so schnell keinen Ersatz finden würde. Wer wollte schon auf dem Land arbeiten, mit mehr Einsatz und weniger Verdienst.
Sie hatte Roberta bereits zweimal verfehlt, und auch heute, als sie sich auf den Weg gemacht hatte, um die Einladung persönlich zu überbringen, hatte sie kein Glück.
Das Wartezimmer war überfüllt, also kehrte sie um.
Sie wollte gerade zu ihrem Auto gehen, als sie Inge Auerbach entdeckte, die mit Jonny, dem betagten Collie ihrer Tochter Bambi einen Spaziergang gemacht hatte.
Die beiden Frauen mochten sich sehr, und das war von Anfang an so gewesen. Zwischen ihnen hatte sich eine herzliche Freundschaft entwickelt, obwohl es einen ziemlichen Altersunterschied gab.
Sandra, eigentlich Alexandra, und damals noch eine von Rieding, war unvoreingenommen und herzlich auf die Fremden zugegangen.
Und das war der Anfang dieser wunderbaren Freundschaft gewesen.
»Fehlt dir was, Sandra?«, wollte Inge Auerbach besorgt wissen, weil sie gesehen hatte, wie Sandra aus dem Haus der Ärztin gekommen war.
»Nein, ich bin fit, ich wollte Frau Dr. Steinfeld die Einladung überbringen. Aber keine Chance. Du kannst die Patienten beinahe übereinander stapeln, so voll ist es dort.«
»Patienten?«, wiederholte Inge Auerbach. »Du meinst wohl eher die Neugierigen. Aber was soll es, wenn das denn Bann gebrochen hat und sie die Ärztin nicht mehr meiden, dann soll es mir nur recht sein. Sie ist eine so patente Frau, und wie sie das mit der Rettung des Kindes gemacht hat. Wäre nicht zufällig ein Fotograf da gewesen, hätten wir nichts davon erfahren. Sie ist ein Juwel und so was von sympathisch. Nun, du wirst sie kennenlernen.«
»Meinst du, ich soll die Party dennoch geben?«, zweifelte Sandra. »Im Grunde ist sie hinfällig geworden.«
Inge lächelte ihre junge Freundin an.
»Sandra, die Feste bei euch sind immer ein Highlight, und alle freuen sich schon, die ihr eingeladen habt. Ich denke, es wird sich die Gelegenheit bieten, Frau Dr. Steinfeld einzuladen, wenn der erste Ansturm vorbei ist. Ruf sie einfach an, sag, dass du sie privat sprechen möchtest, und dann kann sie mit dir einen Termin ausmachen, oder mach das mit der Ursel Hellenbrink. Die hat alle Termine im Kopf.«
Das wollte Sandra tun.
Dann wechselten sie das Thema, sprachen über Bambi, Manuel und die kleine Babette.
Manuel war nicht Sandras leiblicher Sohn, Felix hatte ihn mit in die Ehe gebracht. Doch bei ihr und Manuel war es Liebe auf den ersten Blick gewesen, und daran hatte sich nichts geändert. Auch nicht als Babette auf die Welt gekommen war.
Manuel vergötterte seine kleine Schwester, und er war nicht die Spur eifersüchtig.
Da oben im Herrenhaus, in dem Marianne von Rieding, Sandras Mutter, zusammen mit ihrem Ehemann, dem Architekten Carlo Heimberg lebte, und in der traumhaft schön ausgebauten Dependance, die die Münsters bewohnten, war die Welt in Ordnung, wieder, nach vielen Wirrungen.
Und jeder freute sich, dorthin eingeladen zu werden, in die herrliche Residenz unterhalb der verfallenen, mystischen Felsenburg.
Wer das geschafft hatte, gehörte dazu. Glaubte, dazu zu gehören, denn die Herrschaften waren in keiner Weise von sich überzeugt, sondern offen und herzlich, trotz des vielen Geldes, das Felix mit seiner Fabrik verdiente. Und sie kamen alle mit jedem zurecht.
Den Nimbus, der sie umgab, hatten die Bewohner von Erlenried und Hohenborn geschaffen, die den Sonnenwinkel ausmachten.
»Ich weiß nicht, ob du es bereits weißt, Inge. Doch eure Bambi wird heute nicht mit dem Bus kommen. Felix kommt heute ausnahmsweise mittags mal nach Hause, und er wird sie und Manuel mit dem Auto mitnehmen. Und die Wartezeit auf ihn können sie sich in der Eisdiele bei Palatini vertreiben, auf seine Kosten natürlich.«
Inge lachte.
»Oh, das wird Bambi sehr freuen. Sie ist die reinste Naschkatze. Wenn sie nicht ein so liebreizendes Mädchen wäre, würde ich ihr den Süßkram ja manchmal verbieten. Doch das bringe ich einfach nicht übers Herz.«
Sandra fiel in das Lachen mit ein.
»Das schaffe ich auch nicht, und bei dir ist es schlimmer. Sie ist euer Nesthäkchen, die Großen sind aus dem Haus, zu denen man vermutlich viel strenger war. Ich hab schon zu Felix gesagt, dass wir es auch so machen sollten wir ihr. Irgendwann einen kleinen Nachzügler zu bekommen.«
Inge war bei diesen Worten zusammengezuckt, was Sandra zum Glück nicht mitbekommen hatte.
Es waren so viele Jahre vergangen, ohne dass daran gerührt worden war, ohne dass sie daran gedacht hatten, dass Bambi, eigentlich Pamela, nicht ihr leibliches Kind war, sondern dass ein tragisches Ereignis sie auf ihren Weg gebracht hatte. Der schreckliche Autounfall, bei dem, in einer Massenkarambolage, ihre Eltern ums Leben gekommen waren, war deren Tragik, aber ihr Glück gewesen, denn sie hatten, ohne zu zögern, das einjährige Kind sofort bei sich aufgenommen und es adoptiert.
Sie hätten es Bambi längst sagen sollen.
Zuerst waren sie der Meinung gewesen, dass sie älter werden müsse, um es zu verstehen, dann hatten sie es verdrängt. Wozu daran rühren?
Bambi war ihr geliebtes Mädchen, sie wurde von ihren älteren Geschwistern Ricky, Jörg und Hannes vergöttert.
Sie hatten nicht mehr daran gedacht, zumal Bambi sich als echte Auerbach-Tochter fühlte.
Erst in der letzten Zeit war durch verschiedene Ereignisse daran erinnert worden, und Inge fühlte sich schlecht, dass sie Sandra etwas verschweigen musste, was längst ans Tageslicht gemusst hätte.
Ihre Großen hatten nicht nur einmal gesagt, dass es ihnen irgendwann um die Ohren fliegen würde. Die drei hatten niemals verstanden, dass es ihren Eltern so schwerfiel, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Sie hatten Bambi schließlich nicht jemandem weggenommen, sondern es war für alle Beteiligten ein Glücksfall gewesen, dass es so gekommen war und nicht anders.
Zum Glück musste Inge auf diese Bemerkung nicht eingehen, weil Jonny wie ein Verrückter an seiner Leine zu zerren begann.
Das nahm Inge zum Anlass zu sagen: »Du, ich muss weiter. Unser alter Herr will vermutlich nach Hause auf sein Kissen.«
Sandra konnte ja nicht ahnen, dass das vorgeschoben war. Sie bemerkte lachend: »Für sein Alter ist er noch ganz schön fit. Und er sieht wunderschön aus. Aber Bambi wird sich daran gewöhnen müssen, dass es über kurz oder lang zu Ende sein wird. Jonny hat nicht das ewige Leben, er lebt schon länger, als Tiere seiner Rasse es normalerweise tun.«
Inge seufzte.
»Vor diesem Tag graut es mir schon jetzt, und am liebsten wäre ich dann nicht daheim, wenn dieser Tag kommt. Werner versucht bereits sehr liebevoll, sie darauf vorzubereiten. Und so sehr sie sonst auch auf ihn hört, da stellt sie ihre Ohren auf Durchzug.«
Sandra lachte.
»Das kann unsere Babette ohne einen Anlass dafür zu haben. Es ist ein großes Glück, dass Manuel ein so gutmütiger Junge ist und ihr nachsichtig alles durchgehen lässt. Wäre es nicht so, da hätten wir ständig Radau im Haus.«
Inge stimmte in das Lachen mit ein.
»Ja, sie weiß, was sie will, eure kleine Prinzessin, aber sie sieht auch allerliebst aus, und das weiß sie auch.«
Die beiden Freundinnen verabschiedeten sich voneinander, Sandra stieg in ihr Auto, hupte, winkte, dann brauste sie davon.
Inge sah ihr erst nach, dann ging sie nach Hause.
Noch mal gut gegangen!
Aber es war ein Zeichen gewesen, ein Zeichen dafür, dass sie Bambi endlich die Wahrheit sagen mussten.
Ach, wenn es doch bloß nicht so schwer wäre. Und sie hatte das Gefühl, dass es von Tag zu Tag schwerer wurde, die Last immer größer.
Inge Auerbach war ein gläubiger Mensch, aber auf ein Wunder konnte sie in diesem Fall nicht hoffen.
*
Wie sehr ihre Mutter sich mit einem schlechten Gewissen quälte, davon hatte Bambi Auerbach nicht die geringste Ahnung.
Sie genoss das Beisammensein, und sie genoss den riesigen Eisbecher »Tutti-Frutti«, den sie bewusst gewählt hatte, um sich vor ihrer Mutter rechtfertigen zu können, indem sie ihr sagen würde, dass der größte Teil aus verschiedenen Obstsorten bestand.
Manuel hatte sich lieber für einen Nuss-Karamell-Becher entschieden, mit so ganz ordentlich viel Sahne.
Nachdem Manuel den verlangenden Blick Bambis bemerkt hatte, sagte er: »Du kannst probieren, und wenn du willst, dann können wir auch tauschen.«
Bambi bekam glänzende Augen. »Manuel, das würdest du wirklich tun?«, erkundigte sie sich, nachdem sie mehr als nur einmal probiert hatte.
Manuel war liebenswert, gutmütig, hilfsbereit, und er und Bambi waren seit ihrer frühesten Kindheit, seit er mit seinem Vater in die Dependance gezogen war, allerbeste Freunde.
Er war damals ein durch seine schreckliche Tante eingeschüchterter Junge gewesen, und Bambi hatte sich, obwohl sehr viel jünger, seiner liebevoll angenommen.
Das war der Grundstein für ihre Freundschaft gewesen, die mittlerweile schon so manchen Sturm überdauert hatte.
Als Bambi wieder in seinen Becher langen wollte, tauschte er die Eisbecher einfach um.
Er hätte sich niemals für diesen Obstbecher entschieden, doch was tat man nicht aus lauter Freundschaft.
Bambi war ein sehr spontanes Mädchen, sie quietschte nicht nur vor lauter Begeisterung, sondern umarmte Manuel auch ganz stürmisch, was zur Folge hatte, dass er anlief wie eine überreife Tomate.
Er hatte nichts gegen die Umarmungen seiner Freundin, aber doch nicht hier, ausgerechnet im Palatini, wo sich die Schüler trafen, in den Freistunden oder vor oder nach der Schule.
»Du bist der Beste, Manuel«, sagte sie, »und wenn ich noch mal was bestelle, was ich eigentlich nicht mag, dann erinnere mich daran und lasse es nicht zu. Aber weißt du, ich habe eine so liebe Mami, und die möchte ich nicht enttäuschen … Sie mag es nicht, wenn ich mich mit Süßem vollstopfe, aber sie meckert auch nicht wirklich, weil sie mich viel zu lieb hat. Mir geht es ganz schön gut. Ich habe tolle Eltern, tolle Geschwister, und nachdem die aus dem Haus sind, bin ich die Prinzessin auf der Erbse. Da ist ein Mädchen aus unserer Klasse ganz schön arm dran. Sie ist neu bei uns, und ich habe mitbekommen, wie zwei Lehrerinnen sich unterhalten haben, dass sie ein schweres Leben in Kinderheimen hinter sich hat und jetzt von Leuten adoptiert wurde. Die Frau Wieland hat gesagt, dass es ein Glück für das Mädchen ist. Das finde ich nicht. Es geht doch nichts über eigene Eltern.«
Manuel schob in seinem Eisbecher das Zitroneneis beiseite, das er überhaupt nicht mochte.
»Bambi, das darfst du nicht so eng sehen, nicht alle Adoptiveltern sind so böse, wie man das manchmal in Büchern liest. Sieh mal, meine Mama hat nur die Babette als leibliches Kind, meine Mama ist gestorben, als ich noch ein Baby war, deswegen weiß ich nicht genau, wie das mit ihr gewesen wäre. Aber ich glaube ganz bestimmt, nicht anders als mit meiner Sandra-Mama, die ist das Beste, was es gibt, ich liebe sie über alles, und sie liebt mich. Kein bisschen anders als Babette. Vielleicht hat das Mädchen aus deiner Klasse ja auch Glück, und die Leute, die sie adoptiert haben, sind nett.«
Bambi musste erst mal ein wenig von ihrem Eis essen, dann verdrehte sie genüsslich die Augen, brauchte noch etwas davon, ehe sie die Achseln zuckte und sagte: »Ach, weißt du, Manuel, ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Ich wünsche es Melanie, aber ich danke dem lieben Gott, dass ich in die richtige Familie hineingeboren wurde, mit Mama, Papa und mit Ricky, Jörg und Hannes. Der fehlt mir am meisten, und ich kann mir nur wünschen, dass er nicht nach Amerika gehen wird, um dort zu studieren.«
»Das ist doch cool«, bemerkte Manuel und schob seinen Eisbecher, von dem er kaum etwas gegessen hatte, beiseite, »dann kannst du ihn dort besuchen.«
»Ach nö, ich hätte ihn lieber hier. Ich werde, wenn ich Abitur habe, nirgendwohin gehen, ich bleibe für immer hier in unserem Sonnenwinkel, bei Mami, Papi, bei den Großeltern, aber auch bei euch, ganz besonders bei dir.«
Ach, die Bambi!
Manchmal war sie noch so richtig klein, wie gerade jetzt.
»Die Oma Marianne sagt immer, dass alles seine Zeit hat, dass man nichts festhalten kann. Ich werde ganz gewiss nicht für immer hierbleiben, wenn ich das Abi habe, dann gehe ich weg, studiere auf jeden Fall ganz weit entfernt oder im Ausland, so wie Hannes es plant, fände ich auch cool. Kann aber auch sein, dass ich mir, genau wie dein Bruder, erst mal den Wind um die Nase wehen lasse und als Backpacker quer durch die Welt reise.«
»Und eure Fabrik?«, erinnerte Bambi ihn.
Er zuckte die Achseln. »Das ist Papas Fabrik, das ist sein Ding. Kann sein, dass ich mal bei ihm einsteige, kann aber auch sein, dass ich etwas ganz anderes machen werde. Papa sagt, dass er mir keine Steine in den Weg legen wird, und der Meinung ist auch Mama.«
Solche Gespräche führte Bambi nicht gern, natürlich wusste sie, dass auch ihre Kindheit im Sonnenwinkel einmal vorüber sein würde, sie war es ja beinahe schon. Und natürlich würde sie weggehen, zumindest, um zu studieren. Aber nein, reden wollte sie jetzt darüber nicht.
Es ging auch überhaupt nicht, denn draußen wurde gehupt.
Felix Münster war genommen, um seinen Sohn und Bambi abzuholen und sie mit nach Hause zu nehmen.
Bambi hatte ihren Eisbecher ausgelöffelt, als sie sah, dass »Tutti-Frutti« fast unberührt war und man es beinahe schon trinken konnte, weil das Eis geschmolzen war, bekam sie ein schlechtes Gewissen.
»Manuel, tut mir leid. Es war ganz schön egoistisch von mir, dein Eis zu essen. Ich hab nicht drüber nachgedacht, dass dir Fruchteis und Obst nicht schmecken könnten.«
Sie standen auf, gingen zur Tür, es traf sie mancher Blick, in erster Linie allerdings Bambi, die wirklich sehr hübsch war, und der so mancher Junge bereits jetzt schon begehrliche Blicke zuwarf.
Zum Glück bemerkte Bambi das noch nicht, Manuel allerdings schon.
Als sie am Tisch von Kalle Hoger vorübergingen, der in Bambi so richtig verknallt war, legte Manuel seiner Freundin eine Hand auf die Schulter und sagte ganz cool: »Bambi, entspann dich, ist alles okay. Du weißt doch, für dich tu ich alles.«
Bambi seufzte: »Ach, Manuel, du bist ein solcher Schatz.« Und Kalle wurde vor lauter Zorn rot im Gesicht.
*
Monika Lingen, die Wirtin des Seeblicks hatte Glück gehabt. Roberta hatte ihr das Leben gerettet. Und sie hatte sich von ihrem Herzinfarkt schon recht gut erholt. Aber sie durfte das Krankenhaus noch lange nicht verlassen, und wenn, dann nicht um nach Hause zu gehen, sondern erst einmal in die Reha.
Monika war nicht nur eine hervorragende Köchin, sondern sie war die Seele des Gasthofs, und ihr Mann Hubert war ohne sie hilflos und verloren.
Zum Glück gehörte er zu den wenigen Männern, die sich das auch eingestehen konnten, ohne dass ihnen ein Zacken aus der Krone brach.
Die Stammgäste kamen noch immer, aber diejenigen, die nur gekommen waren, um die Köstlichkeiten zu genießen, die Monika an ihrem Herd zauberte, blieben natürlich aus.
Wie sollte es weitergehen?
Hubert, nun fest in Behandlung von Roberta, hatte mit der Ärztin gesprochen, und die hatte ihm klar gemacht, dass die alten Zeiten auch nach der Reha nicht zurückkommen würden.
Ein Herzinfarkt war kein Schnupfen oder etwas anderes, was in ein paar Tagen oder Wochen vorbei war.
Sie mussten miteinander reden!
Das hatte die Frau Doktor ihm deutlich gemacht, und er hatte es versprochen, auch wenn er eher zu den Menschen gehörte, die den Kopf gern in den Sand steckten und etwas lieber aussaßen.
Er hatte nie Monikas Power gehabt.
Er hatte einen besonders schönen Blumenstrauß gekauft und eine von den Glanzzeitschriften, die seine Monika so sehr liebte und wo sie kaum die Zeit gehabt hatte, sie zu lesen, sie hatte oftmals kaum darin blättern können, weil sie keine Zeit gehabt hatte oder zu müde gewesen war.
Jetzt hatte sie Zeit, und er war bereit, alles für sie zu tun. Er war so froh und dankbar, dass sie diesen Herzinfarkt überlebt hatte. Nicht auszudenken, was sonst passiert wäre.
Sie lag in einem Einzelzimmer, und sie lächelte, als sie ihren Besucher erkannte.
»Hubert, nicht schon wieder Blumen«, sagte sie, »das ist doch nicht nötig, aber schön sind sie. Und eine Zeitschrift hast du auch mitgebracht. Du verwöhnst mich.«
Er zog sich einen Stuhl an ihr Bett, gab ihr einen Kuss, ehe er sich hinsetzte.
»Nein, Monika, das hätte ich mal eher tun sollen. Für mich war alles selbstverständlich. Die Frau Doktor hat mir die Augen geöffnet und mich auf die richtige Spur gebracht. Ich habe heute früh mit ihr geredet, und jetzt bin ich hier, weil ich es ihr versprochen habe.«
»Und der Seeblick?«, erkundigte seine Frau sich sofort.
»Den mache ich erst heute Abend wieder auf.«
Das war so ungewöhnlich, so neu.
»Aber die Gäste, Hubert«, rief sie.
Er nahm ihre schmale Rechte in seine großen Hände.
»Seit wir den Gasthof bewirtschaften, haben wir an nichts anderes mehr gedacht, immer nur an den Seeblick, an die Gäste. Dabei sind wir auf der Strecke geblieben und haben es nicht einmal bemerkt. Wir haben niemals an uns gedacht …, dein Zusammenbruch war ein Schock, der mir noch jetzt in den Gliedern sitzt. Ich hätte dich beinahe verloren. Moni, so kann es nicht weitergehen, die Frau Doktor hat recht, wir müssen etwas verändern.«
Monika Lingen blickte ihren Ehemann ganz erstaunt an. So hatte er in all den Jahren, in denen sie den Gasthof bewirtschafteten, niemals geredet. Für ihn hatte immer nur die Arbeit gezählt, und es war nicht einmal ein Urlaub von wenigstens einer Woche drin gewesen. Nun diese Kehrtwendung.
»Aber was, Hubert? Was sollen wir verändern?«
Er zuckte die Achseln.
»Ich weiß nicht«, sagte er ein wenig hilflos. »Wir haben doch beide schon lange keine Wünsche geäußert, und wenn mal was kam, verlief es schnell im Sande. Wir haben niemals an uns gedacht. Ich denke, das müssen wir wieder lernen, und wir müssen uns ganz ernsthaft überlegen, wie unser Leben weitergehen soll.«
»Wie bisher, nur ein wenig langsamer«, meinte sie. »Vielleicht machen wir die Restauration erst abends auf. Tagsüber bieten wir nur kleine Gerichte an. Das erspart viel Arbeit. Und die meisten der Gäste, die tagsüber kommen, wollen doch eh nur etwas trinken oder Kaffee und Kuchen bestellen.«
Er schüttelte den Kopf.
»Das ist nicht die Lösung. Ich kenne dich. Du würdest wieder herumwuseln wie früher, als sei nichts geschehen. Du bist dem Tod, dank der Frau Doktor Steinfeld, gerade noch von der Schippe gesprungen. Das ist eine Gnade, ein Geschenk des Himmels. Ein solches Glück soll man nicht ein zweites Mal herausfordern.«
Er beugte sich vor, streichelte ihr Gesicht.
»Moni, ich liebe dich. Ich möchte dich nicht verlieren, ein Leben ohne dich wäre für mich unvorstellbar.«
Monika Lingen freute sich über solche Worte. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann er das »Ich liebe dich« zum letzten Mal ausgesprochen hatte.
Aber sie war auch ein wenig irritiert. Ihr Mann hatte den Schalter so vollkommen umgekippt. Er verhielt sich so anders.
Ehe sie etwas sagen konnte, wurde angeklopft, die Tür aufgerissen, eine Krankenschwester kam ins Zimmer gestürmt und sagte: »Frau Lingen, der Herr Professor will Sie sehen, und es steht auch noch eine Untersuchung aus, die er Ihnen nicht ersparen kann.«
Sie wandte sich an Hubert.
»Tut mir leid, Herr Lingen, dass ich Ihre Frau entführen muss.«
Dafür hatte er natürlich Verständnis, erhob sich, die Schwester schob einen Rollstuhl ans Bett, und als Monika protestieren wollte und sagte, sie könne allein gehen, wehrte die Schwester ganz entschieden ab.
»Sie laufen genug herum, aber der Weg zum Untersuchungsraum ist entschieden zu weit. Also, keine Widerrede, meine Liebe.«
Monika gehorchte und die Schwester war zufrieden.
Ehe sie gemeinsam das Krankenzimmer verließen und in verschiedene Richtungen gingen, sagte die Schwester: »Herr Lingen, Sie müssen mal ernsthaft mit Ihrer Frau reden und ihr begreiflich machen, dass ein Herzinfarkt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist.«
Er versprach es, und er war froh, dass er schon einmal damit angefangen hatte, mit seiner Moni zu reden.
Es war fünf nach Zwölf, der Zeiger der Uhr ließ sich nicht zurückdrehen, was geschehen war, war geschehen. Aber man konnte ihn anhalten und durch bewusste Lebensführung das Weiterticken in die richtige Bahn bringen.
Als er zum Aufzug ging, war er niedergeschlagen. Er wusste wirklich nicht, wie alles weitergehen sollte, er wusste nur, dass ihnen ihr Leben derzeit ganz schön um die Ohren flog, seiner Moni und ihm. Wobei er nur einen Warnschuss erhalten hatte, sie aber war getroffen worden, ausgerechnet seine Moni.
Es musste alles anders werden, das stand fest, und sie würden auch eine Lösung finden.
Der Aufzug kam, hielt mit einem sanften Ruck an, und er besann sich. Er stieg nicht ein, sondern nahm die Treppe. Das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
*
Professor Heribert Bohland war ein anerkannter Herzspezialist, und er war auch nicht einer dieser Halbgötter in Weiß, sondern ein sehr herzlicher Mensch, dem das Wohl der ihm anvertrauten Patienten am Herzen lag.
Er war sogar schon einige Male mit seiner Familie im Seeblick zum Essen gewesen und war stets ganz begeistert gewesen. Doch er hatte auch mitbekommen, welche Knochenarbeit die nun vor ihm sitzende Frau da leistete.
Er hatte mit Monika Lingen die Befunde durchgesprochen, auch das Ergebnis der letzten, gerade erfolgten Untersuchung.
»Frau Lingen, es sieht gut aus. Sie hatten Glück, und wenn Sie gewisse Regeln einhalten, können Sie hundert Jahre alt werden, aber das nur, wenn Sie eine hundertprozentige Kehrtwendung machen. Alles was war, das geht nicht mehr. Sie haben Raubbau mit Ihrer Gesundheit getrieben und auf keines der Warnsignale Ihres Körpers geachtet. Ich will jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger weiterreden, und ich kann Ihnen auch keine Vorschriften machen. Sie sind kein Kind, sondern eine erwachsene Frau. Und Sie sind bei Frau Dr. Steinfeld in den allerbesten Händen, sie ist eine ganz großartige Kollegin. Sie wird alles für Sie tun, Sie müssen sich nur daran halten, was die Frau Doktor Ihnen sagt.«
Das alles klang nicht ermutigend, aber wenn sie sich an alles hielt und eine Kehrtwendung machte, drohte keine Gefahr. Hundert Jahre konnte sie werden, das wollte sie überhaupt nicht, aber ein paar Jährchen wollte sie schon noch leben, ehrlich gesagt, mehr als nur ein paar Jährchen.
Sie war nicht dumm und sie war nicht lebensmüde.
»Ich werde über alles nachdenken«, sagte sie, »zumal mein Mann auch bereits einige Andeutungen machte.«
Er nickte zufrieden.
»Ich möchte Sie jetzt noch eine Woche hier behalten, und dann habe ich schon mit einem alten Freund gesprochen, der eine sehr gute Reha-Klinik leitet, in der Sie ganz hervorragend aufgehoben sein werden. Es ist bereits ein Zimmer für Sie reserviert.«
Er erklärte ihr noch etwas, dann war das Gespräch beendet, der Professor wollte eine Schwester rufen, damit sie zurück in ihr Zimmer gebracht werden konnte. Doch davon wollte Monika nichts wissen.
»Ich möchte allein zurückgehen, ich verspreche, es ganz langsam zu tun und, wenn erforderlich, unterwegs auch Pausen einzulegen. Ich muss über einiges nachdenken, das kann ich am allerbesten, wenn ich mich dabei bewege.«
Er war einverstanden.
»Geht mir auch so«, sagte er, »denken Sie auf jeden Fall auch darüber nach, dass wir nur dieses eine Leben haben.«
Dann verabschiedete er sich von ihr, sie verließ sein Zimmer und setzte sich langsam, so wie besprochen, in Bewegung.
Das Gespräch war gut verlaufen, er hatte ihr keine Angst gemacht, ihr aber eindeutig klargemacht, dass sie in eine andere Richtung gehen musste.
In welche?
Sie hatte keine Ahnung.
Sie sah eine Bank und setzte sich erst einmal hin, nicht, weil das Laufen sie anstrengte, sondern weil allmählich Erinnerungen in ihr hochkamen, die sie jahrelang verdrängt hatte.
Hubert und sie hatten sich beim Studium kennengelernt und sofort ineinander verliebt. Sie waren jung und unternehmungslustig gewesen und hatten sehr schnell festgestellt, dass es noch etwas anderes geben musste als einen Hörsaal einer Universität.
Er hatte das BWL-Studium angefangen, weil ihm nichts besseres eingefallen war, und sie war dem Drängen ihrer Eltern gefolgt. In den Semesterferien hatten sie auf einem Kreuzfahrtschiff einen Job als Animateure angenommen und waren durch die Karibik geschippert, hatten Spaß gehabt, viel gesehen und dabei auch noch Geld verdient.
Nach dieser Kreuzfahrt waren sie das gewesen, was man Studienabbrecher nannte.
Hier und da waren sie noch auf Schiffen gewesen, wenn es interessante Reisen waren, ansonsten waren sie durch die Welt gereist und hatten die Jobs angenommen, die sich boten, um das Geld für die Weiterreise zu haben. Sie hatte ihr Hobby, das Kochen, zu ihrem Beruf gemacht und es sogar bis in die Küche des Waldorf Astoria in New York geschafft, wo man sie ungern hatte gehen lassen.
Irgendwann hatten sie festgestellt, dass man in Montevideo oder in Kapstadt, in Neuseeland, Australien, Kanada oder wo auch immer auf der weiten Welt auch nur in Betten schlafen konnte.
Sie hatten vieles gesehen, waren ein wenig müde geworden, und da bekamen sie die Nachricht von der Erbschaft. Hubert hatte von einem Onkel nicht nur ein Mehrfamilienhaus geerbt, sondern auch ein stattliches Vermögen.
An das Mehrfamilienhaus gingen sie nicht ran, weil das ihre Altersabsicherung war, doch für das Geld kauften sie den Gasthof »Seeblick«, weil sie zu dem Zeitpunkt nichts weiter haben wollten als Ruhe.
Und dann waren sie in eine Tretmühle geraten, in der sich das Rad immer schneller zu drehen begann. Sie waren, ohne es zu merken, vom Alltag aufgesogen worden, waren träge geworden, was ihre eigenen Bedürfnisse betraf.
Wie hatte es dazu kommen können?
Sie wusste es nicht. Es war ein schleichender Prozess gewesen.
Das Schrecklichste war, dass sie einander verloren hatten, ohne es zu merken.
Hubert hatte sich hinter seinem Tresen verschanzt, eifrig mit seinen Gästen gebechert, mehr als nötig gegessen und sich kaum bewegt.
Und sie?
Sie hatte sich in der Küche ausgetobt und da so eine Art von Profilneurose entwickelt, die darin mündete, dass sie niemanden an den Herd ließ, dessen alleinige Herrscherin sie sein wollte, bis zur Erschöpfung und bis zum Zusammenbruch, der beinahe tödlich geendet hätte.
Warum hatten sie das alles zugelassen?
Warum waren sie beide ihre eigenen Wege gegangen, die für sie beide nicht gut gewesen waren?
Auch diese Frage konnte sie sich nicht beantworten. Eine Antwort könnte vielleicht sein, dass sie in den Jahren ihrer Wanderschaft zu sehr aufeinandergeklebt hatten und danach ein wenig Abstand nötig gewesen war.
Sie stand wieder auf, ging langsam weiter.
Als er die drei Worte »ich liebe dich« ausgesprochen hatte, war ihr bewusst geworden, wie sehr sie ihn ebenfalls liebte. Er war träge geworden, hatte an Gewicht erheblich zugelegt, sein Blutdruck stimmte nicht, aber er war noch immer der Mann, auf den sie sich eingelassen hatte. Er würde sie wieder besuchen, und dann würde sie ihm diese drei Worte zuflüstern, und dann …
Dann würden sie gemeinsam überlegen, wie es mit ihnen weitergehen, wohin ihr Weg sie führen wollte.
Weg vom Seeblick?
Noch war es unvorstellbar, doch es sah ganz danach aus, und dann würden sie keine Studienabbrecher sein, sondern … Wie sollte man es nennen? Berufsaussteiger? Existenzabbrecher?
Es war zu früh, sich darum Gedanken zu machen.
Was immer auch geschehen würde, sie würden es Seite an Seite tun. Sie und Hubert waren ein gutes Team, das hatten sie bewiesen, es vorübergehend nur vergessen.
Sie lebte, und das allein war es, was zählte.
Und Hubert war an ihrer Seite, ihr Hubert …
Ein weiches Lächeln umspielte ihre Lippen, wenn sie an ihn dachte. Und das war ein gutes Zeichen.
*
Stella Auerbach war ein ausgesprochener Familienmensch. Sie genoss es, für ihren Mann und ihre beiden Töchter da zu sein, und sie sah es auch als ihre Pflicht an, mit ihren Eltern, den Schwiegereltern und dem Rest der Familie in Kontakt zu sein.
Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass ihr das auch die Erbschaft von Tante Finchen eingebracht hatte.
Doch zu Stellas Rechtfertigung musste gesagt werden, dass sie sich fürsorglich um Finchen gekümmert hatte, die schwierig gewesen war, um nicht zu sagen, unleidlich. Sie hatte Finchen eingekleidet, ihren Kühlschrank gefüllt und ihr hier und da sogar Geld zugesteckt. Niemand hatte ahnen können, dass Finchen ein Vermögen unter dem Kopfkissen gebunkert hatte, das Stella vermacht worden war.
Für Fabian, Stellas Bruder, der leer ausgegangen war, war das vollkommen in Ordnung gewesen.
Für alle anderen auch, nur nicht für die Rückerts, Stellas und Fabians Eltern. Die hatten es ganz unmöglich gefunden, waren der Meinung gewesen, zunächst einmal stünde ihnen das Geld zu. Sie hatten jedoch zum Glück Finchens Testament nicht angefochten. Das hätte sie ins Gerede gebracht, und das wollten sie auf keinen Fall. Heinz und Rosmarie Rückert waren sehr auf ihren guten Ruf und ihre gesellschaftliche Stellung bedacht. Sie waren schließlich wer in Hohenborn. Sie hatten es doch auch überhaupt nicht nötig, sie waren das, was man als sehr wohlhabend, vielleicht sogar reich, bezeichnen konnte. Aber es war vermutlich wirklich so, dass jeder, der bereits mehr als genug besaß, immer noch mehr haben wollte, den Hals einfach nicht vollkriegen konnte.
Ja, die Rückerts …
Sie waren nett, keine Frage, aber sie dachten halt in erster Linie an sich, an ihre eigenen Bedürfnisse, da hatten sich wirklich die Richtigen gefunden.
Stella hätte an diesem Nachmittag lieber etwas anderes unternommen, anstatt ihre Eltern zu besuchen. Doch diese Nachmittagsbesuche zu festen Zeiten hatten sich eingebürgert, und Stella traute sich nicht, daran zu rütteln. Ihre Eltern, ganz besonders ihre Mutter, würden das nicht verstehen, sie wäre beleidigt.
Wie anders waren da doch ihre Schwiegereltern, die Auerbachs. Bei denen konnte man absagen, konnte man Termine kurzfristig verschieben. Die waren in jeder Hinsicht pflegeleicht. Sie waren offen, herzlich, liebevoll. Und zuerst lag ihnen das Wohl ihrer Kinder, Schwiegerkinder und Enkel am Herzen.
Stella hatte sich vom ersten Augenblick an bei den Auerbachs heimisch gefühlt, aufgenommen und verstanden.
Wahrscheinlich hatten ihr Bruder Fabian und sie sich auch aus diesem Grunde sofort in zwei der Auerbach-Sprösslinge nicht nur verliebt, sondern sie auch geheiratet.
Sie und Jörg Auerbach waren ein Paar, und Fabian war mit Ricky sehr, sehr glücklich.
Wärme und Herzlichkeit hatten Stella und Fabian bei ihren Eltern niemals kennengelernt. Für den Notar Rückert und seine Frau war immer nur ein Leben nach Außen wichtig gewesen, und daran hatte sich bis heute nichts verändert. Warum sie überhaupt Kinder hatten, diese Frage konnten sie sich vermutlich nicht einmal selbst beantworten. Wahrscheinlich waren Fabian und Stella für sie so etwas wie Statussymbole, die halt dazugehörten. Und Familien machten sich auf Fotos immer gut.
Sie und Fabian waren mit Kinderfrauen groß geworden, die sich um ihre Bedürfnisse gekümmert hatten, die dagewesen waren bei Krankheit und kleinen Kümmernissen.
Es war gut gegangen. Und deswegen waren die Rückerts fest davon überzeugt, alles richtig gemacht zu haben.
Stella fuhr vor der eleganten Villa vor, parkte.
Es war nicht ihr Elternhaus, das war verkauft worden, und sie und Fabian fragten sich noch immer, welcher Teufel ihre Eltern geritten hatte, sich eine so große, moderne Villa bauen zu lassen, die sie allein bewohnten.
Wegen der Leute?
Um Reichtum zu demonstrieren?
Stella fand die Villa schrecklich, und da stimmte sie mit ihrem Bruder, mit dem sie nicht immer einer Meinung war, vollkommen überein.
Sie holte aus ihrem Kofferraum die Käsetorte, die sie extra für ihre Eltern gebacken hatte, dann ging sie zu dem etwas pompösen Eingangsportal und klingelte.
Weder sie noch Fabian besaßen einen Schlüssel zu der Villa ihrer Eltern. Sie hatten sich auch nicht darum bemüht.
Ihr Vater öffnete die Tür, blickte sie vorwurfsvoll an und sagte noch vor der Begrüßung: »Du bist spät dran.«
Stella blickte auf ihre Armbanduhr. Sie wusste, wie ihre Eltern drauf waren, und deswegen fuhr sie immer viel zu früh los, um solche Bemerkungen zu vermeiden.
»Papa, es sind keine fünf Minuten, und für den Stau, der wegen eines Auffahrunfalls entstanden war, kann ich nichts, ich konnte ihn auch nicht voraussehen.«
Heinz Rückert gab seiner Tochter die Hand, er ließ es nicht zu, dass man ihn umarmte. Stella konnte sich nicht daran erinnern, sich als kleines Mädchen irgendwann einmal in die Arme ihres Vaters gekuschelt zu haben. Er hatte sie immer auf Distanz gehalten, und sie hatte auch nicht das Bedürfnis gehabt.
Sie folgte ihrem Vater in den sogenannten Salon, der mit teuren und gewiss auch schönen Möbeln ausgestattet war. Doch es war eine kalte Pracht, und man kam sich unwillkürlich vor wie in einem Vorzeigezimmer eines exklusiven Möbelhauses.
Ihre Mutter saß bereits am Tisch, auch ihr Blick war vorwurfsvoll, immerhin reckte sie ihrer Tochter das Gesicht entgegen, damit sie ihr einen flüchtigen, angedeuteten Kuss auf die Wange hauchen konnte.
Typisch!
Stella war diese Art von Begrüßung gewohnt und regte sich deswegen auch nicht mehr darüber auf. Es hatte eine lange Zeit gegeben, da sie das sehr verletzt hatte. Und sie war nur widerwillig zu ihren Eltern gegangen. Jörg hatte ihr zugeredet, und er hatte gesagt, dass es ihre Eltern waren, dass sie diejenige sein musste, die nachzugeben hatte.
»Ich habe eine Käsetorte gebacken, Mama«, sagte Stella.
Rosmarie Rückert zog eine Augenbraue hoch.
»Käsetorte?«, wiederholte sie gedehnt.
Stella biss sich auf die Unterlippe, um eine heftige Erwiderung zu verhindern.
»Mama, wir haben darüber gesprochen. Du hast sie quasi bei mir bestellt. Ich kann sie wieder mitnehmen, Jörg und die Mädchen werden sich freuen.«
Rosmarie winkte ab.
Sie trug erlesenen Schmuck.
»Nein, ist schon gut. Du backst ja nicht schlecht, wenngleich ich sagen muss, dass Ricky das besser kann. Aber die fühlt sich ja zu Höherem berufen, und deswegen wird von ihr vermutlich so schnell nichts kommen.«
Wieder typisch!
Einen Seitenhieb musste ihre Mutter ihr immer versetzen, und offensichtlich hatte sie sich noch nicht damit abgefunden, dass Ricky trotz ihrer vier Kinder studieren wollte.
Das Mädchen kam herein, Rosmarie sagte, dass der Kaffee serviert werden könne und dass sie bitte den Kuchen auf einen Kuchenteller legen solle.
Das Mädchen ging hinaus, Stella setzte sich, und sie fühlte sich schlecht, weil sie sich nicht vorkam wie bei ihren Eltern, sondern irgendwo als eine Besucherin, die einen Pflichtbesuch absolvierte. Wobei das mit dem Pflichtbesuch sogar stimmte.
»Und, wie geht es den Kindern?«, erkundigte Heinz Rückert sich, der auf jeden Fall zu seinen Enkelinnen eine bessere Einstellung hatte als zu seinen Kindern.
»Nele darf an einem Malwettbewerb teilnehmen, und Caro schreibt eine Eins nach der anderen.«
»Das hat sie aber nicht von dir«, sagte prompt ihr Vater, und ihre Mutter bemerkte: »Sie heißt Carolin, nennt sie gefälligst auch so, dieses Caro ist albern.«
»Sie möchte aber so genannt werden, weil sie Carolin doof findet«, entgegnete Stella.
»Seit wann haben denn Kinder das Sagen? Wenn sie vom Eiffelturm springen will oder euch auffordert es zu tun, pariert ihr dann, Stella?«, ereiferte sich ihr Vater. »Kinder müssen wissen, wo es längs geht. Aber ja, zwei Mädchen, da lässt man so manches durchgehen. Ihr müsst noch einen Sohn bekommen. Wie sieht es denn damit aus?«
Stella seufzte.
Dieses Thema schnitt ihr Vater nicht zum ersten Mal an. Bislang hatte sie ihm ausweichend geantwortet, doch das wollte sie nicht länger.
»Papa, unsere Familienplanung ist abgeschlossen. Die Mädchen sind aus dem Gröbsten raus, und ich habe keine Lust, noch einmal von vorne anzufangen.«
»Wieso das denn nicht? Du hängst doch eh nur zu Hause rum, da kommt es auf ein Kind mehr oder weniger nicht an. Und außerdem kannst du dir dank Finchen auch Kinderfrauen erlauben.«
Stella musste sich zusammenreißen. Sie war drauf und dran aufzustehen und zu gehen, nur, das könnte einen dauerhaften Bruch bedeuten, weil ihre Eltern sehr nachtragend sein konnten. Und das wollte sie wegen ihrer Töchter verhindern.
»Jörg und ich wollen unsere Kinder aufwachsen sehen, und wir wollen ihnen liebevolle Eltern sein. Das ist uns bislang gelungen, und jetzt kommt die Zeit, da wir mit ihnen reisen, ihnen die Welt zeigen und erklären können. Darauf freuen wir uns alle.«
Das Mädchen brachte den Kuchen, appetitlich angerichtet auf einem Silberteller, und den Kaffee.
Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater stürzten sich auf den Kuchen, doch es kam kein Wort des Lobes. Das allerdings kannte Stella bereits. Von ihrer Schwiegermutter würde Stella dann erfahren, dass Rosmarie ihr ganz stolz berichtet hatte, dass Stella nur für sie allein einen ganz wunderbaren Kuchen gebacken hatte.
Sie nahmen sich beide ein zweites Stück der Käsetorte, und das war für Stella endgültig das Zeichen, dass es ihren Eltern schmeckte.
Ihr Vater griff das vorausgegangene Thema wieder auf, denn für ihn war das mit den Enkeln noch nicht abgeschlossen. Auch wenn es ein Auerbach sein würde, gehörte ein Junge einfach noch dazu, auch wenn er seine beiden Enkelinnen wirklich sehr gernhatte.
»Welch verrückte Welt, die eine will mit vier Kindern an der Backe noch studieren, weil sie plötzlich das Gefühl hat, sich verwirklichen zu wollen, und dir, die überhaupt nichts macht, ist ein drittes Kind undenkbar.«
»Ihr habt auch nur zwei Kinder bekommen«, erinnerte Stella ihre Eltern.
»Nun ja, wir hatten Glück und haben das bekommen, was wir wollten. Weitere Kinder wären nicht möglich gewesen wegen all unserer gesellschaftlichen Verpflichtungen.«
Das schlug dem Fass wirklich den Boden aus.
Mit ihren Eltern wurde es immer schlimmer.
Stella war wütend.
»So wie ihr drauf seid, hättet ihr überhaupt keine Kinder bekommen dürfen. Ihr habt euch nicht gekümmert.«
Rosmarie holte tief Luft, ehe sie etwas sagen konnte, fuhr Stella fort: »Mama, hast du uns jemals eine Geschichte vorgelesen? Hast du je mit uns gesungen?«
Rosmarie sagte nichts, lief nur rot an.
»Wir müssen keine alten Kamellen vorholen, Mama«, Stella entschloss sich, es nicht auf die Spitze zu treiben, zumal es ohnehin nichts bringen würde. »Nele und Caro«, sie betonte es nachdrücklich, »sind Wunschkinder. Jörg und ich wollten nie mehr als zwei Kinder haben, weil wir auch Zeit füreinander brauchen. Wir haben keine gesellschaftlichen Verpflichtungen, aber wir lieben es, beisammen zu sein, miteinander zu reden oder einfach nur die Nähe des anderen zu genießen. Das ist wichtig für uns, das gibt uns viel. Und wir treffen uns auch gern mit Fabian und seiner Familie.«
Sie hatten nicht mitbekommen, dass es geklingelt hatte, Fabian stand plötzlich im Raum und erkundigte sich: »Habe ich da meinen Namen gehört?«
Welch ein Glück, dass Fabian so unverhofft gekommen war, der konnte dafür sorgen, dass alle wieder herunterkamen, ganz besonders sie. Stella war heute ein wenig auf Krawall gebürstet und wollte nicht länger eine Faust in der Tasche machen.
Fabian begrüßte seine Schwester und seine Eltern, die keine Freude zeigten, was eigentlich normal wäre, sondern ein wenig Verwirrung.
»Waren wir verabredet?«, erkundigte Rosmarie sich, für die es unerträglich gewesen wäre, so etwas vergessen zu haben. Fabian lachte.
»Nein, Mama, entspann dich, du hast nichts vergessen, und ich habe mir erlaubt, einfach so hereinzuplatzen. Ehrlich gesagt, weil ich gehofft hatte, dass Stella ihre berühmte Käsetorte gebacken und mitgebracht hat. Ich hatte an meiner früheren Schule einen Termin. Dort will sich eine Studienrätin aus privaten Gründen verändern, und ich suche händeringend jemanden für die Fächer Geschichte und Philosophie. Sie scheint eine gute Lehrerin zu sein, und ich hoffe, dass sie sich dafür entscheiden kann, an meine Schule zu kommen.«
Stelle verstand sich ausnehmend gut mit ihrem Bruder, was gewiss daher rührte, dass sie als Kinder nur sich gehabt hatten.
»Natürlich wird sie kommen«, sagte sie sofort, »du bist ein fantastischer Schulleiter, und deine Schule hat, dank dir, einen ausgezeichneten Ruf. Schön, dass du da bist, Fabian.«
Rosmarie klingelte, ließ ein weiteres Gedeck bringen, und dann genoss Fabian erst einmal den Kuchen.
»Himmlisch«, sagte er, »wärest du nicht meine Schwester, würde ich dich allein wegen deiner Käsetorte heiraten.«
»Ricky backt sie besser«, wiederholte Rosmarie sich.
»Nein, Mama, nicht besser …, anders. Aber erst einmal komme ich nicht in den Genuss eines von meiner Frau gebackenen Kuchens. Ricky ist voll mit den Vorbereitungen für das Studium beschäftigt.«
»Es hat noch nicht einmal begonnen, und schon kriegt sie es nicht geregelt«, wandte prompt Heinz Rückert ein, der von dieser Idee ebenso wenig hielt wie seine Frau. Welch verrückte Idee, plötzlich studieren zu wollen, und das als Mutter von vier Kindern!
»Sie bekommt es geregelt, Papa. Ricky ist eine Strategin im Planen und Koordinieren. Wir müssen uns keine Sorgen machen, sie bekommt alles unter einen Hut. Und Kuchen, den kann man auch kaufen, wenn man ihn unbedingt essen will. Ich finde es großartig, dass Ricky etwas für sich tun will. Und meine volle Unterstützung hat sie auf jeden Fall. Wir werden übrigens nun doch noch in den Urlaub fahren.«
»Das auch noch?«
»Wohin?«
»Ich freue mich.«
Die Stimmen schwirrten durcheinander, und das nutzte Dr. Fabian Rückert, um rasch einen Schluck Kaffee zu trinken.
Als wieder Ruhe eingekehrt war, sagte er: »Wir fahren wieder nach Frankreich, genau gesagt in die Bretagne, auf die Halbinsel Quiberon. Dort fühlen wir uns wohl, dorthin fahren wir gern, und Monsieur Crespel von der Agentur hat uns sofort angerufen, als ein Ferienhaus, auf das wir scharf waren, wieder im Angebot war, weil die Leute, die es haben wollten, aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten mussten. Der Mann hatte einen Betriebsunfall und liegt im Krankenhaus. Tja, was des einen Leid ist des anderen Freud.«
»Ist das nicht alles ein bisschen viel?«, wollte seine Mutter wissen. »Man kann nicht alles haben.«
Fabian warf seiner Mutter einen langen Blick zu.
»Das sagst ausgerechnet du, Mama?«
Stella hätte sich niemals getraut, so etwas zu sagen, Fabian schon, doch ihrem Sohn gegenüber waren die Rückerts auch nachsichtiger.
Warum auch immer, sie schienen es eher mit den Jungens zu haben.
Die Lage entspannte sich immer mehr, weil Fabian es einfach nicht zuließ, dass jemand etwas in den falschen Hals bekam und die Stimmung eskalierte.
Er war wirklich ein guter Lehrer, der ganz entspannt auch seine Eltern und seine Schwester im Griff hatte.
Heinz Rückert hätte es viel lieber gesehen, dass sein Sohn in seine Fußstapfen getreten wäre. Doch Fabian hatte sich durchgesetzt, sie nicht, und deswegen war sie vermutlich auch ein wenig auf der Strecke geblieben, weil die Erwartungshaltung ihres Vaters, die plötzlich auf ihr lag, sie erdrückt hatte.
Konnte es sein, dass er sich Enkel wünschte, weil er hoffte, dass einer von ihnen seine Nachfolge antreten würde?
Dieser Gedanke schoss Stella plötzlich durch den Kopf, und das machte ihr so richtig bewusst, wie zwanghaft ihre Eltern doch waren.
Letztlich wurde es doch noch ein schöner Nachmittag, es wurde sogar gelacht. Und als Stella den Rest des Käsekuchens wieder mitnehmen wollte, weil er doch nicht so besonders schmeckte, erlebte sie eine Überraschung. Ihre Eltern wollten davon nichts wissen.
Gemeinsam mit Fabian verließ Stella die Villa.
»Gut, dass du gekommen bist. Du hast mich gerettet, Fabian«, sagte sie und umarmte ihn. »Es wird immer unerträglicher mit ihnen, zu allem kommt jetzt ganz offensichtlich auch noch der Altersstarrsinn.«
»Schwesterlein, du musst dir nicht alles zu Herzen nehmen, und du musst nicht auf alles eingehen, was sie sagen. Irgendwann beruhigen sie sich wieder. Sie sind halt wie sie sind. Grüß Jörg und die beiden Grazien, und wenn das Wetter so bleibt, dann könnten wir eigentlich auch mal wieder grillen. Das finden alle Kinder toll.«
Stella nickte.
»Und meine ganz besonders euren Pool. Aber das mit dem grillen ist eine gute Idee. Ich erkläre mich auch bereit, für das Fleisch zu sorgen und für Salate und einen Nachtisch. Ricky hat wirklich eine Menge an der Backe. Ich wundere mich immer wieder, wie sie das schafft und dabei auch noch so gut aussieht und stets gut gelaunt ist. Ihr seid so eine richtige Vorzeigefamilie, kluge, schöne Eltern, vier liebreizende Kinder, eines besser geraten als das andere. Du hast Glück gehabt, Bruder. Und es war sehr klug von dir, Ricky sofort sicherzustellen, als die Auerbachs in den Sonnenwinkel gezogen sind. Es gab noch andere junge Männer, die heiß auf Ricky waren.«
»Aber sie wollte nur mich. Es war halt die magische, die unvergleichliche Liebe auf den ersten Blick. Auch wenn es mit dir und Jörg anders gelaufen ist, und ihr einen kleinen Anlauf gebraucht habt, beklagen musst du dich auch nicht. Ich finde, sie sind etwas Besonderes, die Auerbachs, und wir hatten beide Glück, in diese herzliche Familie einheiraten zu dürfen.«
Das konnte Stella nur bestätigen.
»Wir hatten außerdem großes Glück, dass wir nicht auf unsere Eltern gekommen sind. Warum sind sie bloß so? Haben sie Angst, Gefühle zu zeigen? Es stimmt doch alles nicht, diese protzige Villa in ihrem Alter, dieser Geiz. Sie sind nicht mehr die Jüngsten, glauben sie, das ewige Leben zu haben? Warum fangen sie nicht einfach an zu leben? Ich verstehe das nicht.«
»Ich auch nicht, Schwesterherz, aber ich habe aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Sie sind wie sie sind, wir werden sie nicht ändern, und ich fürchte, sie von sich aus auch nicht. So, ich muss, lass uns telefonieren, wann wir das mit dem Grillen starten wollen.«
Fabian umarmte seine Schwester noch einmal ganz herzlich, dann stieg er in sein Auto und fuhr los.
Ehe Stella in ihr Auto stieg, warf sie einen Blick zurück. Ihre Mutter stand am Fenster und blickte mit verkniffenem Gesicht nach draußen.
Ach Gott, warum machte sie sich das Leben so schwer? Warum stand sie sich selbst im Weg?
Stella winkte ihr zu, doch ihre Mutter zeigte keine Reaktion.
Welche Laus war ihr nun schon wieder über die Leber gelaufen?
Es war doch alles recht friedlich abgegangen, seit Fabian gekommen war.
Konnte sie nicht ertragen, dass sie und ihr Bruder sich so herzlich zugetan waren, dass sie sich umarmten?
Sie würde auch ihre Mutter gern umarmen, ganz gewiss, doch die müsste es zulassen.
Es hatte keinen Sinn, Stella stieg ebenfalls in ihr Auto und dann fuhr sie los, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Sie fühlte sich müde, erschöpft wie nach einem langen Arbeitstag, dabei war sie nur für ein paar Stunden bei ihren Eltern gewesen.
Stella wollte nicht schon wieder Vergleiche anstellen, doch es ging nicht anders.
Die Auerbachs waren so ganz anders.
Wenn sie von denen kam, da war sie beschwingt, gut gelaunt, und da war sie innerlich voller Liebe.
Ach, wie gern würde sie sich so fühlen, wenn sie von ihren Eltern kam.
Vielleicht sollte sie es ganz gelassen angehen wie ihre Schwiegereltern. Obwohl sie so ganz anders waren, hatten sie es doch geschafft, zu den Rückerts sogar so etwas aufzubauen wie ein loses freundschaftliches Verhältnis.
Sie nahmen sie wie sie waren und ließen es zu einer Konfrontation gar nicht erst kommen. Es war nicht so, dass sie brenzlige Themen vermieden, überhaupt nicht. Sie vertraten nur ruhig und bestimmt ihre Meinung, und wenn Rosmarie, die in erster Linie dazu neigte, sich zanken zu wollen, dann wechselten sie das Thema.
Vielleicht kam sie ja auch mal dahin, sich wenigstens nicht mehr über ihre Eltern zu ärgern.
Stella freute sich, nach Hause zu kommen, zu ihrem Mann und zu ihren beiden Süßen.
*
Roberta konnte es noch immer nicht glauben, was praktisch über Nacht geschehen war.
Die Patienten gaben sich die Türklinke in die Hand, und es waren bei Weitem nicht nur Neugierige, sondern Menschen, die wirklich krank waren, die Enno bereits seit Längerem behandelt hatte.
Sie war in ihrem Element, endlich konnte sie zeigen, was sie so drauf hatte. Und in einem Fall korrigierte sie sogar, natürlich ohne es dem Patienten zu sagen, Ennos Diagnose. Für sie war es keine langwierige Geschichte. Sie würde den Mann rasch wieder auf die Beine bringen.
Jetzt sah Roberta auch, wie gut ihre Mitarbeiterin war, und wie schnell und umsichtig sie arbeiten konnte. Und sie war bei den Patienten beliebt.
Es fing an, ihr so richtig Spaß zu machen, und sie bereute es nicht mehr, in den Sonnenwinkel gekommen zu sein.
Natürlich machte sie auch Hausbesuche, und das rechnete man ihr hoch an.
Ihr alter Freund Enno hatte sich da ein wenig gedrückt, und diese Hausbesuche vermieden, wenn sie zu vermeiden gewesen waren. Nur wenn es unumgänglich gewesen war, hatte er sie natürlich gemacht.
In gewisser Weise war er zu verstehen.
Der Arbeitstag in einer Arztpraxis war lang und anstrengend, und wenn man Familie hatte, wollte man die knappen freien Stunden mit seiner Frau und seinen Kindern verbringen.
Für Roberta war es einfacher. Sie musste nur für sich selbst sorgen. Wobei sie sich da allerdings auch ganz sträflich vernachlässigte, sich mit einem Butterbrot begnügte, weil sie sich nicht dazu aufraffen konnte, etwas für sich zu kochen. Sie hatte einfach nicht die Energie dazu, zumal sie zwar sehr gern sehr lecker aß, jedoch selbst keine begnadete Köchin war. Das gab sie offen zu. Also dieses Problem musste sie noch lösen, und sie hoffte auch da auf Ursel Hellenbrinks Hilfe.
Es war sehr schade, dass sie sich im »Seeblick« nicht mehr verwöhnen lassen konnte. Da war das Angebot sehr spärlich geworden, seit Monika Lingen sich in der Reha befand.
Und wie würde es da danach werden? Nach ihrer Rückkehr?
Für die Gäste sah es nicht gut aus, die jammerten, weil sie natürlich erst einmal ihre eigenen Bedürfnisse sahen, fantastisches Essen zu einem überaus günstigen Preis zu bekommen.
Roberta freute sich, weil ihre Worte sowohl bei ihm als auch bei ihr auf fruchtbaren Boden gefallen waren.
Hubert und Monika Lingen wollten und würden etwas verändern. Was genau, das wussten sie noch nicht. Doch das war durchaus verständlich.
Man gab ein Leben mit all seinen Gewohnheiten nicht so einfach auf. Da waren viele Überlegungen anzustellen, und man musste sich klar darüber sein, wohin die Reise gehen sollte.
Bei allem Unglück brauchten die Lingens sich finanziell um ihre Zukunft keine Sorgen zu machen. Doch wenn es möglich wäre, würden sie leichten Herzens und ohne zu zögern das Mehrfamilienhaus gegen Monikas Gesundheit eintauschen. Gesundheit ließ sich mit allem Geld der Welt nicht kaufen.
Auch heute hatte Roberta einen langen, anstrengenden Arbeitstag hinter sich. Und das ohne Pause, denn mittags hatte sie rasch noch Hausbesuche gemacht, und den letzten, den sie tagsüber nicht geschafft hatte, hatte sie jetzt hinter sich gebracht.
Sie war ganz schön fertig, doch es war eine Erschöpfung, die ihr auf jeden Fall lieber war als eine, die vom quälenden Nichtstun herrührte.
Sie war hungrig, müde. Und eigentlich war ihr danach, sich daheim auf ihr Sofa zu werfen und sich vom Fernsehen berieseln zu lassen und dabei vermutlich einzuschlafen, ohne von einem Film etwas mitzubekommen.
Nein, das konnte es nicht gewesen sein.
Es war windig, doch das Wetter war stabil, keine dunkle Wolke am Himmel.
Roberta entschloss sich, sich am See noch ein wenig den Wind um die Ohren wehen zu lassen.
Ihren Gedanken, am Wochenende zu rudern, hatte sie nicht in die Tat umsetzen können, weil anderes zu tun gewesen war.
Vielleicht am nächsten Wochenende, nahm sie sich vor. Aber an einem Spaziergang konnte sie niemand hindern.
Am See angekommen sah sie, dass einige Boote draußen waren, obwohl es schon recht spät war.
Bestimmt waren es auch Leute, die den ganzen Tag über gearbeitet hatten und jetzt einfach dieses Gefühl von Freiheit und frischer Luft genießen wollten.
Ach, die hatten es gut.
Sie lief los, und es wurde ihr überhaupt nicht bewusst, dass sie den Weg Richtung Bootsverleih nahm. Um sich jetzt ein Boot zu leihen, dazu war sie nicht richtig angezogen, und auch zu müde, um sich ins Zeug zu legen. Zum Rudern war es zu windig, aber segeln, ja, das wäre es. Das liebte sie ebenfalls, und früher, als ihre Welt noch in Ordnung gewesen war, hatten ihr Exmann Max und sie viel Zeit auf dem Boot verbracht. Es war anders geworden, als Max lieber links und rechts des Weges Affären mit Frauen, teils sogar Patientinnen, angefangen hatte und als ihm ein Segelboot nicht gut genug gewesen war. Er hatte von einem schnittigen Motorboot mit allem Komfort, mit mehreren Schlafkojen und Kabinen geträumt.
Ach, Max.
Seit sie im Sonnenwinkel lebte, dachte sie kaum noch an ihn. Das war ein anderes Leben gewesen, das sie nicht mehr zurückhaben wollte. Nicht mehr brauchte, weil ihr längst bewusst war, dass sie, ohne eine Gegenleistung zu bekommen, einen sehr hohen Preis bezahlt hatte.
Schnee von gestern, würde ihre Freundin Nicki burschikos sagen.
Nicki und Max waren keine Freunde gewesen. Er hatte nichts von ihr gehalten, weil er sie nicht anbaggern konnte, und Nicki hatte ihn durchschaut und dafür verachtet, weil er auf Kosten ihrer allerbesten Freundin ein richtiges Drohnendasein führte.
Tatsächlich Schnee von gestern …
Roberta hatte überhaupt nicht bemerkt, dass sie den Bootsverleih erreicht hatte.
Kay Holl war damit beschäftigt, ein Segelboot startklar zu machen.
Sie wollte umkehren, doch das vereitelte er, indem er gerade in dem Augenblick aufblickte, als sie diesen Gedanken in die Tat umsetzen wollte.
Sie war nicht mehr gekommen, hatte sich nicht gemeldet, doch er tat so, als sei sie gerade erst gestern da gewesen.
Er richtete sich auf, kam ihr ein paar Schritte entgegen, lachte.
»Hi, schön dich zu sehen«, in Sportlerkreisen duzte man sich einfach, und dagegen hatte Roberta auch nichts einzuwenden. »Lust auf eine Runde auf dem See? Der Wind ist einfach zu gut, ich kann nicht widerstehen.«
Roberta zögerte.
Lust hatte sie eigentlich schon, aber …
Ehe sie über das »aber« nachdenken konnte, fuhr er fort: »Das ist eine Einladung.«
Sie sah an sich herunter.
»Die Schuhe ziehst du aus, und eine Jacke habe ich für dich, draußen kannst du nicht in diesem Blüschen auf dem Boot sitzen.«
Für ihn war alles so einfach, so selbstverständlich. Er hinterfragte nichts, war nicht beleidigt, dass sie, trotz ihres Versprechens, nicht gekommen war. Auf einmal fühlte Roberta sich unternehmungslustig und unglaublich jung.
Sie stimmte in sein Lachen mit ein, und während sie sich bereits die Schuhe auszog, sagte sie: »Ja, eine gute Idee, ich nehme die Einladung dankend an. Es ist gefühlte Ewigkeiten her, seit ich zum letzten Mal in einem Segelboot saß.«
Er grinste. »Das verlernt man auch nicht, und ich denke, dass du gut bist, ich freue mich. Also los.«
Es dauerte nicht mehr lange, bis sie das Boot ins Wasser schieben konnten, und dann ging es los. Er war ein Ass, und sie war auch nicht schlecht. Bei einer Segelregatta hätten sie gute, nein, sehr gute Karten gehabt, den obersten Platz auf dem Siegertreppchen zu erobern.
*
Als sie sich nach diesem unglaublichen Bootstrip ihre Schuhe wieder anzog, ihm seine Jacke zurückgab, fühlte Roberta sich wie an Weihnachten und Ostern zugleich.
Alles war von ihr abgefallen.
Sorgen?
Welche Sorgen denn?
Stress?
Was war das?
Natürlich hatte es Spaß gemacht, auch ihm zu zeigen, dass sie ebenfalls etwas vom Segeln verstand. Der Wind, die frische Brise, das wilde Gekreische der Möwen. Alles war ganz wunderbar gewesen, doch das Unglaublichste war die Gegenwart dieses Mannes gewesen, der ruhig, entspannt, kompetent …
Sie hörte auf, er war nicht zu beschreiben, weil er so anders war.
Jemand wie dieser Kay Holl war ihr noch nie zuvor begegnet.
Sie würde gern mehr über ihn erfahren, doch sie traute sich nicht, Fragen zu stellen, weil sie nicht als neugierig erscheinen wollte, zumal er überhaupt nichts wissen wollte.
Seiner Einladung auf einen Wein widerstand sie. Sie hatte noch nichts gegessen, schon der erste Schluck würde seine Wirkung haben.
Sie lehnte ab, entschuldigte sich damit, nach einem langen Arbeitstag müde zu sein.
Jetzt hätte er einhaken können, das hätte vermutlich jeder andere getan, hätte sich erkundigt, was sie denn so machte.
Von ihm kam keine Frage, er sagte nur: »Schade, dann eben ein andermal. Es war schön mit dir.«
Sie hatte einen Kloß im Hals, nickte, bedankte sich nochmals, dann hastete sie davon.
Kein besonderer Abgang, doch es war nicht nur dass sie hungrig war, es war auch seine Gegenwart, die sie irritierte.
Schade, dass er nicht älter war.
Du liebe Güte, wohin verirrten sich ihre Gedanken?
Kein neuer Mann, keine Probleme!
Dennoch, eines interessierte sie schon … Wer war er?
*
Roberta hatte ihr Haus beinahe erreicht, als mit quietschenden Bremsen ein schnittiger Sportwagen neben ihr hielt, eine junge Frau ausstieg, auf sie zukam.
»Frau Dr. Steinfeld?«
»Ja, ich bin Roberta Steinfeld«, antwortete sie und musterte die Frau. Wer war sie? Sie hatte sie bislang noch nicht gesehen.
»Und ich bin Sandra, eigentlich Alexandra Münster und wohne dort oben.«
Sie zeigte in Richtung Felsenburg, die nicht zu übersehen war, weil diese alte Burgruine die ganze Gegend dominierte.
Roberta wusste sofort Bescheid, denn Enno hatte auch über die Leute von »da oben«, wie er sich ausgedrückt hatte, gesprochen, allerdings nur Gutes.
Dann erzählte sie Roberta, dass sie bereits einige Versuche unternommen hatte, sie einzuladen, aber immer gescheitert war, weil sie nicht daheim gewesen oder die Praxis überfüllt gewesen war.
»Ich bin froh, Sie jetzt zufällig zu treffen, Frau Doktor«, sagte Sandra, »wir möchten Sie nämlich einladen, zu einem kleinen geselligen Beisammensein unter Freunden und guten Bekannten, das allerdings schon am Sonnabend stattfinden soll …, ich weiß, dass man Einladungen nicht so kurzfristig ausspricht, doch, wie gesagt, ich konnte Sie nicht erreichen und wollte Sie auf jeden Fall persönlich einladen.«
Eine reizende Frau, Roberta nahm die Einladung dankend an. Von Enno wusste sie, dass er und seine Frau keine dieser Einladungen ausgelassen hatten.
Es war eine nette Geste, Sie mit einzubeziehen.
Sandra freute sich, doch ihr war anzusehen, dass sie noch etwas auf dem Herzen hatte und dass es ihr ein wenig peinlich war, darüber zu sprechen.
Schließlich fasste sie sich ein Herz.
»Frau Doktor, da gibt es noch etwas, was Sie wissen sollten, ehe es Ihnen von anderer Seite zugetragen wird und Sie es …, nun ja, banal ausgedrückt, in den falschen Hals bekommen.«
Roberta konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.
Von Enno wusste sie, dass die Bewohner vom Erlenhof, dem Herrenhaus, Marianne von Rieding und ihr Mann Carlo Heimberg und die Münsters, die in der Dependance lebten, hochangesehene Leute waren, von denen konnte überhaupt nichts Negatives kommen.
»Und was sollte ich wissen, Frau Münster?«, erkundigte Roberta sich.
»Nun … nun, wir konnten es nicht fassen, wie sehr die Leute hier Sie ignorierten. Von Professor Auerbach wussten wir, welch ein Glück es für uns ist, eine so hochqualifizierte Nachfolgerin für den Doktor Riedel zu bekommen. Und Inge Auerbach hat mir halt erzählt, dass niemand in die Praxis kommt.«
Ehe Roberta ihr erzählen konnte, dass sich das mittlerweile geändert hatte, fuhr Sandra fort: »Ich … wir … hatten die Idee, für Sie so eine Art Willkommensparty auszurichten, damit Sie Menschen kennenlernen, damit man vor allem Sie kennenlernt …, nun, im Grunde genommen ist die Party überflüssig, die Praxis brummt, seit es da diesen Artikel über Sie gab.«
Roberta antwortete nicht sofort, weil sie gerührt war, welche Sorgen man sich ihretwegen gemacht hatte. In der Stadt wäre niemand auf so etwas gekommen.
»Danke, Frau Münster, ich finde das ganz großartig von Ihnen, und ich bin sehr berührt. Nachdem ich das jetzt weiß, komme ich noch viel lieber zu der Party.«
Sandra atmete insgeheim auf.
»Großartig, dann will ich Sie jetzt nicht länger aufhalten. Neunzehn Uhr, ist Ihnen das recht?«
Es war Roberta recht, und nachdem das alles nun geklärt war, stieg Sandra, sehr erleichtert, in ihr Auto und fuhr los, wie immer, viel zu schnell.
Roberta ging langsam und ein wenig nachdenklich auf ihr Haus zu, nun, noch war es nicht ihr Haus, noch hatte sie es von Enno gemietet mit der Option, es kaufen zu können, wenn sie es denn wollte.
Wie rührend …
Sich ihretwegen solche Gedanken zu machen …
Sie freute sich auf den Samstag, und sie fragte sich, ob sich Kay Holl wohl auch unter den Gästen befinden würde.
Kay Holl …
Nun war es aber gut. Sie musste aufhören, an ihn zu denken. So einfach war es nicht. Noch war sie ihm ganz nah, weil der unverhoffte Ausflug auf dem Segelboot, dieses schnittige Dahingleiten so unglaublich schön gewesen war.
*
Werner Auerbach war nach London gereist, um dort bei einer hochkarätigen internationalen Wissenschaftskonferenz nicht nur als Gastredner teilzunehmen, sondern auch als Besucher.
Er hatte sich zum Teil aus dem internationalen Geschäft zurückgezogen, aber es gab dann doch immer wieder etwas, dem er sich nicht entziehen konnte und wo er auch gern dabei war.
Einmal Wissenschaftler, immer Wissenschaftler. Das Interesse hörte mit zunehmendem Alter nicht auf, im Gegenteil, lange Berufserfahrung brachte immer bessere Resultate.
Werner Auerbach war eine Kapazität. Er hatte international gearbeitet, und eigentlich hatte niemand verstanden, warum er sich von jetzt auf gleich aus dem internationalen Geschäft zurückgezogen hatte, um von daheim zu arbeiten und nur hier und da Gastprofessuren anzunehmen, als hochgeschätzter Redner aufzutreten oder sein Know-how in zeitlich bemessene Projekte einzubringen.
Die Fachwelt hatte aufgeschrien, als publik geworden war, wohin Professor Auerbach sich zurückgezogen hatte.
Sonnenwinkel?
Das hatte so überhaupt nichts, war bedeutungslos.
Ja, für die Wissenschaft schon, aber nicht für die Familie. Werner Auerbach hatte im letzten Augenblick die Reißleine gezogen, um wenigstens noch etwas von seinen Kindern mitzubekommen, die er nur am Rande hatte aufwachsen sehen. Dass sie so geworden waren, war einzig und allein seiner Frau Inge zu verdanken, die großartig war und nicht nur ihm den Rücken freigehalten hatte, sondern auch aus den Kindern wunderbare Menschen hatte werden lassen.
Der Sonnenwinkel war schon eine Herausforderung gewesen, und eigentlich auch sehr egoistisch von ihm, denn er hatte mit dem Kauf des Hauses seine Familie überrumpelt.
Jörg hatte es nur am Rande tangiert, denn der hatte mit dem Studium begonnen, lebte in der Stadt.
Ricky, ein Jahr vor dem Abitur, war nur zu besänftigen gewesen mit dem Auto, das sie zum Geburtstag bekommen hatte, und, ja, für sie hatte die Welt auch gleich sofort anders ausgesehen, weil sie sich bereits am ersten Tag in Fabian Rückert verliebt hatte, den allseits bewunderten, gut aussehenden, umschwärmten Lehrer.
Dass aus ihnen letztlich doch ein Paar geworden war, dass sie geheiratet hatten und mit ihren vier Kindern ausgesprochen glücklich waren. Das hatte niemand erwartet, und um diese Beziehung hatte zunächst auch niemand auch nur einen Pfifferling gegeben. Schülerin und Lehrer.
Das war ein heißes Eisen, und es erforderte sehr viel an Disziplin zu wissen, dass man füreinander bestimmt war, es aber nicht zuzulassen, dass daraus etwas wurde, worüber man hämisch reden konnte.
Ricky und Fabian hatten es geschafft, etwas Schönes nicht zum Gesprächsstoff werden zu lassen, und sie hatten sich ihre Gefühle auch erst gestattet zu zeigen, als Ricky mit der Schule fertig gewesen war. Dann allerdings hatten sie nicht mehr lange gewartet, sondern direkt geheiratet.
Professor Auerbach seufzte.
Ja, es war wohl so, dass man alles durchstehen konnte, wenn sich für den richtigen Topf der richtige Deckel fand.
Hannes hatte rebelliert und das in schlechten Schulnoten gezeigt. Doch dann hatte er sich mit dem Sonnenwinkel nicht nur abgefunden, sondern ihn auch so richtig lieb gewonnen, und deswegen hatte er den Schalter umgelegt. Mit seinem Abiturzeugnis hatte er alle anderen, auch seine Geschwister, in den Schatten gestellt, Eins-Komma-Null …, das musste man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt war Hannes irgendwo unterwegs, mit Rucksack und voller Tatendrang. Er würde seinen Weg gehen, und das auf seine Weise. Ein wenig kam er da wohl auf seinen heißgeliebten Opa, den Baron Magnus von Roth, der für Hannes ein leuchtendes Vorbild war, weil Magnus durch Höhen und Tiefen gegangen war ohne daran zu zerbrechen.
Wo andere liegen geblieben wären, war Magnus aufgestanden, hatte sich den Staub von den Sachen geklopft und war weitergegangen, so ganz unter der Devise: »Jetzt erst recht.«
Jetzt war nur noch Bambi im Haus, ihr geliebtes Nesthäkchen, das ihnen so viel Freude bereitete.
Doch auch hier war ein Ende abzusehen.
Bambi würde ebenfalls ihren Weg gehen, da mussten sie sich keine Sorgen machen. Sie war klug, liebenswert. Sie hatte vom ersten Augenblick an ihre Herzen gewonnen, seines, das von Inge und das der Kinder, die ganz vernarrt in Bambi waren.
Bambi …
Seine Gedanken verdunkelten sich, denn da gab es leider ein Problem, das sich nicht mit wissenschaftlichen Formeln und Erkenntnissen abhandeln und lösen ließ.
Es war allerhöchste Zeit!
Sie saßen auf einem Pulverfass, das ihnen jeden Augenblick um die Ohren fliegen konnte.
Doch wie sollten sie ihrem Sonnenschein Bambi, die eigentlich Pamela hieß, klarmachen, dass sie leider keine echte Auerbach war, was sie so selbstverständlich voraussetzte? Der große Professor Auerbach war ratlos, und das war etwas, was man von ihm nicht kannte.
Er begann eine unruhige Wanderung durch sein komfortables Hotelzimmer und ärgerte sich insgeheim darüber, dass er diese Gedanken zugelassen hatte, aus lauter Sentimentalität.
Er trennte sich nicht mehr gern von seinen Lieben, nicht einmal vorübergehend. Und deswegen musste er auch, kaum war er weg, an sie denken, mit ganz viel Liebe in seinem Herzen, aber auch mit sehr viel Dankbarkeit, weil er es so gut getroffen hatte.
Eine traumhafte Frau, fantastische Kinder, keine Sorgen, keine Probleme, das waren keine Selbstverständlichkeiten. Bambi …
Sie musste erfahren, dass sie zwar keine geborene Auerbach war, aber ein Kind ihres Herzens, das sie über alles liebten, das sie glücklich und froh machte. Und dass sie alle es als ein Geschenk des Himmels gesehen hatten, dass sie als Einjährige auf ihren Weg gekommen war. Ja, so ungefähr würde er es ihr beibringen, und das sofort nach seiner Rückkehr.
Sein Telefon klingelte, ihm wurde mitgeteilt, dass man ihn oben in einem der Konferenzsäle des Hotels zu seinem großen Auftritt erwartete.
Als er wenig später zu den Aufzügen lief, die ihn nach oben bringen sollten, war er der hochangesehene Wissenschaftler, der begehrte Redner, der selbst trockene wissenschaftliche Themen wie einen Krimi rüberbringen konnte.
*
Während ihr Werner in London seinen großen Auftritt hatte, hatte Inge Auerbach im verträumten Hohenborn ihren kleinen.
Sie war nach Hohenborn gefahren, um ein paar Einkäufe zu tätigen und hatte alles im Kofferraum ihres Autos verstaut, um jetzt noch ganz gemütlich einen Kaffee zu trinken, als sie Rosmarie Rückert bemerkte.
Rosmarie war nie zu übersehen. Sie war stets perfekt gestylt. Auch wenn Inge so niemals herumlaufen würde, weil es nicht ihr Stil war, musste sie doch zugeben, dass Rosmarie es vortrefflich verstand, sich in Szene zu setzen und dass sie einen guten Geschmack hatte.
Von der Frisur angefangen bis hin zu den Schuhen und der Tasche stimmte bei ihr immer alles, nicht zu vergessen die wirklich erlesenen »Kronjuwelen«, ohne die sie niemals das Haus verlassen würde und von denen sie mehr als genug besaß.
Der Schlager, von Marylin Monroe gesungen und vor vielen Jahren ein Hit: »Diamonds are a girls best friend« hätte von Rosmarie stammen können.
Ginge es darum, das Äußere einer Frau zu beurteilen, bekäme Rosmarie stets den ersten Platz, unangefochten.
Die Tragik war wirklich, dass sie in Hohenborn lebte, nicht in Düsseldorf oder München. In einer Großstadt könnte sie sich ganz anders austoben, in jeder Hinsicht.
Heute trug Rosmarie eine Komposition in Beige, beiges Kostüm, das vorteilhaft ihre tadellose schlanke Figur betonte, beige Schuhe, beige Tasche. Wenig Schmuck, dafür aber, nicht zu übersehen, eine goldene, diamantbesetzte Piagetuhr, die ein kleines Vermögen wert war.
Inge Auerbach blickte unwillkürlich an sich herunter. Auch sie trug beige, eine Leinenhose, ein schlichtes T-Shirt, und an den Füßen trug sie Sandalen, die im ersten Moment ein wenig wie Elbkähne aussahen, breit, schlicht. Die aber so bequem waren, dass Inge sie am liebsten auch nicht ausziehen würde, wenn sie insBett ging. Sie hatte die Sandalen in einem Ökoladen gekauft, und sie waren sehr teuer gewesen, doch es war gut zu wissen, dass sie schadstofffrei waren.
Inge hatte es sich schon sehr früh abgewöhnt, sich durch ihr Äußeres zu definieren. Sie würde sich nicht für alles Geld der Welt in hochhackige, grazil aussehende Schühchen hineinquetschen, nur weil die einen schlanken Fuß machten und die Beine länger erscheinen ließen.
Sie war kein ausgesprochener Öko-Freak, doch es beruhigte sie schon zu wissen, dass für die Kleidung, die sie trug, keine Kinder ausgebeutet wurden oder dass sie voller Pestizide oder anderer Schadstoffe war.
Rosmarie hatte sie entdeckt, also gar keine Chance zur Flucht. Sie kam auf sie zugestöckelt: »Hallo, Inge, das ist aber eine schöne Überraschung. Was treibst du in Hohenborn?«
»Ich war einkaufen, und jetzt möchte ich einen Kaffee trinken. Hast du Lust?«
»Ja, gern, aber nicht in dem schrecklichen Palatini, da ist es mir einfach zu laut. Drüben am Marktplatz wurde ein französisches Bistro eröffnet, ›Chez Gaston‹ – da gibt es einen göttlichen Café au lait. Ich finde, da werden die Italiener mit ihrem Kaffee vollkommen überbewertet. Also, wie gesagt, bei Gaston ist der Milchkaffee einsame Spitze, nicht ganz billig …, du bist selbstverständlich eingeladen.«
Würde Inge Auerbach die Schwiegermutter ihrer Kinder nicht kennen, wüsste sie nicht, wie sie drauf war, müsste sie sich jetzt umdrehen und gehen. Eine Einladung war nett, und es sprach nichts dagegen, sie anzunehmen. Doch dieses »nicht ganz billig« davor war so unnötig wie ein Kropf, besagte es doch, dass sie, Inge, sich das nicht leisten könne.
Klar besaßen die Rückerts sehr viel mehr Geld, und Inge gönnte ihnen jeden Cent davon. Doch arm waren die Auerbachs nicht, und ein Milchkaffee, auch wenn er teuer war, war alle Male drin.
Ach ja, Rosmarie war wie sie war.
»Danke für die Einladung, meine Liebe«, sagte Inge, dann folgte sie Rosmarie und musste insgeheim lächeln. Sie hatten den Marktplatz erreicht, der erst kürzlich mit einem sehr hübschen Kopfsteinpflaster neu gepflastert worden war.
Wie Rosmarie darüber stöckelte, sah nicht unbedingt graziös aus, Inge hatte mit ihren »Elbkähnen« kein Problem, die waren für jeden Bodenbelag geeignet. Man konnte mit ihnen sogar ins Wasser gehen und auch ganz wunderbar durch nassen Sand am Strand laufen.
Inge kannte das »Chez Gaston« noch nicht. Es sah sehr hübsch aus, und von innen war es beeindruckend. Für die Einrichtung wurde sehr viel Geld ausgegeben, da hatte man an nichts gespart. Hoffentlich lohnte sich in dem beschaulichen Hohenborn eine solche Investition.
Es waren nur zwei Tische besetzt, doch als sie hereinkamen, wurden sie wie alte Freunde begrüßt. Rosmarie kannte sich hier aus, und sie genoss es, von Gaston, einem etwas dicklichem kleinen Franzosen, sogar mit Wangenküsschen begrüßt zu werden. Rosmarie brauchte so etwas, und sie genoss es.
Natürlich bekamen sie den besten Tisch zugewiesen und direkt ein Gläschen Champagner angeboten, natürlich auf Kosten des Hauses, was Rosmarie entzückt annahm, Inge ablehnte, auch wenn sie dadurch eine Spielverderberin war. Sie musste noch Auto fahren und war auf ihren Führerschein angewiesen. Außerdem trank sie lieber Wein und hatte dem prickelndem Nass noch nie etwas abgewinnen können, und tagsüber, das ging nur im Urlaub, in einem südlichen Land, bei einem entspannten Essen, zu dem nur Wein passte.
So, jetzt hatte Rosmarie gepunktet, und das genoss sie.
Es war nur schade, dass Inge jetzt nicht begeistert ausrief: »Baooh, wie toll!«
Nun, Rosmarie nahm es ihr nicht übel, sie kannte Inge und wusste, dass die eher bei einem schönem Gemälde, einem interessanten Buch oder einem Hortensienstrauch quietschen würde. Die beiden Frauen stritten selten miteinander und wenn, dann nur kurzzeitig. Im Grunde genommen respektierten sie sich gegenseitig, und das war schon sehr viel. Schließlich waren sie familiär miteinander verbandelt, wenn auch nur angeheiratet.
Rosmarie genoss ihren Champagner, und Inge probierte den Café au lait, der gerade in dunkelbraunen, bauchigen, den typischen Tassen, serviert wurde.
Er war köstlich, und auch wenn das ganze Ambiente nicht so ihr Ding war, würde Inge auf jeden Fall wegen des Kaffees wieder herkommen.
Rosmarie stellte ihr Glas ab, sagte etwas von nicht zu viel versprochen zu haben, dann kam sie auf das, was sie wirklich interessierte.
»Hast du mit Stella gesprochen?«, wollte sie wissen.
Inge verstand zunächst diese Frage nicht ganz, weil sie oft mit ihrer Schwiegertochter telefonierte. Sie verstanden sich prächtig miteinander, und Inge dankte dem Himmel ständig, dass er ihr eine solche Schwiegertochter beschert hatte.
»Ja.«
»Sie war bei uns, hat sie darüber geredet?«
Wieder kam nur ein einsilbiges: »Ja.«
»Was hat sie gesagt?«, kam die nächste Frage.
Das kannte Inge, Rosmarie liebte diese Art von Verhören, anders konnte man das nicht nennen, und sie war ziemlich schmerzfrei und dachte nicht einen Moment daran, dass sie mit solchen Fragen Persönlichkeitsrechte verletzte.
»Du, nicht viel. Sie hat gesagt, dass sie eine Käsetorte gebacken hat und Fabian zufällig vorbeikam.«
»Und deswegen hat sie angerufen?«
»Nein, Rosmarie, deswegen nicht, das hat sie nur so ganz nebenbei erwähnt. Sie rief an, weil sie wissen wollte, wo ich den Stift gekauft habe, den Jörg von mir zum Geburtstag bekommen hat. Er hat ihn entweder verloren, oder man hat ihn gestohlen. Auf jeden Fall ist er untröstlich, und deswegen möchte Stella ihm einen neuen Stift schenken.«
»Nun ja, Geld genug hat sie jetzt ja, um großzügig sein zu können«, bemerkte Rosmarie.
Manchmal könnte Inge die andere wirklich schütteln.
»Rosmarie, der Stift hat zwanzig Euro gekostet, es ist also keine Investition, über die es sich zu reden lohnt. Und wenn du jetzt gleich sagst, dass zwanzig Euro für ein Geburtstagsgeschenk ziemlich dürftig sind, dann antworte ich. Finde ich nicht. Es kommt nicht auf Quantität an. Einen solchen Stift wünschte Jörg sich schon lange, mit dieser ganz besonderen Mine, und ich war froh, ihm diesen Wunsch erfüllen zu können. Wir haben lange schon aufgehört, uns großartige Geschenke zu machen, kleine Aufmerksamkeiten sind bei den Erwachsenen angesagt, Geschenke, an denen der Beschenkte erkennt, dass man sich seinetwegen Gedanken gemacht hat. Bei den Kindern ist es anders, die können Wünsche äußern und bekommen sie erfüllt, wenn sie nicht ausufern.«
Das war als kleiner Seitenhieb gedacht, denn die Rückerts beschenkten ihre Enkel in einer Weise, die nicht einmal die Queen Elizabeth für ihre Enkel angebracht hielte. Die war in dieser Hinsicht sehr sparsam, um nicht zu sagen, geizig.
Inge brauchte nicht die Queen als Maßstab oder Vorbild.
Sie schenkte gern, doch es musste im Rahmen bleiben.
Im Grunde genommen war alles gesagt worden, allerdings nicht für Rosmarie Rückert. Das lag teilweise ganz gewiss daran, dass sie es nicht zugeben würde, insgeheim jedoch ahnte, dass sie sich ihren Kindern gegenüber nicht so verhielt, wie sich eine Mutter verhalten sollte.
»Noch mal, Inge, sonst hat Stella nichts gesagt?«, wollte sie wissen.
»Nein, Rosmarie, sonst hat sie nichts gesagt. Eigentlich müsstest du deine Tochter so gut kennen, um zu wissen, dass sie keine Plaudertasche ist, dass sie nicht über andere Leute spricht, auch nicht über ihre Mutter. Und außerdem – warum sollte sie es gerade mir gegenüber tun?«
»Weil du und sie …«
Rosmarie Rückert brach ihren Satz ab.
Nein, das wollte sie nun wirklich nicht sagen, das würde ja so etwas wie das Zugeben einer Schwäche bedeuten.
Inge Auerbach mischte sich grundsätzlich nicht in die Angelegenheiten anderer Menschen ein, auch nicht in die ihrer Kinder und nicht in die der angeheirateten Familie. Doch jetzt glaubte sie, etwas sagen zu müssen, sagen zu dürfen.
»Rosmarie, es geht mich nichts an, und du musst wissen, was du tust. Ich finde, und das ist allein meine subjektive Meinung, du solltest dein Verhalten deinen Kindern gegenüber verändern, du solltest ein wenig herzlicher sein und sie, ganz besonders Stella, nicht immerfort kritisieren, und wenn du dich dann …«
Inge konnte ihren Satz nicht beenden. Sie wurde abrupt von Rosmarie unterbrochen.
»Also hat sie doch über mich gelästert«, sagte sie, »sonst kämst du jetzt nicht damit.«
Es hatte keinen Sinn, warum hatte sie denn nicht einfach den Mund gehalten? Rosmarie würde es nie begreifen.
»Hat sie nicht. Es ist nur so, dass ich zwei Augen im Kopf habe und nicht blöd bin. Ich bekomme seit Jahren mit, wie es zwischen Heinz, dir und euren Kindern abläuft. Da fehlen Liebe und Vertrauen, zwei wichtige Bausteine für ein gutes Miteinander.«
Rosmarie schnappte nach Luft, Gaston gesellte sich zu ihnen, um sich zu erkundigen, ob bei den Damen alles in Ordnung sei.
Auf Small Talk hatte Inge keine Lust, und eine Fortsetzung des Gesprächs würde nichts bringen, weil Rosmarie jetzt schon blockierte.
Sollte sie sich von diesem Franzosen mit Komplimenten überschütten lassen, ob nun ernst gemeint oder nicht. Das war Inge so ziemlich egal.
Sie blickte auf ihre Uhr, stieß ein beinahe bühnenreifes: »Oh, schon so spät«, hervor, dann verabschiedete sie sich, wollte, obwohl sie eingeladen war, ihren Milchkaffee bezahlen. Doch Rosmarie wollte nun mal die Großzügige spielen und bestand darauf, die Zeche zu begleichen.
Sie wollte noch bleiben, also verabschiedete Inge sich, und als sie hinausging, sagte sie sich, dass sie sich das alles hätte ersparen können.
Rosmarie, auch ihr Heinz, hatten auch gute Seiten, und wenn man sie so nahm, wie sie waren, kam man mit ihnen auch gut zurecht. Und wenn sie gut drauf waren, da konnte man sogar ganz herzhaft mit ihnen lachen.
Die Rückerts, die waren halt anders, doch es hätte sie mit angeheirateten Familienmitgliedern schlimmer treffen können. Stella und Fabian waren ganz wunderbar, und wenn, dann waren die beiden zu bedauern, Eltern zu haben, die so wenig Liebe zeigen konnten. Eltern, für die ihre beiden Kinder allenfalls Prestigeobjekte gewesen waren.
So, und das war es dann auch.
Inge Auerbach war fest entschlossen, sich darum keine Gedanken zu machen.
Sie sollte wohl besser erst einmal vor ihrer eigenen Haustür kehren. Sie war zwar eine verständnisvolle, liebevolle Mutter, aber was da mit Bambi geschehen war, wie sie bislang mit der Adoption umgegangen waren …, darüber wollte sie jetzt nicht nachdenken.
Rosmarie hätte nicht lange gefackelt, sondern Bambi, ohne Rücksicht auf Gefühle, schon längst die Wahrheit gesagt.
Inge hatte ihr Auto erreicht, stieg hinein und fuhr nach Hause.
Ja, nach Hause, denn der Sonnenwinkel war längst die Heimat ihres Herzens geworden, und sie konnte sich nicht vorstellen, da noch einmal wegzuziehen.
Doch das Leben hatte sie gelehrt, nie nie zu sagen.
Inge machte das Autoradio an und sang den banalen Schlager, der gerade gespielt wurde, laut mit.
Der Text war einfach und wiederholte sich immer wieder. Glück … Herz … Schmerz …
Beinahe wie im wahren Leben.
Unterwegs hielt sie noch einmal an, um eine Nachbarin aufzupicken, die auf den Bus wartete.
Hilfsbereit war man im Sonnenwinkel ebenfalls.
Frau Schnitzler war in das Haus ihres Sohnes eingezogen, nicht unbedingt zur Freude ihrer Schwiegertochter.
Und nun musste sich die arme Inge in epischer Breite anhören, welche Grabenkämpfe es zwischen den beiden Frauen gab.
Dass Gutmütigkeit manchmal auch Dummheit sein konnte, das bestätigte sich gerade jetzt.
Aber zum Glück war es nicht mehr weit. Die Schnitzlers wohnten am Anfang der Siedlung, und die alte Dame verdrehte da wohl ein wenig die Tatsachen. Die Schwiegertochter stand am Gartentor und war ganz erleichtert, als sie ihre Schwiegermutter aus Inges Wagen steigen sah.
»Da bist du ja, Mama. Du darfst nicht einfach, ohne etwas zu sagen, weglaufen. Ich habe dich bereits überall gesucht und mir große Sorgen gemacht.«
Sie bedankte sich bei Inge, dann legte sie liebevoll, wie Inge fand, einen Arm um die schmale Schulter ihrer Schwiegermutter und führte sie behutsam ins Haus.
Jede Medaille hatte zwei Seiten …
Das würde Inge Auerbach jetzt glatt unterschreiben.
*
Inge Auerbach und Bambi arbeiteten im Garten. Sie hatten sich endlich aufgerafft, sich des Unkrauts anzunehmen.
Jonny, der sonst dabei war, um hinter Schmetterlingen und Insekten herzujagen, lag auf seinem Kissen auf der Terrasse.
Er war nicht gut drauf.
Das machte Inge Sorgen, Bambi sah es auch, doch sie ignorierte das einfach.
Sie kamen ganz gut voran. Beide arbeiteten gern im Garten und beide hatten auch den grünen Daumen.
Bambi hielt inne, blies sich eine vorwitzige Locke aus dem Gesicht, die ihre Sicht beeinträchtigte. Dann wandte sie sich an ihre Mutter.
»Mami, darf ich dich mal was fragen?«
Auch Inge hörte auf, das Unkraut zu zupfen.
»Aber ja, mein Kind«, sagte sie, »frag, was du willst.«
Bambi nickte.
»Mami, ist was nicht in Ordnung?«
Inge lachte.
»Aber Kind, was sollte nicht in Ordnung sein? Wie kommst du darauf?«
Bambi pustete erneut, dann griff sie entschlossen nach der Locke und steckte sie sich hinters Ohr. Dass die dunkle Erde Spuren auf ihrem Gesicht hinterlassen hatte, merkte sie nicht. Es hätte sie auch nicht gestört, wozu gab es Wasser und Seife.
»Nun ja, der Papi und du …, ihr seid verändert …, ihr seid seit einiger Zeit anders geworden. Liegt es an mir? Mache ich etwas falsch? Nerve ich euch? Vielleicht nutze ich es manchmal zu sehr aus, jetzt die Einzige hier zu sein. Aber, Mami, das möchte ich nicht, wenn es an mir liegen sollte, dann sagt es mir. Ich habe euch viel zu lieb und kann es nicht haben, euch traurig zu sehen.«
Schon bei Bambis ersten Worten war Inge die Harke aus der Hand gefallen.
War es so offensichtlich?
War das jetzt der Zeitpunkt, ihr die Wahrheit zu sagen?
Aber nein, das ging nicht. Es war zu wichtig, um es im Alleingang zu erledigen.
Klar, Bambi war ein hochsensibles Mädchen, das sich, obwohl noch so jung, in jeden Menschen hineinfühlen konnte. Und sie besaß hochfeine Antennen, um spüren zu können, wenn etwas nicht rund lief.
Werner und sie hatten sich in ihrer Nähe zusammengerissen, nicht über die Adoption gesprochen und sich verhalten wie immer.
Es war wohl nicht so gewesen, und Bambi hatte das gespürt. Wie sollte sie sich jetzt verhalten?
Lügen?
Ihre Gedanken überschlugen sich.
Und dann …
Welch ein Glück, der Himmel war auf ihrer Seite, Manuel Münster kam um die Ecke gebogen.
»Hier seid ihr, da kann ich mir ja die Finger wundklingeln. Bambi, hast du Lust auf eine Radtour? Heute kommen doch ganz bei uns in der Nähe die Radprofis vorbei. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir sie noch mit und können sie bejubeln. Manni Busch ist auch dabei, und der hat alle Chancen, die Tour de France zu gewinnen, wenn er weiterhin so in Topform bleibt.«
Es klang verlockend.
Bambi warf ihrer Mutter einen Blick zu.
»Geh schon, mein Kind«, sagte Inge, »den Rest schaffe ich allein, und wenn nicht, dann können wir morgen weitermachen. Das Unkraut läuft uns leider nicht davon. Ich denke, die Radtour ist eine gute Idee. Da bekommst du deine verqueren Gedanken aus dem Kopf. Du machst keine Probleme, mein Kind, hast niemals welche gemacht. Du bist die Tochter, von der alle Eltern träumen.«
Das war nicht gelogen.
Bambi kam um das Beet herumgelaufen, umarmte ihre Mutter stürmisch, drückte ihr einen schmatzenden Kuss auf die Stirn.
»Mami, das kann ich voll zurückgeben, bessere Eltern als Papi und dich gibt es nicht auf der ganzen Welt. Ich bin ein Glückspilz, eine Auerbach zu sein.«
Alles war wunderbar gewesen, warum hatte sie den letzten Satz ausgesprochen? Natürlich war sie eine Auerbach, sie war gleichgestellt mit Ricky, Jörg und Hannes, in allem. Aber sie war es nicht von vornherein gewesen. Doch genau davon war sie überzeugt.
Manuel drängte zur Eile, er wollte die Rennfahrer nicht verpassen, und Bambi musste sich ja noch wenigstens die Hände und das Gesicht waschen.
»Hol bitte schon mal mein Fahrrad aus der Garage, Manuel«, rief sie, »ich komme dann vorne heraus.«
Sie winkte ihrer Mutter zu.
»Ich hab dich lieb, beste Mami von der Welt«, nach diesen Worten stürmte sie ins Haus, und Inge sah ihr betroffen hinterher.
Das war wieder ein Zeichen dafür gewesen, dass es an der Zeit war, endlich mit der Wahrheit herauszurücken.
Inge spürte den dumpfen Schlag ihres Herzens, der sich mit ihrer Angst vermischte.
Es lag etwas in der Luft, das spürte sie genau. Warum unternahm sie nichts?
Sie würde mit Werner reden, sofort nach seiner Rückkehr aus England.
Doch jetzt …
Jetzt konnte sie hier nicht weiter herumzupfen. Unkraut jäten war eine so undankbare Aufgabe. Man quälte sich, freute sich, und kaum hatte man den Rücken gekehrt, begann es wieder zu wuchern.
Inge konnte jetzt auf keinen Fall allein bleiben. Sie brauchte Gesellschaft. Und welch ein Glück, dass sie, um die zu bekommen, nicht weit gehen musste. Nur nach nebenan zu ihren Eltern.
Sie hierher zu holen war die beste Entscheidung überhaupt gewesen. Inge und ihre Eltern waren ganz eng miteinander, aber auch Werner verstand sich mit seinen Schwiegereltern prächtig, und die Enkel und Urenkel beteten Omi und Opi an.
Bei ihren Eltern konnte Inge abschalten, und sie würde, weiß Gott, mit keiner Silbe diese leidige Adoptionsgeschichte erwähnen, sondern sie würden über Gott und die Welt plaudern, an Themen mangelte es ihnen nicht, und das waren in erster Linie welche, die nichts mit dem Sonnenwinkel und seinen Bewohnern zu tun hatten.
Inge rief nach Jonny, doch der blinzelte sie nur träge an und rührte sich nicht von seinem Platz. Das gefiel ihr überhaupt nicht. Jonny schwächelte, was bei seinem hohen Alter kein Wunder war.
Inge ging ins Haus, ehe sie im Badezimmer verschwand, hörte sie Bambi und Manuel unbeschwert lachen.
Ach ja, jung müsste man sein. Wenn man jung war, da klebten die Probleme nicht an einem fest. Da vergaß man sie so rasch wie sie einem in den Sinn gekommen waren. Beklagen musste sie sich eigentlich auch nicht, wenn da bloß nicht das mit der Adoption wäre …
*
Monika Lingen schlenderte langsam, mit einem Buch unter dem Arm, durch den zum Sanatorium gehörendem großen, gepflegten Park.
Sie hatte ein Ziel, den ein wenig verwunschenen Seerosenteich, der sich am Rande des Parks befand.
Sie hatte den Teich direkt am ersten Tag entdeckt und ihn zu ihrem Lieblingsplatz auserkoren. Sie konnte überhaupt nicht verstehen, warum die anderen Leute, die hier auch eine Reha machten, so gut wie nie an den Teich kamen. Hier standen, wie im Park, Bänke.
Nun, ihr sollte es recht sein.
Monika genoss die Stille und die Atmosphäre, die zum träumen verleitete.
Es war etwas geschehen. Sie hatte sich verändert, genoss den Tag, konnte sich über Gänseblümchen freuen, die sie viele Jahre lang überhaupt nicht wahrgenommen hatte, oder das Gezwitscher der Vögel. Sie hatte nicht nur einen, sondern viele Gänge heruntergeschaltet und genoss dieses entschleunigte Leben.
Sie fühlte sich wohl, machte gute Fortschritte, und es war auf jeden Fall richtig gewesen, hierher und nicht anderswohin zu gehen. Sie konnte dem Professor aus der Klinik gar nicht genug danken.
Die ärztliche Betreuung war hervorragend, die Therapeuten waren nett und kompetent. Und auch über das Essen, über das sie als Spitzenköchin hätte meckern können, war nichts Negatives zu sagen.
Monika hatte ihren Lieblingsplatz erreicht. Eine Bank, die still vor sich hinrostete.
Sie setzte sich und genoss erst einmal die ganze Szenerie, von der sie nicht genug bekommen konnte. Es war schon unglaublich. Sie kam jeden Tag hierher und entdeckte dennoch immer etwas Neues.
Heute allerdings war sie nicht so aufmerksam, weil ihr viele Gedanken durch den Kopf gingen, die mit ihrem Leben, mit ihrem Mann, ihrem Job zu tun hatten.
Ihre Zeit hier war begrenzt.
Wie würde es weitergehen?
Der »Seeblick« war so weit weg. Wenn sie ehrlich war, würde sie ihn am liebsten vergessen, aus ihrem Gedächtnis streichen.
Sie war müde geworden, und es graute ihr vor dem, was auf sie zukommen würde. Wäre sie allein, wüsste sie, was zu tun wäre.
Doch da gab es Hubert, ihren Mann, den sie noch immer liebte, obwohl sie sich in den letzten Jahren ein wenig aus den Augen verloren hatten. Sie hatten nicht miteinander, sondern nebeneinander gelebt, hatten funktioniert. Die Liebe war ihnen zum Glück nicht abhanden gekommen, aber sie war unter einem Alltagsberg verschüttet gewesen, und für Zärtlichkeit, für ein Miteinander …, da hatte die Zeit gefehlt, da waren sie zu müde gewesen.
Weil sie hier auch so viel Zeit zum nachdenken hatte, war ihr eines klar geworden. Sie liebte Hubert, nicht mehr mit der Begehrlichkeit von früher, nicht mehr mit der Leidenschaft, sondern anders. Sie konnte sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen.
Doch wenn sie nach Hause kam, würde sie der Alltag nicht wieder einholen und verschlingen?
Nun, so wie vor ihrem Herzinfarkt konnte sie nicht mehr funktionieren, das hatten ihr die Ärzte klargemacht, und das wollte sie auch nicht.
Warum brauchte es eigentlich immer einen Paukenschlag, ehe man zur Besinnung kam?
Obwohl es ein warmer, sonniger Tag war, fröstelte Monika. Ohne Frau Dr. Steinfeld wäre sie jetzt tot!
Nein, sie wollte sich das nicht vorstellen, wollte nicht mehr dran denken. Es war, zum Glück, noch mal gut gegangen!
Es wäre schön, Hubert könnte jetzt bei ihr sein, um mit ihr das alles zu genießen. Sie sehnte sich nach ihm, und auf jeden Fall würde sie ihn gleich anrufen. Schade, dass sie ihr Handy in ihrem Zimmer gelassen hatte.
Schritte näherten sich.
Schade!
Nun, sie hatte kein Alleinrecht auf den Teich und konnte nur hoffen, derjenige oder diejenige würden sich eine andere Bank suchen und sich nicht neben sie setzen, um zu plaudern.
Das war eine Unsitte, deswegen mied Monika auch die Parkbänke. Die meisten Mitpatienten waren ziemlich schmerzfrei, setzten sich einfach dazu und fingen, ob man nun las oder nicht, das Plaudern an.
Die Schritte, recht energische Schritte, näherten sich »ihrer« Bank.
Nun gut, sie war nicht dazu aufgelegt, jetzt mit jemandem zu sprechen, dann würde sie eben gehen und später noch mal zurückkommen oder morgen.
Sie stand auf, drehte sich um und erstarrte.
Das konnte jetzt nicht wahr sein!
Es war nicht irgendwer gekommen, sondern … Hubert, ihr Ehemann.
Gut sah er aus!
Er wirkte frisch und dynamisch, und er hatte etliche Kilo abgenommen.
Das war ja das Gemeine, Frauen hungerten sich ihre Pfunde grammweise herunter, und bei Männern purzelten sie sofort kiloweise.
Nachdem Monika sich von ihrer ersten Überraschung erholt hatte, stürzte sie sich in die Arme ihres Mannes.
»Hubsi …«, sie gebrauchte das Kosewort aus alten Zeiten, »das ist eine Überraschung, eine ganz wunderbare sogar. Woher wusstest du, wie sehr ich dich vermisste?«
Seine Arme umschlossen sie, sie fühlte sich unglaublich geborgen, und ehe er ihr diese Frage beantworten konnte, tat er etwas anderes, was im Augenblick wichtiger war.
Hubert Lingen küsste seine Monika. Zuerst ein wenig zögerlich, dann aber voller Verlangen. Es war wie früher, als sie zu zweit, gegen den Rest der Welt, überall und nirgends gewesen waren.
Wie schön!
Die Welt stand still!
Und sie waren sich so unglaublich nahe.
Auf einmal war sie wieder da, diese Vertrautheit, aber auch die Aufgeregtheit, die man hat, wenn man frisch verliebt ist.
Es fühlte sich so an, und während sie sich auf die Bank setzten, kam Monika eine Gedichtzeile von »Stufen« von Hermann Hesse in den Sinn.
»Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …«
Ein Anfang für sie und Hubert!
Im »Seeblick«?
Es war nicht vorstellbar, der Alltag würde sie einholen, das war unvermeidbar.
Aber nein!
Jetzt wollte sie nicht daran denken, sondern die Nähe ihres Mannes genießen, der wirklich unglaublich gut aussah. Sie sagte es ihm, und das konnte er nur zurückgeben.
»Kein Wunder, mein Lieber, ich kann hier entspannt und vollkommen entschleunigt das Leben genießen. Es ist wunderbar, und ich mag nicht daran denken, was sein wird, wenn …«
Er hinderte sie am Weitersprechen, indem er ihr einfach einen Finger auf die Lippen legte.
»Moni, wir haben jetzt die Chance, einen Neuanfang zu wagen, und deswegen bin ich hier.« Er warf ihr einen zärtlichen Blick zu. »In erster Linie allerdings, weil ich eine unbändige Sehnsucht nach dir hatte.«
Sie lehnte sich an ihn, er hatte beschützend einen Arm um ihre Schulter gelegt.
Sie schwiegen eine Weile, genossen ihre Zweisamkeit, die auch ohne Worte schön sein konnte, weil sie plötzlich wieder die Sprache ihrer Herzen verstanden.
Nach einer Weile räusperte er sich.
»Ich habe, eigentlich nur, um den Marktwert abzuschätzen, unseren ›Seeblick‹ auf eine Immobilienseite ins Internet gesetzt, und du glaubst es nicht, innerhalb weniger Stunden gab es mehrere Anfragen. Ein Interessent hat sich sofort in sein Auto gesetzt, ist losgefahren. Er ist ganz heiß auf unseren ›Seeblick‹ – würde ihn sofort übernehmen, und er ist mit dem Kaufpreis einverstanden, hat nicht versucht, auch nur einen Euro herunterzuhandeln. Ich hätte am liebsten sofort zugesagt, ein solches Geschäft macht man so schnell nicht wieder, es ist wie ein Lotteriegewinn. Aber ich weiß ja, wie sehr du am ›Seeblick‹ hängst.«
Sie starrte ihn an.
»Hubsi, das stimmt nicht. Wie kommst du denn darauf? Ich hätte nur deinetwegen daran festgehalten, weil ich umgekehrt der Meinung war, du könntest das im Sonnenwinkel nicht loslassen.«
Nach der ersten Überraschung mussten beide lachen, und danach gab es eine ganze Menge zu besprechen.
Unglaublich, wie sie beide aneinander vorbeigedacht hatten, aber andererseits rührend, weil sich quasi der eine für den anderen geopfert hätte. Das war Liebe.
»Das heißt, ich kann dem Interessenten eine Zusage machen?«, erkundigte Hubert Lingen sich schließlich. Ganz sicher konnte er es immer noch nicht glauben, deswegen fügte er hinzu: »Ganz sicher?«
Monika nickte.
»Ganz sicher«, bestätigte sie mit fester Stimme. »Es hat alles seine Zeit. In der Weise, wie wir in all den Jahren unsere Gastwirtschaft geführt haben …, das geht nicht mehr, und das will ich auch nicht mehr. Die Krankheit hat bei mir etwas verändert. Mir wurde ganz deutlich bewusst, dass das Leben endlich ist und dass niemand weiß, wann es zu Ende ist. Man kann sich kein Ticket kaufen, das einem eine störungsfreie Reise bis meinetwegen neunzig Jahre oder mehr garantiert. Das Leben ist schön, es ist kostbar. Erinnerst du dich an unsere To-Do-Liste, die wir mal gemacht haben. Und erinnerst du dich auch daran, was da ganz weit oben stand?«
Er lächelte, strich ihr zärtlich über das Haar, und seine Antwort kam prompt. »Und ob ich das weiß. Unser Traum war es, den Jakobsweg zu laufen, beginnend in Frankreich, endend in Santiago de Compostela.« Seine Stimme wurde ganz sehnsuchtsvoll. »Ja, das wäre es gewesen. Doch das haben wir leider verpasst.«
Monika widersprach ihrem Mann sofort.
»Oh nein, das stimmt nicht. Man soll nie nie sagen, es kann noch immer so sein. Liebster, lass es uns tun. Nun haben wir die Chance.«
Als er Zweifel wegen ihres angegriffenen Gesundheitszustandes anmeldete, schüttelte sie entschieden den Kopf.
»Das ist überhaupt kein Problem. Außerdem können wir es ganz entspannt angehen. Uns jagt niemand. Leider ist es Kult geworden, da mitreden zu können und den Jakobsweg zu gehen. Und dabei wird herumgetrickst, werden große Strecken im Taxi oder auf andere eigentlich nicht vorgesehene Weise zurückgelegt. In diesen Topf möchte ich nicht geworfen werden. Ich möchte den Jakobsweg gehen wie wir es uns vorgestellt haben und wie er auch gedacht ist, nicht, um einen Rekord aufzustellen, nicht, um einen Preis zu gewinnen für ein schnelles Durchjagen. Sinn ist, ihn bewusst zu gehen, und das ist so etwas wie Meditation. Sinn ist, sich zu finden und seinen Weg.«
Sie blickte ihn mit blitzenden Augen an.
»Der Gedanke fasziniert mich immer mehr. Wenn wir alles verkaufen, sind wir frei. Wir zwei sind, weil wir uns dem Alltag so vollkommen ausgeliefert haben, von unserem eigentlichen Weg abgekommen. Wir haben uns verloren … Hubsi, das darf uns nicht noch einmal passieren. Das Leben ist schön, und am allerschönsten ist es, wenn du bei mir bist.«
Er verstärkte den Druck seiner Arme, und sie schmiegte sich noch enger an ihn. Und dann küssten sich erst einmal, und das war beinahe so wie früher, mit aller Aufgeregtheit und mit Herzklopfen.
Die Frösche quakten, ein Reiher flog über den Teich, in Erwartung reicher Beute.
Sie bekamen es nicht mit. Beinahe staunend wie zwei Kinder entdeckten sie einander erneut, und das war schön. Nein, es war wunderschön.
*
Hubert Lingen hatte sich entschlossen, über Nacht zu bleiben. Zum Glück war man in dieser Reha-Klinik flexibel genug, das Zimmer seiner Frau so herzurichten, dass er mit darin schlafen konnte.
Monika war überglücklich, und sie war ganz stolz, an seiner Seite in das Restaurant zu gehen. Ja, man legte hier Wert darauf, über ein Restaurant zu sprechen, nicht über einen »Speisesaal«.
Sie merkte schon, dass Hubert manch interessierter Blick traf. Nicht nur das, eine Dame, die bekannt dafür war, jeden Mann anzumachen, kam sofort auf sie zugeschossen, anders konnte man es nicht nennen.
Sie war nicht hier, um ihren Gesundheitszustand wiederherstellen zu lassen, sondern in erster Linie um Spaß zu haben, sich den sprichwörtlichen »Kurschatten« zu suchen oder besser noch, den Mann fürs Leben.
Monika mochte diese Frau nicht, und bislang hatten sie kaum miteinander gesprochen, deswegen war es schon ziemlich dreist, dass sie jetzt vor ihnen stand.
»Wie ich sehe, haben wir hier ein neues Gesicht«, gurrte sie und blickte Hubert tief in die Augen. »Alles ziemlich langweilig und öde, man muss von sich aus etwas tun, um Spaß zu haben …, ich bin übrigens Helga Busch.«
Monika schnappte nach Luft, hatte eine heftige Erwiderung auf den Lippen. Doch sie musste nichts sagen. Ihr Hubert meisterte die Situation.
Er schenkte dieser Frau sein schönstes Lächeln, ehe er sagte: »Ach, wissen Sie, ich besuche hier meine Frau, die ich über alles liebe. Wir haben Spaß miteinander, und wir langweilen uns ganz gewiss nicht.«
Nach diesen Worten zog er Monika mit sich fort, die gerade noch mitbekam, wie Helga Busch nach Luft schnappte wie ein Fisch, der an Land geraten war.
Ihr Hubsi …
Wer hätte das gedacht. Sie entdeckte ihn neu, und sie liebte ihn von Stunde zu Stunde mehr.
Man konnte nicht sagen, dass ein Herzinfarkt, der einen beinahe das Leben gekostet hätte, etwas Gutes hatte. Man konnte ihn erleiden und hinterher in ein tiefes Loch fallen. Bei ihr hatte er einen Umschwung in die richtige Richtung gegeben, und dafür musste sie dankbar sein.
Sie hakte sich bei ihm ein.
»Hubsi, wenn Blicke töten könnten, dann wären wir jetzt tot«, sagte sie, »aber ich kann verstehen, dass sie heiß auf dich ist. Du bist halt ein irrer Typ …, du bist es wieder geworden.«
Er blickte sie liebevoll an.
»Und du bist eine Traumfrau, warst es die ganze Zeit über, doch ich war streckenweise blind und habe es nicht mehr gesehen. Ach, Moni, du glaubst nicht, wie glücklich ich bin und wie sehr ich dem Schicksal danke, dass wir noch eine Chance bekommen haben. Jetzt müssen wir behutsam mit uns umgehen, ein zweites Mal dürfen wir es nicht vermasseln.«
Am liebsten hätte sie sich jetzt in seine Arme geschmissen, ihn geküsst. Doch das ging nicht. Man blickte schon jetzt neugierig zu ihnen.
»Das werden wir nicht, mein liebster Hubsi, ganz gewiss nicht.«
Sie hatten ihren Tisch erreicht, in einer schmalen Vase stand auf dem Tisch eine rote Rose. Sie musste ihn nicht fragen. Sie wusste, dass er es arrangiert hatte.
Diese rote Rose besagte alles, dennoch freute es sie, dass er es auch noch mit Worten ausdrückte: »Moni, ich liebe dich. Du bist die Frau meines Lebens.«
Das Glück machte sie stumm, doch ihre Blicke, die sanfte Geste, mit der sie seine Hand berührte, sagten alles.
Die Bedienung trat an ihren Tisch, erkundigte sich, welches der drei angebotenen Gerichte sie gewählt hatten.
Der Alltag hatte sie wieder.
Monika entschied sich für die vegetarische Lasagne, sie würde eh nicht viel essen können.
Hubert wählte die Putenschnitzelchen mit mediterranem Gemüse und Rosmarinkartoffeln.
Ein Glas Wein dazu wäre schön, doch das gab es hier nicht. Es wurde kein Alkohol ausgeschenkt, und deswegen wählte Monika eine Apfelschorle, und er entschied sich für Mineralwasser.
Essen, Trinken, das war derzeit wirklich nebensächlich. Es zählte, dass sie zusammen waren, und noch mehr zählte, dass sie ihre Liebe nicht verloren hatten.
Sie sprachen nicht viel, waren mit ihren Blicken, mit kleinen zärtlichen Gesten ineinander versunken.
Aus dieser Versunkenheit wurden sie gerissen, als ein gemischter Salat und eine Spargelcremesuppe serviert wurden. Das gehörte zum Menü.
Die Suppe schmeckte nicht schlecht, vielleicht ein wenig fad. Darüber durfte man sich allerdings in einem Sanatorium nicht beklagen.
Hubsi und sie …, der Jakobsweg …, ein neuer gemeinsamer Weg … Es nahm ihr beinahe den Atem, und ihm schien es nicht anders zu gehen.
*
Das Leben ging weiter.
Monika Lingens Tage im Sanatorium waren gezählt, eine weitere Kurverlängerung würde es nicht geben.
Und Hubert Lingen war wieder im Sonnenwinkel. Es gab vieles zu tun, vieles zu regeln.
Für Roberta war er zu einem Vorzeigepatienten geworden. Sie konnte es eigentlich noch immer nicht so recht fassen, wie sehr sich dieser träge, missmutige Mann in kürzester Zeit verändert hatte.
Er war gut drauf, und er freute sich über die guten Ergebnisse bei den regelmäßigen Routineuntersuchungen.
Auch heute war er in der Praxis, und Roberta wunderte sich über den prachtvollen, exquisiten Blumenstrauß, den er ihr überreichte.
»Ich habe keinen Geburtstag, Herr Lingen«, sagte sie, nachdem sie sich bedankt hatte.
Er lachte.
»Frau Doktor, man muss keinen Anlass haben, um Blumen zu verschenken. Es ist mir ein Bedürfnis, und außerdem will meine Monika es auch so. Ach, Frau Doktor, warum sind Sie nicht schon ein paar Jahre früher in den Sonnenwinkel gekommen?«
»Weil Herr Doktor Riedel hier einen ausgezeichneten Job gemacht hat«, glaubte Roberta, ihren Vorgänger in Schutz nehmen zu müssen.
Das bestätigte Hubert Lingen auch sofort.
»Aber Sie sind anders. Sie sehen in erster Linie nicht den Patienten, sondern Sie sehen den Menschen, und Sie machen sich Gedanken, tun Dinge, für die Sie keine Krankenkasse bezahlt. Und Sie sind eine ganz hervorragende Diagnostikerin. Welch ein Glück, dass Sie im Seeblick waren, als das mit Moni passierte. Im Krankenhaus, aber auch in der Reha haben sie gesagt, dass es einzig und allein Ihrer Umsicht, Ihrem schnellen, kompetenten Eingreifen zu verdanken ist, dass meine Moni noch lebt. Auch wenn es Sie mittlerweile vermutlich nervt, aber das kann ich nicht vergessen, und ich werde es wieder und wieder erzählen, ob es nun jemand hören will oder nicht. Wir stehen tief in Ihrer Schuld, Frau Doktor, denn Sie haben nicht nur Moni geholfen, sondern auch mir. Sie tun es noch immer. Sie haben mich auf die Spur gebracht und aus mir einen ganz anderen Menschen gemacht.«
Nicht das schon wieder.
Allmählich wurde es Roberta peinlich.
»Herr Lingen, ich habe meine Pflicht getan, das ist mein Beruf, und Herr Dr. Riedel hätte auch nicht anders gehandelt.« Er winkte ab.
»Eigentlich will ich ja auch darüber nicht sprechen, es geht um etwas anderes. Ihre Worte sind bei uns auf einen fruchtbaren Boden gefallen. Zunächst waren wir ziemlich verunsichert, einer wollte dem anderen nicht in den Rücken. Moni und ich haben uns ausgesprochen, wir waren aufrichtig zueinander, und nun ist alles klar. Wir werden den ›Seeblick‹ aufgeben, und es gibt sogar bereits einen ernsthaften Interessenten.« Dann erzählte er der staunenden Roberta alles, was sich inzwischen ereignet hatte und zu welchem Ergebnis sie gekommen waren.
Es hörte sich gut an, auch wenn sie ein leises Bedauern verspürte, nicht nur zwei nette, sympathische Patienten zu verlieren, sondern auch die Möglichkeit, wirklich gut essen gehen zu können.
In erster Linie freute sie sich für die Lingens, und das sagte sie ihm auch.
»Für unsere Stammgäste wird es noch ein fürstliches Abschiedsessen geben, und Sie, Frau Doktor, sind natürlich jetzt schon ganz herzlich eingeladen.«
»Diese Einladung nehme ich dankend an«, sagte sie und erinnerte sich daran, dass die Einladung bei den Münsters bevorstand, und sie hatte nicht die geringste Ahnung, was sie anziehen sollte.
Roberta Steinfeld war eine hervorragende Ärztin, aber in erster Linie war sie eine Frau. Und auch wenn sie wusste, dass es unwichtig war, keine Rolle spielte, wollte sie schon hübsch aussehen.
Diese Gedanken verdrängte sie allerdings so schnell, wie sie ihr gekommen waren.
Sie saß in ihrer Praxis, war mitten in der Sprechstunde. Neben Hubert Lingen gab es noch andere Patienten, die da draußen im Wartezimmer warteten. Die hatten Vorrang.
»Herr Lingen, ich freue mich für Sie und Ihre Frau, und Sie können stolz auf sich sein, die Kraft gefunden zu haben, einen neuen Weg einschlagen zu wollen. Es ist schwer, sich von alten Gewohnheiten zu trennen, selbst wenn sie für einen überhaupt nicht gut sind.«
Auch da wusste sie, wovon sie sprach. Sie und ihr Exmann … Sie hatte jahrelang an Max festgehalten, obwohl es quälend, enttäuschend gewesen war.
Darüber musste sie jetzt auch nicht nachdenken. Außerdem war es vorbei.
Sie besprach mit Hubert Lingen noch, wie sie sich, solange er im Sonnenwinkel weilte, den weiteren Verlauf für ihn vorstellte, dann verabschiedete sie sich und bat den nächsten Patienten ins Behandlungszimmer.
Es war kein Patient, sondern eine Patientin, die eigentlich ganz nett war. Schwierig mit ihr war nur, dass sie sich im Fernsehen alle nur möglichen Gesundheitssendungen ansah und nun glaubte, Bescheid zu wissen, aber auch das eine oder andere Symptom für eine Krankheit an sich zu erkennen.
Roberta begrüßte die Frau freundlich, bat sie Platz zu nehmen, und dann musste sie gar nicht erst nach irgendwelchen Beschwerden fragen.
Sie saß kaum, als es aus der Patientin bereits förmlich herausplatzte: »Frau Doktor, dieses Schwindelgefühl deutet ganz eindeutig auf einen leichten Schlaganfall hin.«
Am liebsten hätte Roberta jetzt die Augen verdreht.
»Nein, Frau Huber, das hat eindeutig mit Ihrem zweiten Halswirbel zu tun. Das haben die Untersuchungen in der Klinik, beim Hals-, Nasen- und Ohrenarzt ergeben, der auch ausschließen konnte, dass es im Innenohr eine Störung gibt.«
»Aber gestern habe ich in …«
Roberta unterbrach die Frau. »Frau Huber, statt sich all diese Sendungen anzusehen und daraus Rückschlüsse auf sich zu ziehen, sollten Sie die Übungen machen, und Sie sollten die Termine beim Physiotherapeuten nicht ständig ausfallen lassen. Mit einer manuellen Therapie, dazu mit Packungen aus Naturfango ginge es Ihnen längst besser.«
Frau Huber wollte ihre Erkenntnisse an den Mann bringen, doch Roberta blieb hart. Anfangs hatte sie das noch belustigt hingenommen, aber jetzt übertrieb die Gute.
Ihre Mitarbeiterin Ursel Hellenbrink steckte den Kopf zur Tür herein, sprach von einem Notfall.
Roberta wusste nicht ob das jetzt echt war oder ob Ursel ihr nur helfen wollte, die Patientin loszuwerden. Sie waren ein hervorragendes Team, und Roberta hatte noch nie mit jemandem so gut zusammengearbeitet wie mit dieser Frau.
»Ich komme sofort«, sagte sie. Ursel ging, Roberta erhob sich, entschuldigte sich bei Frau Huber und verabschiedete sich von ihr.
Ob die gute Frau nun beleidigt war oder nicht, konnte Roberta nicht erkennen, aber, wenn sie ehrlich war, wäre sie nicht einmal böse, wenn Frau Huber nicht mehr zu ihr in die Praxis käme.
Sie stahl ihr Zeit, die Roberta für Patienten, die ihre Hilfe wirklich nötig hatten, benötigte.
*
Roberta freute sich wirklich auf den Abend bei den Münsters, es war ein schöner Abschluss nach einer arbeitsreichen Woche.
Am Wochenende hatte sie frei, sie war für keinen Notdienst eingeplant, und wenn es spät werden sollte, hatte sie die Gewissheit, dass sie am nächsten Morgen ausschlafen konnte.
Und vielleicht würde sie danach zum See wandern, sich bei Kay Holl ein Boot ausleihen. Sollte er ebenfalls Gast bei den Münsters sein, dann würde sie das gleich perfekt machen.
Hatte sie sich seinetwegen überlegt, was sie anziehen sollte? Er ging ihr nicht aus dem Kopf, weil er ein so außergewöhnlicher Mann war, dessen Ausgeglichenheit und Ruhe sie faszinierte. Wenn man von jemandem sprach, der in sich ruhte, dann konnte man ihn als leuchtendes Beispiel vorführen. Natürlich sah er auch fantastisch aus, aber das war es nicht. Es war eher etwas, was sie vorsichtig sein ließ. So etwas hatte sie bereits gehabt, mit schmerzlichem Ausgang, und sie würde auf jeden Fall künftighin an die Worte ihrer Freundin Nicki denken, die immer sagte: »Von einem schönen Teller isst man nicht.«
Aber solche Gedanken musste sie sich nicht machen, sie wollte mit Kay keine Beziehung eingehen, aber sich mit ihm anfreunden? Warum nicht?
Im Übrigen war sie neugierig, und die Frage, wer er war, welche Vergangenheit er hatte, interessierte sie schon.
Auf jeden Fall fühlte Roberta sich in ihrem taupefarbenen Leinenkleid sehr wohl. Sie hatte damals lange überlegt, ob sie es sich kaufen sollte, weil es ziemlich teuer war. Doch das edle Leinen und der Schnitt hatten sie überzeugt. Und dann hatte sie auch noch festgestellt, dass sie ein Paar Schuhe in genau dieser Farbe besaß.
Sie hatte sich entschlossen, den Weg zum Herrenhaus zu Fuß zurückzulegen. Sie konnte ihren Patienten nicht immer eindringlich ans Herz legen, sich mehr zu bewegen und es für sich selbst ignorieren.
Autos fuhren an ihr vorbei, und als sie oben ankam, sah sie, dass schon viele Gäste da waren.
Es war ein milder Sommerabend. Wegen der großen Terrassen, der herrschaftlichen Räume, vor allem wegen des wundervollen Parks, hatte man alles ins Herrenhaus verlegt. Da waren die Bewohner hier oben sehr flexibel. Drinnen war ein fantastisches Buffet aufgebaut, und die Gäste hatten die Wahl, selbst zu entscheiden, wo sie speisen wollten, drinnen oder draußen.
Es war ein beeindruckendes, ein herrliches Ambiente, und die Ruine der Felsenburg vervollkommnete das Besondere.
Allmählich begriff Roberta, warum man sich so sehr darum riss, von den Münsters, von Marianne von Rieding und deren Ehemann Carlo Heimberg eingeladen zu werden.
Alles hatte Stil, und die Gastgeber verstanden es, nicht eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft einzuladen, sondern Menschen, die zueinander passten, die sich etwas zu sagen hatten.
Sandra Münster kam sofort auf sie zugelaufen, als sie Roberta entdeckte. Auch sie hatte ein Kleid an, blaugrundig mit kleinen Blümchen, einem Mille-Fleur-Muster, das Roberta an jeder Frau schön fand, nur an sich nicht. Sie fand diese Mille-Fleurs ganz wundervoll, hatte sich sogar selbst einmal ein Kleid mit einem solchen Muster gekauft, war begeistert davon gewesen. Nicht lange, denn ihr Exmann hatte es ihr gründlich vermiest, indem er ihr zugerufen hatte, sie möge doch, um Himmels willen, diese schreckliche Kittelschürze ausziehen. So etwas prägte. Leider manchmal auch für immer.
Sandra Münster sah auf jeden Fall entzückend aus, und sie war wirklich eine äußerst sympathische Frau.
Sie begrüßte Roberta freudig, die sich nochmals artig für die Einladung bedankte und Sandra einen Umschlag in die Hand drückte.
Die Münsters wünschten sich weder Blumen noch Gastgeschenke, sondern stellten es ihren Gästen frei, wenn sie wollten, einen Umschlag dazulassen mit einer mehr oder weniger großen Geldspende.
Sandra, ihr Mann ebenfalls, spendeten großzügig, und es gab immer ein Projekt, das sie unterstützten.
Diesmal war es, es konnte durchaus sein, wegen des Zwischenfalls am See, für eine Initiative, die sich dafür stark machte, dass Kinder das Schwimmen erlernten. Es war erschreckend, dass es viele Kinder und Jugendliche nicht konnten.
Sandra vergaß nie, dass sie zwar schwimmen konnte, aber auch nicht viel besessen hatte außer einem klangvollen Namen … von Rieding.
Ihr Großvater, den sie niemals kennengelernt hatte, wollte mit ihr und ihrer Mutter nichts zu tun haben, weil er nicht damit einverstanden gewesen war, dass sein Sohn eine Frau geheiratet hatte, die er liebte und keine, die sein Vater für ihn vorgesehen hatte.
Das hatte er ihm nie verziehen, und selbst als sein Sohn verstorben war, war er unversöhnlich geblieben.
Sandra und ihre Mutter waren höchst erstaunt gewesen, dass der alte Baron ihnen seinen gesamten Besitz vermacht hatte. Manchmal ging das Leben wirklich seltsame Wege.
Anfangs war es nicht einfach gewesen, sie hatten sich auch nicht sonderlich wohlgefühlt. Doch das war längst vorbei, im Herrenhaus, in der Dependance, waren das Glück eingekehrt.
Sandra machte Roberta mit einigen Leuten bekannt, als sie schließlich auf die Terrasse kamen, sahen sie Teresa und Magnus von Roth, sowie Inge und Werner Auerbach.
Roberta war froh, sich zu ihnen gesellen zu können, und sowohl die von Roths als auch die Auerbachs schienen erfreut zu sein, die junge Ärztin zu sehen.
Sie baten sie zu sich, und das ließ Roberta sich nicht zweimal sagen, es war der perfekte Platz, um von hier aus alles zu sehen, ohne andauernd hallo sagen zu müssen, weil der Tisch ein wenig in der Ecke stand.
Roberta sah sich ein wenig unauffällig um, doch sie konnte Kay Holl nicht entdecken, was sie ein wenig enttäuschte.
Konnte Teresa von Roth Gedanken lesen?
»Ich habe Sie auf dem See gesehen, Frau Doktor«, sagte sie, »in einem Segelboot, zusammen mit dem charmanten Herrn Holl.«
Hoffentlich sah man jetzt nicht dass sie errötete wie ein Teenie.
»Und was ist dabei, Teresa?«, wollte ihr Mann wissen.
Das hatte ausgereicht, sie ihre Fassung zurückgewinnen zu lassen.
»Ja, stimmt, ich habe mir da auch schon ein Ruderboot geliehen«, bemerkte Roberta und wunderte sich, wie ruhig ihre Stimme klang.
Sofort hakte Teresa ein.
»Ach ja, richtig, mit dem waren Sie ja unterwegs, als Sie das Kind retteten.«
»Teresa«, rief ihr Mann.
»Mein Gott, Magnus, stimmt doch, man konnte es sogar in der Zeitung lesen.«
»Das bedeutet nicht, dass du es wieder hervorholen musst, meine Liebe. Du bedrängst die Frau Doktor richtig.«
Da widersprach seine Frau aber sofort. »Ist doch nicht wahr. Ich finde es toll, was sie gemacht hat, und dass sie mit Kay Holl unterwegs ist, gefällt mir auch. Er ist ein so toller Mann. Finden Sie nicht auch, Frau Doktor?«
Roberta zuckte die Achseln. »Dazu kann ich nichts sagen, ich weiß nichts über ihn. Aber ja, er ist sehr sympathisch, und von Booten versteht er auch etwas.«
Teresa war in ihrem Element, in der Regel war sie nicht schwatzsüchtig, aber sie hatte Kay in ihr Herz geschlossen und bedauerte zutiefst, dass sie keine Enkelin oder Urenkelin hatte, die sie mit Kay zusammenbringen konnte. Die eine war vergeben, die anderen zu jung.
»Kay besaß eine große, bekannte Werbeagentur«, sagte sie und beugte sich ein wenig zu Roberta hinüber, »die hat er Knall auf Fall aufgegeben, als er merkte, dass er ein Leben führte, bei dem man in dieser Form nicht alt werden konnte.«
»Ist er für eine große Werbeagentur nicht zu jung?«, erkundigte Roberta sich. »So etwas erarbeitet man sich doch erst mit den Jahren.«
Teresa lachte.
»Wenn sie so wollen, war Kay so etwas wie ein Wunderkind, ein Genie ist er noch immer. Auf jeden Fall hat er schon als Schüler viel Geld verdient, indem er für Werbeagenturen arbeitete, und das war auch als Student so. Er hatte also mehr als nur einen Fuß drin, als er sich selbstständig machte. Es kam zu großen Kooperationen mit amerikanischen und australischen Agenturen, und er war irgendwann so etwas wie ein Hamster in seinem Rädchen. Er hat gearbeitet, gearbeitet, auf einem Flug von Hongkong nach New York hatte er einen Zusammenbruch, und es wäre beinahe irgendwo zu einer Zwischenlandung gekommen, und da hat er gemerkt, dass das nicht alles sein konnte.«
»Woher wissen Sie das eigentlich alles, Frau von Roth? Ich halte ihn nicht unbedingt für sehr redselig«, bemerkte Roberta, die natürlich mit sehr großem Interesse zugehört hatte, was hoffentlich von niemandem bemerkt worden war.
»Kay und ich sind Freunde«, antwortete sie, als sei das die selbstverständlichste Sache der Welt, »und ich habe ihn einfach gefragt. Einer alten Frau schlägt man so leicht keinen Wunsch ab.«
»Aber eine alte Frau sollte jetzt endlich die Klappe halten«, mischte Magnus von Roth sich ein. Aber das war nicht böse gemeint, das merkte man seiner Stimme an. »Hier sitzen noch andere Leute am Tisch, die sich vielleicht gern ein wenig mit der Frau Doktor unterhalten würden. Inge und Werner verdrehen bereits die Augen.«
Ehe es allerdings zu einer allgemeinen Unterhaltung kam, trat Sandra an ihren Tisch.
»Meine Lieben, ich muss euch jetzt für einen Augenblick die Frau Doktor Steinfeld entführen. Mama, mein Schwiegervater, vor allem mein Mann, möchten sie gern kennenlernen, und da gibt es auch noch ein paar andere Leute, die darauf brennen.«
Als sie die enttäuschten Gesichter bemerkte, sagte sie beschwichtigend: »Keine Sorge, ich bringe sie euch zurück.«
Roberta fand es nicht besonders prickelnd, herumgereicht zu werden, mit allen nur möglichen Leuten Small Talk zu machen.
Jetzt allerdings war sie froh, für einen Moment nicht mehr am Tisch sitzen zu müssen. Das, was Teresa von Roth ihr da über Kay Holl erzählt hatte, war interessant, es verwirrte sie allerdings auch, warum auch immer.
Dass er nicht dumm war, hatte sie daran erkannt, wie er sich ausdrückte. Für einen Aussteiger hätte sie ihn allerdings nicht gehalten.
Sie fragte sich allerdings, welchen Weg er wohl gegangen sein mochte, um von einem Karriereneurotiker, der sich offensichtlich in der Kurve selbst überholt hatte, zu einem so entspannten, in sich ruhenden Menschen zu werden.
Das interessierte sie.
Würde sie es je erfahren?
Sie hatten Marianne von Rieding erreicht, die nicht weniger herzlich war als ihre Tochter, und auch Carlo Heimberg war ein sehr sympathischer Mann, dem nicht anzumerken war, dass er ein erfolgreicher Architekt war, vielfach preisgekrönt, und mit dem Sonnenwinkel hatte er auch etwas Besonderes geschaffen.
Es gehörte schon sehr viel Sensibilität dazu, zu etwas Bestehendem Neues zu schaffen und es zu einer Einheit zu vereinen.
Auch Felix Münster gefiel ihr, der seinen Reichtum in keiner Weise nach Außen kehrte.
Ja, sie war richtig froh, hergekommen zu sein, und sie würde ganz gewiss auch weiteren Einladungen folgen.
Sandras Einladung war nur an Sonnenwinkler erfolgt, weil der Grund ursprünglich gewesen war, Roberta auf diese Weise Patienten zuzuführen. Das war nun zum Glück nicht mehr nötig, aber dennoch freute Roberta sich, wirklich nette Leute kennenzulernen.
Schade war, dass die Auerbach-Kinder nicht dabei waren, die sonst nicht fehlten, weil sie mit Sandra und Anhang eng verbandelt waren.
Es war ein wunderbares Beisammensein, und der Caterer, der das Buffet geliefert hatte, war ein Meister seines Fachs.
Die Getränke waren erlesen, die Stimmung perfekt. Und gute Gespräche rissen nicht ab.
Was wollte man mehr!
*
Die ersten Vögel begannen schon zu zwitschern, als Roberta, als eine der Ersten, das gelungene Fest verließ.
Es hatte aber auch alles gepasst, eine laue Nacht, die wie Samt auf der Haut war, und ein unglaublicher Sternenhimmel.
Roberta hatte sogar eine Sternschnuppe gesehen, bei deren Anblick man sich ja etwas wünschen konnte. Doch ehe es dazu gekommen war, war sie verglüht. Und Roberta hatte daraus wieder einmal etwas gelernt …, nämlich, dass man manchmal ganz spontan sein musste und handeln, ohne den Verstand einzuschalten.
In ihrem Haus angekommen, ja, so nannte sie es mittlerweile bereits, ohne dass es ihr schon gehörte, konnte sie noch nicht gleich ins Bett gehen.
Sie holte sich etwas zu trinken und setzte sich auf die Terrasse, lauschte den Geräuschen der Nacht und des heraufkommenden Morgens.
Sie dachte an Kay Holl, an das, was sie über ihn gehört hatte. Im Grunde genommen war sie auch eine Aussteigerin. Von einer Großstadtpraxis, die beinahe schon Privatklinikcharakter hatte, in die tiefste Provinz. Von vielen Angestellten hin zu einer einzigen Mitarbeiterin. Kay hatte seine Entscheidung von sich aus getroffen, sie war wegen ihrer Scheidung dazu gezwungen worden, sonst wäre sie gewissermaßen noch immer so was wie der Hamster in seinem Rädchen.
War es nicht ein Glück, dass es so gekommen war?
Sie gewann immer mehr an Lebensqualität hinzu, und über fehlende Patienten musste sie sich auch nicht mehr beklagen, und nach diesem Abend würde sie noch mehr hinzugewinnen. Alles nette Leute, die aber auch, wenn sie Bedarf gehabt hätten, so gekommen wären.
Die Menschen, die man »da oben« antraf, gingen nicht aus lauter Neugier irgendwohin.
Roberta trank etwas, stellte ihr Glas wieder ab.
Ja, sie hatte die richtige Entscheidung getroffen, sie hatte Glück gehabt.
Sie blickte hinauf in den Himmel, sah all die Sterne, doch eine Sternschnuppe entdeckte sie nicht mehr.
Was hätte sie sich denn dann gewünscht?
Nun ja …
So richtig traute sie sich nicht, daran zu denken, weil es schon ein wenig verrückt war und bestimmt nur ihrer derzeitigen Stimmung entsprach, die ein wenig sentimental war.
Man spürte deutlich den neuen Tag, und um den nicht zu verschlafen oder ihm mit dicken Augen zu begegnen, sollte sie schleunigst ins Bett gehen.
Sie stand auf, nahm das Glas mit hinein, und wenig später lag sie in ihrem Bett, kuschelte sich in ihre weiche, seidige Decke und lächelte.
Es war schön gewesen, irgendwann würde sie auch ein paar Leute zu sich einladen. Platz hatte sie genug.
Über die Gedanken, wen sie einladen würde, schlief sie ein, noch immer mit einem Lächeln.
*
Roberta schreckte hoch, versuchte, sich zurechtzufinden, und da hörte sie es erneut. Es wurde ganz heftig an ihrer Tür geklingelt, und davon war sie wach geworden.
Ein Notfall, schoss es ihr durch den Kopf, und ohne zu überlegen, barfuß, in ihrem feinen Batistnachthemd, rannte sie zur Tür, riss sie auf.
Sie prallte zurück!
Sie hätte mit allem gerechnet, damit nicht.
Von wegen Notfall!
Vor ihrer Tür stand Max, ihr Exmann!
Sie starrte ihn an wie eine Fata Morgana, dann fiel ihr Blick auf eine kleine Wanduhr, die in der Diele hing.
Es war noch keine acht Uhr!
»Was willst du denn hier?«, erkundigte sie sich, als sie sich von ihrer Überraschung erholt hatte.
»Ich muss mit dir reden.«
Was sagte er da?
»Max, weißt du, wie spät es ist?«
Er zuckte die Achseln.
»Ich kenne dich nur als Frühaufsteherin, aber hier in der Pampa scheint alles anders zu laufen, nun ja, viel mehr als essen, schlafen und fernsehen ist hier wohl auch nicht drin. Darf ich reinkommen, oder willst du mich vor der Tür stehen lassen, Roberta? Ich habe nämlich noch eine Verabredung, die ich unbedingt einhalten muss. Es macht keinen guten Eindruck, direkt zum ersten Date zu spät zu kommen.«
Er hatte sich nicht verändert.
Sollte sie es sich wirklich antun, ihn ins Haus zu lassen, oder sollte sie ihm einfach die Tür vor der Nase zuschlagen?
Sie hatte zu lange gezögert, das ging nicht, denn er schob sich einfach an ihr vorbei, und sie hatte keine Wahl, als die Tür zu schließen und ihm zu folgen.
»Sieht alles noch ein bisschen kahl aus«, bemerkte er.
»Tja, das ist alles, was du mir nicht wegnehmen konntest, weil ich es mit in die Ehe brachte«, konnte sie sich nicht verkneifen zu sagen. Sie hätte noch viel mehr sagen können, doch welchen Sinn sollte das machen?
Also wiederholte sie ihre Frage: »Was willst du, Max?«
Sie bot ihm keinen Platz an, doch das ignorierte er, setzte sich, wollte einen Kaffee haben, den sie ihm allerdings nicht verweigerte, weil sie den auch brauchte.
Sie ging in die Küche, ihre Gedanken überschlugen sich.
Was wollte er von ihr?
Sie waren geschieden, es war alles geregelt.
Trieb die Neugier ihn hierher?
Sie wusste es nicht, und es war auch müßig, darüber nachzudenken.
Als sie mit dem Kaffee aus der Küche kam, bemerkte sie, wie er sie anstarrte.
»Du siehst gut aus«, sagte er, »und in diesem dünnen Nachthemd ganz schön sexy. Da kann man ja gleich auf ganz andere Gedanken kommen.«
Das war Max!
Sie ignorierte die Bemerkung, schob ihm seinen Kaffeebecher zu, heiß, süß, mit viel Milch.
So etwas wusste man, wenn man so viele Jahre verheiratet gewesen war.
Sie trank ihren Kaffee schwarz, trank etwas, spürte, wie ihre Lebensgeister wieder erwachten.
Sie sah ihn an, er hatte verloren, sah verlebt aus, was bei seinem Lebenswandel auch kein Wunder war.
»Max, jetzt frage ich dich zum dritten und letzten Mal, was du von mir willst.«
Welch ein Glück, dass sie saß, denn das, was er nun von sich gab, war geradezu ungeheuerlich.
»Ich will dir ein Angebot machen. Ich möchte, dass du bei mir wieder einsteigst. Das hier kann ja nun wirklich nicht dein Leben sein, bei mir hast du die Chance, wieder wer zu sein. Ich werde dich selbstverständlich entsprechend bezahlen.«
Roberta sagte nichts, schaute ihn nur an.
Er deutete ihr Schweigen falsch.
»Meinetwegen biete ich dir auch eine Partnerschaft an.«
Es war ungeheuerlich.
Es war ihre Praxis gewesen, sie hatte Geld, ihr ganzes Know-how hineingesteckt. Sie hatte gearbeitet von Montag bis Sonntag, hatte so manches Mal überhaupt nicht gewusst, welcher Tag eigentlich war. Und er, er war in seinem weißen Kittel mehr oder weniger nur herumstolziert, hatte die Patientinnen und die Mitarbeiterinnen angemacht. War einfach nicht in die Praxis gekommen, wenn er da etwas laufen hatte, und nun war er hier und bot ihr eine Stelle an.
Dreister ging es ja wohl nicht!
Roberta wollte erst anfangen zu toben, doch dann riss sie sich zusammen. Derjenige, der emotional bewegt war, war immer in der schwächeren Position, das wusste sie aus Erfahrung.
Also riss sie sich zusammen. Man konnte daran fühlen, dass er in der Bredouille war, sie wusste es sogar. Die Patienten blieben weg. Er hatte sogar schon Personal entlassen müssen.
Sie trank einen Schluck Kaffee, stellte bedächtig den Becher auf den Tisch, dann sagte sie: »Du, Max, ich finde es wirklich sehr nett, dass du an mich denkst, dass du dir meinetwegen Gedanken machst. Das musst du nicht, ich bin mit dem, was ich hier habe, sehr zufrieden. Du wolltest unsere Praxis haben, oder soll ich sagen, du hast sie dir unter den Nagel gerissen? Ich habe verzichtet, und dabei soll es bleiben. Ich bitte dich, jetzt zu gehen. Und, Max, bitte komme niemals wieder hierher. Und rufe mich auch nicht mehr an. Das Band zwischen uns ist zerschnitten, für immer.«
Sie wollte ihm an den Kopf werfen, für wie blöd er sie eigentlich hielt. Sie tat es nicht.
Er kannte sie anders, weinend, schreiend.
Er war irritiert.
Doch er war noch nicht bereit aufzugeben, weil es bei ihm um alles ging. Er war ein grottenschlechter Arzt, das hatten die Patienten längst erkannt. Und nach Roberta fragten sie immer noch und blieben weg, weil sie nicht mehr da war.
»Nun, ich gebe zu, dass da einiges dumm gelaufen ist. Du, wenn du noch Möbel oder was anderes haben willst, bitte schön, kein Problem. Es ist eh fast alles eingelagert. Und das mit der Praxis. Roberta, du bist gut, du bist hervorragend, und du brauchst Herausforderungen. Das hier kann es ja nun wirklich nicht für dich sein. Das ist, entschuldige bitte, Perlen vor die Säue geworfen.«
Sie konnte ihn und sein dummes Geschwätz nicht mehr ertragen. Was hatte sie bloß an ihm gefunden? Enno Riedel und die anderen Freunde von früher hatten es auch nicht begreifen können, dass sie sich für Max entschieden hatte. Sie waren schlauer gewesen, doch das brachte sie nicht weiter. Geschehen war geschehen. Und das war nicht zu korrigieren und auch nicht auszuradieren.
»Max, du solltest jetzt wirklich gehen, sonst kommst du noch zu spät zu deinem Date.«
Sie stand einfach auf, schickte sich an, den Raum zu verlassen.
Er starrte sie an, konnte es nicht glauben, doch dann hatte er keine andere Wahl, er musste ihr folgen.
Natürlich versuchte er es erneut, diesmal noch eindringlicher.
Seine Worte rauschten an ihr vorbei wie der Wind durch die Linde.
Sein plötzliches Auftauchen war unangenehm, doch es hatte auch etwas Gutes.
Jetzt war sie endgültig geheilt!
Sie sagte nichts mehr, weil alles gesagt worden war, sie riss die Haustür auf.
Sie hätte jetzt triumphieren und ihm an den Kopf werfen können, dass er an allem selbst schuld war. Sie hätte ihm sagen können, dass seine Frauengeschichten ihn vollkommen an den Abgrund bringen würden, dass er sich besinnen musste, um nicht seine Existenz zu verlieren.
Sie sagte nichts. Es ging sie nichts an. Und sie triumphierte auch nicht, weil ihm das um die Ohren flog, was sie aufgebaut hatte. Und das tat ein bisschen weh, diese mangelnde Wertschätzung.
Er machte noch einen Versuch. »Und du willst es dir wirklich nicht überlegen? Die Praxis war dein Baby.«
Das hätte er jetzt nicht sagen dürfen, dazu musste sie sich äußern.
»Stimmt, aber du hast es mir brutal entrissen. Mach’s gut, Max. Ich will dich niemals mehr sehen und auch nie mehr etwas von dir hören.«
Sie schlug die Haustür zu, lehnte sich für einen Moment von innen dagegen.
Schreck in der Morgenstunde nannte man wohl das, was sie gerade erlebt hatte.
Jetzt brauchte sie noch einen Kaffee, dann würde sie unter die Dusche gehen, sich was anziehen und ein Stück am See entlanglaufen, um sich zu beruhigen. Aber eines stand auf jeden Fall fest. Sie würde die andere Richtung nehmen.
Dr. Max Steinfeld tauchte einfach hier auf, damit sie für ihn die Kastanien aus dem Feuer holte.
Wie dreist war das denn?
Hatte er wirklich geglaubt, sie würde auf sein Angebot hereinfallen?
Sie riss die Terrassentür auf, weil noch immer der Duft seines After Shaves im Raum hing. Das brauchte sie auch nicht, ganz gewiss nicht, und mit spitzen Fingern trug sie auch seinen Kaffeebecher in die Küche und steckte ihn sofort in den Geschirrspüler.
So, und nun konnte sie duschen gehen, und wenn sie zurückkam, dann war auch das Letzte, was an ihn erinnerte, verflogen.
*
Monika und Hubert Lingen verließen als Letzte das Notariat. Sie hatten noch ein paar Fragen an Heinz Rückert.
Nun war es also geschehen!
Der »Seeblick« war verkauft, und obwohl sie es doch beide so gewollt hatten, war es ein komisches Gefühl, das in ihnen war.
Sie hatten viele Jahre im Sonnenwinkel verbracht, es hatte gute und schlechte Zeiten gegeben.
Jetzt war der Weg zu Ende.
Sie würden das, was sie mitnehmen wollten, zusammenpacken, das letzte versprochene Essen geben, und danach würde ein anderer im Seeblick schalten und walten, ein sehr netter junger Italiener, Roberto Andoni, noch dazu jemand, der aus Rom stammte.
Bei einer solchen Konstellation konnte man an Mafia oder ähnliche Strukturen denken, zumal Andoni widerstandslos den geforderten Kaufpreis gezahlt hatte, ohne einen Cent herunterzuhandeln.
Heinz Rückert hatte Andoni überprüft und nichts Dubioses feststellen können.
Er hatte im Internet den Seeblick gesehen, sich darin verliebt und sich entschlossen, ein italienisches Restaurant daraus zu machen.
Ein Restaurant, keine Pizzeria, wenngleich es natürlich auch Pizza im Angebot geben würde.
Nun, wenn sie an ihre Anfänge zurückdachten, dann waren sie auf ähnliche Weise hergekommen. Es war wohl wirklich so, dass das, was auf den Weg kommen sollte auch kam.
Sie würden ihr Leben neu ordnen müssen, und ein Anfang war bereits gemacht. In dem geerbten Mehrfamilienhaus war eine Wohnung frei geworden, und die ließen sie augenblicklich für sich herrichten.
Sie waren nicht mehr in dem Alter, in dem man, ohne feste Adresse, mit dem Rucksack durch die Welt ziehen konnte.
Das Umherziehen war eh nicht geplant, der Jakobsweg schon. Und ansonsten?
Sie waren offen für alles und mussten sich erst einmal an den Gedanken gewöhnen, keine Verpflichtungen mehr zu haben, mit ihrer Zeit anfangen zu können was sie wollten. So etwas musste auch erst wieder gelernt werden.
Sie gingen zum Parkplatz, auf dem sie ihr Auto abgestellt hatten.
Monika blieb stehen.
»Hubsi, bitte kneif mich mal.«
Ein wenig irritiert schaute er sie an, dann begriff er, lachte und zwickte sie leicht.
»Du willst dich davon überzeugen, dass alles wahr ist, dass du nicht träumst.«
Monika nickte, dann sagte sie: »Guck mal nach oben, siehst du die rosarote Wolke am Himmel? Was meinst du, ist es die Wolke sieben? Wenn ja, dann möchte ich genau dort mit dir sein.«
Er legte einen Arm beschützend auf ihre Schulter.
»Es ist die Wolke acht«, lachte er, »aber ob sieben, acht oder fünf. Das spielt keine Rolle. Wir müssen uns nichts zusammenträumen. Unser Leben findet hier unten statt, und mit dir an meiner Seite, Monilein, ist das Leben auch hier ein ganz wunderbarer Traum.«
Er war wieder so weich geworden, so sensibel. Ganz wie früher. In den letzten Jahren war davon nichts mehr zu spüren gewesen. Sie war gerührt, berührt, und sie musste sich sehr bemühen, vor lauter Sentimentalität die Tränen zurückzuhalten.
»Trinken wir noch irgendwo etwas?«, wollte er wissen.
Sie, noch immer stumm vor lauter Glück, schüttelte den Kopf. »Nein, lass uns nach Hause fah…«
Unvermittelt brach sie ihren Satz ab. Es war nicht mehr ihr Zuhause. Sie hatten es verkauft.
Spürte er, was in ihr vorging?
»Liebes, es ist immer schwer, Altes, auch wenn man es nicht mehr liebt, zu verlassen, wegzugeben, zu vergessen. Erinnerst du dich an das rote Kleid, das du niemals geliebt hast, allein schon nicht wegen der Farbe. Du hast es kaum getragen, und doch hattest du Probleme damit, es zu entsorgen. Du hast es dreimal mindestens aus dem Kleidersack wieder herausgeholt.« Dieser Vergleich hinkte zwar ein wenig, dennoch brachte er Monika zum lachen.
Ja, sie konnte sich erinnern.
Dann wollte sie zurück zum Seeblick.
Und als sie dort ankamen, zeigte sich alles von seiner schönsten Seite.
Das Haus, die Terrasse, das Grundstück, der fantastische Blick hinunter zum See, auf dem sich die Wellen kräuselten, auf dem die Enten und Schwäne schwammen, die Boote dahinglitten und über den auf majestätische Weise die Möwen hinwegflogen.
Es war schön, es war wunderschön.
Und merkwürdig.
So sentimental sie nach der Vertragsunterzeichnung beim Notar auch noch gewesen war, jetzt war sie es nicht mehr. Dabei hätte sie gerade jetzt, bei dieser Postkartenansicht, allen Grund dazu.
Fast schien es, als habe jemand in ihr einen Hebel umgelegt. Sie konnte loslassen, weil alles seine Zeit hatte.
Und Trennungen mussten nicht immer schmerzhaft sein, nicht immer etwas Zerstörerisches haben.
Man konnte sich auch in Frieden trennen.
»Hubsi, es ist so schön. Komm, setzen wir uns für einen Augenblick auf die Terrasse und genießen diesen herrlichen Blick. Weißt du noch? Damals, als wir zum ersten Mal herkamen, schien ebenfalls die Sonne und wir konnten von diesem herrlichen Blick nicht genug bekommen.«
Er nickte.
»Ich erinnere mich, mein Schatz – ein Deja-vu. So wie jetzt sollten wir den ›Seeblick‹ in Erinnerung behalten.«
Sie nickte, denn ein wenig ergriffen war sie schon.
Sie war froh, dass er sich neben sie setzte und sie ganz fest in den Arm nahm.
Sofort stellte sich wieder dieses Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit bei ihr ein.
Eines fand sie schon merkwürdig. Sie war der Meinung gewesen, dass es Hubert schwerfallen würde, loszulassen, weil er hier seine Kumpels hatte, er der Boss des »Seeblicks« gewesen war.
Nun war es genau umgekehrt.
Vermutlich lag es einfach nur daran, dass Frauen emotionaler waren und dass es ihnen leichter fiel, ihre Gefühle nach außen zu tragen.
Ein Weg war zu Ende.
Jetzt war alles offen.
Sie hatte keine Angst, mit ihrem Hubsi an ihrer Seite würde sie alles meistern, und es war auch nicht zu vergessen, dass sie sich in einer sehr komfortablen Lage befanden. Sie gingen nicht mit abgezähltem Geld in ihr neues Leben.
Auf einmal entstand ein Tumult, Schritte näherten sich, eine Männerstimme sagte: »Kommt her, es ist doch jemand hier.«
Eine Gruppe von mindestens zehn, zwölf Männern kam auf die Terrasse gepoltert.
Einer von ihnen sagte: »Welch ein Glück, wir hatten schon die Befürchtung, heute könnten Sie Ruhetag haben.«
»Das nicht«, entgegnete Hubert Lingen. »Wir haben ganz geschlossen. Es wird einen Besitzerwechsel geben. Schauen Sie einfach bei Ihrer nächsten Radtour wieder hier vorbei.«
Es ertönte ein »ach« und »oh« – Worte des Bedauerns fielen, dann zogen die Männer, was blieb ihnen auch anderes übrig, wieder ab.
Stille kehrte ein, friedliche Stille.
Sie waren keine Wirtsleute mehr, und weder er noch sie hatten so etwas wie Bedauern in sich, weil ihnen Umsatz entgangen war. Darum musste sich künftighin Roberto Andoni Gedanken machen.
Er musste in den Himmel schauen und sich fragen, ob es gutes oder schlechtes Wetter geben würde.
Er musste sich fragen, ob er Tagesausflügler mit einplanen und entsprechend einkaufen musste.
Sie hatten mit alldem nichts mehr zu tun.
»Hubsi, ich finde wir sollten noch eine Weile hier draußen bleiben.«
Sie stand auf.
»Was möchtest du trinken? Kaffee oder Tee?«
Er schob sie sanft auf ihren Platz zurück und erhob sich.
»Weder noch. Ich denke, ein kleines Gläschen Champagner wäre jetzt angebracht. Schließlich haben wir etwas zu feiern, unsere Freiheit.«
Dem widersprach sie nicht, sie sah ihm nach, wie er ins Haus ging, sichtlich befreit.
Lächelnd lehnte sie sich zurück, schloss die Augen und reckte ihr Gesicht der Sonne entgegen.
Das Leben war schön.
*
Seit sie in den Sonnenwinkel gezogen waren, arbeitete Werner Auerbach von zu Hause, und wenn er sich in seinem Arbeitszimmer befand, war es für alle Familienmitglieder tabu, ihn zu stören.
Alle hielten sich daran, vor allem seine Ehefrau.
Heute nicht.
Es war unmöglich, darauf zu warten, dass Werner aus seinem Allerheiligsten kam. Das würde sie nicht aushalten, dazu war sie viel zu aufgeregt.
Sie rannte auf sein Zimmer zu, klopfte kurz an, dann riss sie die Tür auf, stürmte in den Raum.
»Werner, tut mir leid, aber ich muss mit dir reden, und zwar sofort.«
Professor Auerbach wandte sich seiner Frau zu.
»Wo brennt es denn, mein Schatz?« Er war in keiner Weise ungehalten, denn er wusste, dass etwas Wichtiges geschehen sein musste, sonst wäre Inge nicht so aufgeregt hereingeplatzt.
Ursprünglich war sie es gewesen, die diese Regeln aufgestellt hatte, weil sie der Meinung war, dass man auch nicht mit ihm hätte reden können, säße er, ob in der Uni oder einem Konzern, an einem Arbeitsplatz.
Sie schwenkte eine bunte Ansichtskarte hin und her.
»Post von Hannes«, rief sie.
Jetzt konnte er ihre Aufgeregtheit noch weniger verstehen.
»Aber das ist doch schön. Wo steckt der Junge jetzt? Was schreibt er?«
Inge ließ sich in einen Sessel fallen.
»Er hat Leute kennengelernt, die ihn mit ihrem Boot mit zu den Galapagosinseln nehmen wollen.«
Professor Auerbach teilte die Aufgeregtheit seiner Frau überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
»Fantastisch, die Galapagosinseln müssen traumhaft sein. Hannes ist zu beneiden. Was bekommt er auf seiner Weltreise nicht alles zu sehen. Er wird mit einem ganz anderen Weitblick zu uns zurückkommen. Nun, ich denke, er wird eine kleine Zwischenstation machen. Auf Dauer wird der Sonnenwinkel ihm zu eng sein.«
Begriff Werner, ihr ach so kluger Ehemann, eigentlich überhaupt nichts?
»Werner, er fährt nicht mit der U-Bahn quer durch eine Stadt. Er geht mit Fremden auf ein Boot und dann mit denen auf eine einsame Inselgruppe, in der die Schildkröten die wichtigsten Bewohner sind. Klar ist das paradiesisch. Doch erinnere dich bitte daran, was vor nicht allzu langer Zeit geschehen ist. Ein junges Paar ankerte während einer Weltumsegelung auch vor einem Inselparadies. Im Paradies gibt es, wie wir wissen, auch Schlangen. Der junge Mann wurde nicht von einer Schlange gebissen, aber von einem Inselbewohner getötet.«
Natürlich konnte Werner Auerbach die Sorge seiner Frau um ihre Kinder verstehen, ganz besonders die um Hannes, der nach dem Abitur zu dieser Weltreise als Backpacker aufgebrochen war. Sie sah nur die Gefahren dieser Reise, nicht die Chancen. Und wenn es einen treffen sollte, dann konnte es gleich hier um die Ecke sein, wenn einem die sprichwörtliche Dachziegel auf den Kopf fiel und tötete.
»Inge, das war bedauerlich, ein tragischer Zwischenfall. Doch weißt du, wie viele Menschen sich einen solchen Lebenstraum erfüllen? Die meisten kommen irgendwann unbeschadet zurück. Hannes wird schon nichts passieren. Er ist lange genug unterwegs um abschätzen zu können, welches Wagnis er eingehen kann und welches nicht. Freu dich mit ihm und für ihn.«
Werner Auerbach wurde ganz sehnsuchtsvoll.
»Was hätte ich darum gegeben, in meiner Jugend eine solche Möglichkeit zu bekommen. Meine Eltern haben mich mehr oder weniger gezwungen, den geraden Weg zu gehen. Abitur, im Anschluss daran sofort Studium.«
»Geschadet hat es dir aber nicht«, wandte sie ein. »Aus dir ist etwas geworden.«
Er seufzte.
»Ja, schon, aber ich musste viele Träume begraben.«
Das wusste sie, und weil es so war, hatte er auch sofort zugestimmt, als Hannes davon gesprochen hatte, sich erst einmal den Wind um die Ohren wehen zu lassen, ehe er sich für ein Studium entschied. Werner hatte sogar die Reisekasse seines Sohnes ganz gehörig aufgebessert.
Sie hatte ein ungutes Gefühl.
War sie überbesorgt?
War sie gar eine Spießerin, weil für sie so etwas niemals infrage gekommen wäre?
Reisen schon, aber dann doch mit einem gewissen Komfort, der nicht übertrieben sein musste, ihr aber doch die Gewissheit verschaffte, in einem Hotel- oder Pensionszimmer übernachten zu können.
»Werner, interpretierst du da nicht etwas in Hannes hinein, was in deiner Fantasie existiert, nicht in der Wirklichkeit? Bist du nicht ein wenig zu sorglos?«
Er zuckte die Achseln.
»Denke ich nicht, Hannes hat diese Rucksackreisen nicht erfunden. Es sind sehr viele junge Menschen unterwegs, waren sie damals schon, und da war es weitaus schwieriger, weil die Welt nicht so miteinander vernetzt war, weil es keine Handys, Smartphones gab, kein Internet, nichts von all den heutigen Möglichkeiten der Kommunikation. Meine alten Freunde haben allesamt diese Reisen überlebt, unbeschadet, wohlgemerkt. Und sie zehren noch heute davon. Inge, Hannes weiß, was er tut, sei da ganz unbesorgt.«
Das war sie nicht, doch sie griff seine letzten Worte auf. Es gab schließlich noch ein Problem, eines, das sie täglich vor Augen hatten.
»Okay, Werner, hoffen wir mal, dass unser Sohn weiß, was er tut. Das können wir von uns nicht gerade behaupten.«
Was war denn heute mit Inge los? Er blickte sie fragend an, weil sie nichts sagte, erkundigte er sich.
»Nun, Werner, da gibt es noch immer dieses leidige Thema Adoption. Wann und wie sagen wir es unserem Kind? Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich die Zeichen immer mehr verdichten und dass es uns um die Ohren fliegen wird, wenn wir nicht endlich handeln und es ihr sagen, dass sie adoptiert ist.«
Also, Werner Auerbach konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass seine Inge heute dazu neigte, alles zu dramatisieren. Erst das mit Hannes, und nun die Adoption. Klar war es an der Zeit, es Bambi zu sagen. Aber was sollte ihnen denn um die Ohren fliegen? Und welche Zeichen? Die Adoption war ein Familiengeheimnis, und es wussten nur er, Inge und Jörg, Ricky und Hannes davon.
Sie wollten zwar alle, dass Bambi endlich die Wahrheit erfuhr, doch niemand würde vorpreschen, um es Bambi zu sagen. Dafür liebten sie ihren kleinen Sonnenschein alle viel zu sehr, wollten, dass es Bambi gut ging. Niemand würde etwas tun, was Bambi verletzen könnte.
Er gab ja zu, dass er ein wenig feige war, dass er lieber ein wissenschaftliches Problem löste, als dieses Gespräch zu führen.
Aber Inge hatte insofern recht, dass es belastend war, und sie sprachen eigentlich viel zu oft darüber. So etwas verursachte Angst, und Angst war kein guter Begleiter.
»Inge, wir werden es Bambi am Wochenende sagen, in aller Ruhe, und ganz ungestört. Und wenn sie das ein wenig verdaut hat, ziehen wir den Rest der Familie hinzu. Es macht keinen Sinn, den Kopf noch länger in den Sand zu stecken.«
Inge atmete erleichtert auf, und es fiel ihr ein Stein vom Herzen.
Sie hatten es immer vor sich hergeschoben, vage darüber geredet.
Jetzt stand ein Termin im Raum, ein kurzfristiger Termin, auf den sie sich jetzt einstellen konnten.
»Das ist eine gute Idee, Werner. Die Kinder werden es auch begrüßen, die drängen ja schon lange. Das Wochenende ist gut.«
Sie erhob sich, wollte ihn wieder allein lassen, damit er sich wieder seiner Arbeit zuwenden konnte.
Eines beschäftigte sie allerdings noch, und das sprach sie auch aus.
»Werner, es macht mir schon ein wenig Sorge. Bambi ist ein sehr emotionales Mädchen. Was glaubst du, wie sie es aufnehmen wird? Sie fühlt sich schließlich als hundertprozentige Auerbach.«
»Sie ist eine Auerbach, und sie ist das Kind unseres Herzens. Es liegt an uns, es ihr so zu vermitteln, dass sie es hinnimmt, dass diese Adaption nicht mehr ist als etwas …«
Er, der kluge Professor, kam nicht weiter. Er war ratlos, und das gab er auch zu.
»Inge, wir müssen es auf uns zukommen lassen. Vor Wahlen weiß niemand, wie sie ausgehen werden, und doch finden sie statt. Bei Wettkämpfen kann der hochfavorisierte Teilnehmer einen schlechten Tag haben, und es siegt ein Außenseiter. Inge, manches kann man auch zerreden. Der Zeitpunkt steht fest, zum ersten Male, und fest steht auch, dass wir Bambi über alles lieben und nur ihr Bestes wollen. Das allein ist es, was zählt.«
Sie nickte.
Werner hatte recht.
Doch als sie sein Arbeitszimmer verließ, fühlte sie sich nicht wohl und auch in keiner Weise erleichtert.
Sie starrte auf die bunte Ansichtskarte.
Galapagosinseln …
Für sie würden es erst Sehnsuchtsorte sein, wenn von Hannes die nächste Karte kam, nachdem er die Galapagosinseln wieder verlassen hatte.
Und Bambi?
Sie musste vorher unbedingt in die Kirche gehen, Kerzen anzünden und darum bitten, dass dieses Gespräch so verlaufen würde, dass ihre geliebte Kleine keinen Schaden nahm.
Sie ging an Jonny vorbei, der ziemlich teilnahmslos auf seinem Kissen lag. Selbst als sie umkehrte, um ihn zu streicheln, zeigte er kaum eine Reaktion.
Es sah nicht gut aus, und es würde schon sehr bald das eintreten, was unausweichlich war und was Bambi das Herz brechen würde.
Sie wusste nicht, ob sie sich wünschen sollte, dass es vor oder nach diesem entscheidenden Gespräch geschah.
Zwei tiefgreifende Erlebnisse waren für ein so hochsensibles Mädchen wie Bambi nicht zu verkraften. Das war ein einschneidender Zwischenfall zu viel.
Jonny war nicht irgendein Hund. Er war Bambis geliebter Gefährte, der sie durch ihre ganze Kindheit begleitet hatte, sie noch immer begleitete.
Inge konnte sich noch sehr gut daran erinnern, wie Fabian ihr den Welpen geschenkt hatte, und wie Bambi außer sich vor Freude und Glück gewesen war.
Alles hatte seine Zeit.
Jedes Leben war endlich.
Inge erhob sich, ging in die Küche, begann zu arbeiten. Sie musste sich unbedingt ablenken. Heute war sie sentimental, sehr sogar, und weil sie allein war, weil niemand sie beobachten konnte, vergoss sie doch ein paar Tränchen.
*
Rosmarie Rückert war doch ein wenig erstaunt gewesen, von ihrem Ehemann zu erfahren, dass er zu einem dringenden Auswärtstermin musste.
Es war nicht so, dass er sie in seine Geschäftsabläufe einweihte, doch über Termine, die nicht in seinem Büro stattfanden, sprach er schon. In erster Linie um seine Wichtigkeit hervorzuheben.
Heinz Rückert hatte es längst geschafft, er war ein sehr guter Notar, und man kam nicht nur zu ihm, um den Kauf einer Wohnung beurkunden zu lassen, sondern es ging um Konzernverkäufe oder ähnliches, was natürlich eine dicke Gebühr brachte, die den Wohlstand der Rückerts vermehrte.
Also, zu solchen Terminen ging er an andere Orte, ansonsten ließ er die Leute kommen, was ja auch üblich war.
Er hatte nichts gesagt, er war halt auch nicht mehr der Jüngste, ihr Heinz. Aber es konnte auch durchaus sein, dass er etwas erwähnt und sie nicht richtig zugehört hatte. Das passierte auch. Interessant war das, was ihr Heinz machte, für sie nicht unbedingt, was er verdiente, interessierte sie schon, denn das bescherte ihr ein schönes Leben.
Und genau das wollte sie genießen.
Wenn Heinz in seiner Kanzlei arbeitete, liebte er es, mittags nach Hause zu kommen, wobei sich das in der letzten Zeit auch geändert hatte.
Nun, wie auch immer. Heute würde er nicht kommen, und deswegen würde sie in die Stadt fahren, den ganzen Tag dort verweilen und ganz gehörig ihre goldene Kreditkarte glühen lassen.
Sie hatte eine Einladung des ersten Modehauses am Platz bekommen, nicht von ungefähr, denn dort war sie eine der besten Kundinnen. Die Sachen waren zwar teuer, doch genau ihr Stil, und schließlich konnte sie es sich auch leisten. Wozu hatte sie einen gut verdienenden Ehemann?
Zum Glück war ihr Heinz nicht kleinlich. Sie hatten viele gesellschaftliche Verpflichtungen, und da liebte ihr Mann es, wenn die Frau an seiner Seite ein bewundertes Highlight war.
Rosmarie warf einen letzten Blick in den Spiegel, sie konnte mit ihrem Aussehen zufrieden sein. Nicht nur, dass Kleider Leute machten, wie man so schön sagte. Sie war sehr diszipliniert, pflegte und cremte sich, und sie achtete streng auf ihre Linie und verkniff sich so manches.
Immerhin … Das Resultat konnte sich sehen lassen. Sie stäubte sich etwas von ihrem sündhaft teuren Parfüm hinter die Ohren, dann verließ sie die luxuriöse Villa.
Ja, da lebte sie nun.
Es war herrlich gewesen, sie zu planen, einzurichten. Das hatte viel mehr Spaß gemacht, als jetzt darin zu wohnen. Doch das würde sie niemals wirklich zugeben, auch nicht, dass sie sich insgeheim so manches Mal nach ihrem alten Haus sehnte, wo alles überschaubarer gewesen war, vertrauter. Heinz durfte niemals erfahren, dass sie sich in der Villa manchmal vorkam wie eine Besucherin. Er würde sie für undankbar halten. Aber so war es wirklich.
Sie stieg in ihren Sportwagen, dann fuhr sie in die Stadt, die Fahrzeit von gut einer Stunde würde sie gern täglich in Kauf nehmen. Sie liebte die Stadt und war in Hohenborn niemals so richtig heimisch geworden, auch wenn sie dort wer war.
Warum hatte man Heinz ausgerechnet in einer Kleinstadt ein Notariat zugewiesen und nicht in der Stadt?
Sie konnte sich eigentlich nur damit trösten, dass er in der Stadt, wo es viele Notare gab, nicht so weit gekommen wäre.
Je näher sie der Stadt kam, umso wohler fühlte Rosmarie sich.
Was würde sie als erstes tun?
In der Jupiter-Lounge einen Cappuccino trinken?
Versuchen, die Schuhe zu bekommen, die sie in der Vogue gesehen hatte und die ihr seither nicht mehr aus dem Sinn gingen?
Sollte sie versuchen, im »Figaro« einen Termin zu bekommen, um sich mal wieder ordentlich die Haare schneiden zu lassen? Da sie nichts von dem unverhofften Glück gewusst hatte, in die Stadt fahren zu können, hatte sie natürlich auch keine Termine machen können. Und die Mitarbeiter des »Figaro« waren Wochen im Voraus ausgebucht.
Der Friseur, das musste Priorität haben, und da er direkt neben dem Parkhaus war, in dem sie vorzugsweise parkte, würde sie einen Vorstoß wagen. Sie war dort bekannt, in erster Linie wegen der großzügigen Trinkgelder, die sie gab. Wenn man eine Möglichkeit sah, sie dazwischenzuschieben, würde man es tun.
Ihre Laune besserte sich noch mehr.
Und dann würde sie sich ein paar Outfits kaufen. Ihre Lieblingsverkäuferin hatte ein Händchen für das, was ihr stand und holte immer das Edelste für sie hervor.
Es ging ihr so richtig gut, dachte sie, als sie ein vor ihr fahrendes Auto überholte, was mit einem Wagen wie ihrem eine Leichtigkeit war. Er hatte allerhand PS unter der Motorhaube. Für sie war es wichtig, ihren Kindern stand danach nicht der Sinn, und deswegen waren sie auch nicht voller Bewunderung.
Sowohl Fabian als auch Stella benutzten die typischen Familienkutschen, und mehr noch, sie fuhren sie, bis sie nicht mehr durch den TÜV kamen.
»Mama, Autos sind Beförderungsmittel«, hatte Fabian einmal gesagt, als er sie dabei ertappt hatte, wie sie Autokataloge durchblätterte. »Schrecklich, dass es für dich Statussymbole sind.«
Ob nun Statussymbole oder nicht. Es gefiel ihr, sich immer wieder neue Autos kaufen zu können, und sie genoss es auch, dass ihr Umfeld voller Bewunderung war. Bis auf ihre Kinder … Nun ja, die Auerbachs und die von Roths konnte sie damit auch nicht beeindrucken, aber die waren eh anders gestrickt und begeisterten sich für andere Dinge, für Bilder, vor allem für Bücher, die sie verschlangen. Sie las nicht so gern, sah sich lieber einen Film im Fernsehen an, oder sie lud sich einen Film herunter, wenn sich in den Programmen nichts Gescheites sehen ließ.
Rosmarie nahm rasant die Ausfahrt, und dann musste sie hart bremsen, weil sich vor ihr ein Stau gebildet hatte. Nanu? Was war das denn? Das hatte es noch nie gegeben.
Tja, so war es halt im Leben. Es gab immer ein erstes Mal. Sie hatte zwar keinen Termin, doch die Zeitverzögerung war ärgerlich.
Es kam noch schlimmer.
Die Zufahrt zur Innenstadt war gesperrt, man musste eine Umleitung nehmen, was zur Folge hatte, dass sie auch nicht in dem von ihr bevorzugten Parkhaus parken konnte.
Sie kannte sich ganz gut aus, doch die Gegend, durch die sie fahren musste, war ganz und gar nicht ihre Rennstrecke.
Rosmarie fuhr erst einmal rechts ran, um ihr Navi zu aktivieren, das sie sonst nicht brauchte, weil sie sich auskannte.
Ehe sie das tat, entdeckte sie ein kleines Café, es war zwar nicht die Lounge, aber sie brauchte jetzt einen doppelten Espresso.
Das Cafè war erstaunlich gut besucht, meist von jungen Leuten, und der Espresso war hervorragend, da konnte man nicht meckern.
Rosmarie entspannte sich wieder, und sie wurde ganz aufgeregt, als sie mitbekam, wie sich zwei junge Frauen am Nebentisch darüber unterhielten, dass direkt um die Ecke ein cooler Schuhladen eröffnet worden war, der sogar Schuhe der Edelmarke »Belani« führte.
Das war doch genau das, was sie haben wollte, Schuhe von Belani!
Sofort bekam sie glänzende Augen, sie rief die Bedienung, bezahlte, und dann lief sie um die Ecke.
Sie entdeckte das Geschäft sofort, nicht nur das, es gab ringsum Läden, die Edelmarken führten.
Hier war ein neues Szeneviertel entstanden, und sie hatte bislang nichts davon mitbekommen, weil sie immer eingefahrene Wege gegangen war. Im Grunde genommen konnte sie jetzt froh sein, dass man sie umgeleitet hatte.
Sie las Markennamen, die sie kannte und liebte.
Sie würde in all diese Geschäfte hineingehen, vergessen waren Friseur und der ihr vertraute Modeladen.
Rosmarie wollte gerade das Schuhgeschäft betreten, als sie innehielt. Ihr stockte der Atem. Sie glaubte ihren Augen kaum zu trauen.
Es durfte nicht wahr sein!
Auf der anderen Straßenseite sah sie ihren Ehemann Heinz Rückert.
Und von wegen dringender Geschäftstermin.
Er war nicht allein!
An einer Seite war eine sehr junge, sehr attraktive Frau, die vom Alter her seine Tochter hätte sein können.
Die beiden schienen sehr vertraut miteinander zu sein.
Sie lachten. Das junge Ding schmiegte sich an ihn.
Und er hatte einen Arm um ihre Schulter gelegt.
Liebevoll?
Besitzergreifend?
Sie wusste es nicht, sie wusste in diesem Augenblick nur dass Heinz, von dem sie so etwas niemals für möglich gehalten hätte, sie betrog!
Was sollte sie jetzt tun?
Über die Straße laufen, ihn zur Rede stellen?
Dem jungen Ding sagen, dass sie es mit einem verheiratetem Mann trieb?
Sie blieb wie angewurzelt stehen, nicht fähig, sich zu bewegen, und als sie sah, wie die Beiden ein Juweliergeschäft betraten, war alles vorbei.
Rosmarie Rückert sank in sich zusammen, und wäre nicht geistesgegenwärtig eine junge Frau hinzugesprungen und hätte sie aufgefangen, dann wäre sie ganz böse auf dem Boden aufgeschlagen.
»Ist Ihnen nicht gut?«, erkundigte sich eine besorgte Stimme, »soll ich einen Notarzt rufen?«
Um Gottes willen!
Das nun gar nicht!
Rosmarie riss sich zusammen, diszipliniert war sie ja. »Danke für Ihre Hilfe, es ist alles in Ordnung, nur ein … nur ein kleiner Schwächeanfall.«
Die junge Frau glaubte ihr nicht, vermutlich weil sie trotz ihrer Schminke blass war.
»Ich helfe Ihnen gern. Soll ich Sie irgendwohin bringen?«, erkundigte sie sich.
Rosmarie bedankte sich, dann flüchtete sie in das Schuhgeschäft, ließ sich auf einen der Stühle fallen, bekam nicht mit, wie sich eine Verkäuferin nach ihren Wünschen erkundigte. Ja, sie bekam nicht einmal mit, dass genau diese Schuhe, das Objekt ihrer Begierde, direkt vor ihr in einer Vitrine standen.
*
Als sie sich wieder einigermaßen gefangen hatte, verließ Rosmarie den Laden wieder, ohne etwas wahrgenommen zu haben. Es stand ihr jetzt wahrhaftig nicht nach einem Schuhkauf. Sie hatte ganz andere Probleme. Ihr Ehemann betrog sie, und wie sicher er sich gefühlt hatte.
Klar, wenn man so lange verheiratet war wie sie, wenn man einander so gut kannte, dann wusste man um die Gewohnheiten des anderen.
Heinz konnte sich in diesem Viertel sicher fühlen, weil er wusste, dass ihre Rennstrecke ganz woanders lang.
Ein Zufall hatte sie hergeführt!
Oder war es Vorbestimmung gewesen? Hatte sie auf etwas vorbereitet werden sollen?
Sie fröstelte.
Würde er sie verlassen?
Ein solcher Gedanke war so unerträglich, dass sie ihn sofort verdrängte.
Sie musste mit jemandem reden, sie konnte jetzt unmöglich allein sein, sie war kurz davor, durchzuknallen.
Wann und wo hatte er diese Person kennengelernt?
Vielleicht durfte man ihr keinen Vorwurf machen, sondern ihm. Er hatte sie mit seinem Geld, seiner Großzügigkeit eingewickelt, und charmant konnte er auch sein, wenn er es wollte.
Ihr Sohn und ihre Tochter wohnten in der Stadt.
Gut, Fabian würde in der Schule sein, aber Ricky, ihre Schwiegertochter war daheim, und ihre Tochter Stella auch.
Sie besuchte sie kaum, wenn sie in der Stadt war, und jetzt, mit diesem Problem, sollte sie zu ihnen gehen?
Das ging nicht!
Welche Blamage war das denn?
Während sie zu ihrem Auto lief, begann Rosmarie zu schluchzen, dabei störte es sie nicht, dass ihre Wimperntusche verlief, sich einen Weg durch das Make-up bahnte.
Heinz betrog sie!
Seit wann ging das?
Es war warm, doch sie fröstelte. Als sie mitbekam, dass so manch mitleidiger Blick sie traf, riss sie sich zusammen, war aber doch froh, endlich bei ihrem Auto zu sein, stieg ein, und dann blieb sie erst einmal bewegungsunfähig sitzen.
Sie bekam das Bild von Heinz und dieser jungen Frau einfach nicht aus dem Kopf.
Natürlich war es nicht selten, dass ältere Männer sich urplötzlich für junge Frauen interessierten, aus ihrer Ehe ausbrachen, alles hinter sich ließen, um den sogenannten »zweiten Frühling« zu genießen.
Klar, das taten Männer, aber doch nicht ihr Heinz!
Wie dumm und überheblich sie doch gewesen war, und wie sicher sie sich gefühlt hatte. Schon wollte sie wieder anfangen zu weinen, als gegen ihre Fensterscheibe geklopft wurde.
Vor ihrem Auto stand ein junger Mann, sie öffnete das Fenster, er beugte sich höflich zu ihr herunter und erkundigte sich: »Fahren Sie weg? Wenn ja, dann würde ich gern Ihren Parkplatz übernehmen, ich kurve seit einer gefühlten Stunde hier herum. Durch dieses Chaos in der Stadtmitte ist alles durcheinander geraten.
Sie versprach, ihm den Parkplatz zu überlassen und setzte das auch sofort in die Tat um. Sie änderte an nichts etwas, auch wenn sie hier den ganzen Tag und die ganze Nacht verbringen würde.
Der junge Mann hatte von Chaos gesprochen. Er hätte das Wort bestimmt nicht so leichtfertig in den Mund genommen, wenn er wüsste, was Chaos im wahrsten Sinne bedeutete.
Bei ihr herrschte Chaos, über sie war ein Tsunami hereingebrochen.
Sie hatte sich noch niemals zuvor in ihrem Leben so leer, so ausgebrannt, so verloren gefühlt.
Ja, sie musste mit jemandem reden, der verständnisvoll war, mitfühlend und vor allem verschwiegen, und da fiel ihr nur eine einzige Person ein … Inge Auerbach, die Schwiegermutter ihrer Kinder.
Inge, zu der würde sie jetzt fahren. Sie waren zwar grundverschieden, aber sie wollte schließlich auch nicht mit Inge Auerbach als die »Pretty Sisters« auftreten, sondern sie brauchte eine Zuhörerin.
Sie fuhr ungeduldig die Umleitung zurück, doch als sie auf der Autobahn war, da gab sie Gas, viel Gas …