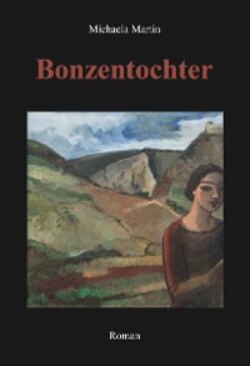Читать книгу Bonzentochter - Michaela Martin - Страница 7
Kapitel 1
ОглавлениеEs ist ein heißer Freitag im Juli 1978 und exakt 17 Uhr.
Ich habe es geschafft. Der Schriftsatz in Sachen Völlinger gegen Bauinvest mit 85 Seiten liegt fein säuberlich getippt vor mir auf dem Schreibtisch. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, ihn von meinem Schreibtisch auf den meines Chefs zu befördern.
Mein Chef heißt Ludwig Kains und geht gerade mal wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nach: Er telefoniert und das kann dauern.
Mir tut das Kreuz weh vom langen Sitzen und ich habe Kopfschmerzen vor Hunger. Ein Marmeladenbrötchen zum Frühstück, mehr habe ich heute noch nicht gegessen. Meine Laune droht zu kippen, wenn ich in den nächsten Minuten nicht etwas zu essen bekomme. Seit 10 Uhr sitze ich an der Schreibmaschine und tippe wie eine Wahnsinnige ohne Pause, damit ich diesen Schriftsatz vor Feierabend noch fertigbekomme. An Tagen wie heute bin ich von meinem eigenen Ehrgeiz überrascht, denn schließlich bin ich nur die Aushilfe in diesem Büro. Im normalen Leben bin ich Jurastudentin im 9. Semester an der Uni in München.
Kains telefoniert schon seit über einer Stunde, ich vermute mit seiner neuen Flamme. Ich drücke ihm und uns die Daumen, dass es die Dame ernst mit ihm meint. Denn ihr verdanken wir einen seit Wochen gutgelaunten Chef. Jeder von uns weiß es inzwischen, Rechtsanwalt Kains ist massiv auf Brautschau. Er ist 33 Jahre alt und seine Kanzlei läuft inzwischen so gut, dass er Frau und Kinder ernähren könnte, wenn er denn die Chance dazu bekäme. Sagt er jedenfalls und zwar auffallend häufig, deshalb haben wir Damen vom Büro den Verdacht, dass er ernsthaft ans Heiraten denkt.
Sybille Schnell heißt die Auserwählte. Sie ist 24 Jahre alt und von Hauptberuf Tochter, so scheint es meinen Kolleginnen und mir zumindest, da wir erstaunlich schnell darüber informiert worden sind, dass die Eltern der Auserwählten eine gut florierende Firma in München mit Niederlassungen in ganz Deutschland haben. Der Vater von Fräulein Schnell scheint eine Nase für neue Technologien zu haben, er ist in der Computerbranche tätig und hat damit sehr viel Geld verdient.
Was wir bereits wissen, ist, dass Rechtsanwalt Kains die klassische Rollenverteilung in der Ehe bevorzugt, das heißt, er ist fürs Geldverdienen zuständig und seine zukünftige Frau Gemahlin für die noch zu zeugenden Kinder und den Haushalt. Unsere weibliche Intuition sagt uns, dass Fräulein Schnell schon sehr schnell auf eine abgeschlossene Universitätsausbildung zugunsten einer zeitnahen Vermählung mit unserem Arbeitgeber verzichten wird. Wenn die Ehe schiefgehen sollte, wofür sämtliche Statistiken der Familiengerichte bundesweit sprechen, ist deshalb heute schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Scheitern auch dieser so hoffnungsvoll gestarteten Ehe einen Mann sehr viel Geld kosten wird, denn Fräulein Schnell wird mit einem abgebrochenen Studium kaum in der Lage sein, sich einmal selbst zu ernähren.
Da Sybille Schnell bei der Wahl ihrer Kleidung französische und italienische Designerware bevorzugt, wie mich meine mode- und frauenzeitschriftenkundige Kollegin Anita bereits aufklärte, ist davon auszugehen, dass der gewohnte Lebensstandard von Fräulein Schnell auch als Studentin sehr hoch und damit wohl auch sehr teuer ist.
Anita und ich gehen davon aus, dass Schnell Senior deshalb sehr daran interessiert ist, dass Tochter Sybille möglichst zügig in die Verantwortung unseres Chefs übergeht. Anders lässt sich nicht erklären, warum er praktisch täglich bei uns in der Kanzlei auftaucht. Eine Akte „Schnell Senior“ gibt es nicht bei uns, das wüssten wir. Nach 24 Jahren des Dauerkümmerns auf hohem Niveau hat auch ein innig liebender Vater das Recht, sich einen anderen Dummen zu suchen, der ihm die Rundumversorgung der verwöhnten Tochter abnimmt. Das versteht schließlich jeder, zumindest all diejenigen, die in der Pflicht zu regelmäßigen Unterhaltszahlungen stehen.
Anita und ich verabscheuen Männer, die sich von ihren zukünftigen Ehefrauen vor der Hochzeit, zu einem Zeitpunkt, während dessen wir Frauen erfahrungsgemäß hirnlos auf Wolke sieben schweben, Blanko-Verzichtserklärungen unterschreiben lassen. Frauenloyalität wird bei uns im Büro großgeschrieben. Aber in diesem speziellen Fall drücken wir unserem Chef die Daumen, dass es ihm gelingt, Vater Schnell wieder in die Verantwortung zu nehmen, falls auch diese hoffnungsvoll gestartete Ehe vor dem Scheidungsrichter landet.
Unsere Ängste um das finanzielle Wohlbefinden unseres Chefs haben einen Grund. Allzu präsent ist uns das Schicksal von Rechtsanwalt Heldrich, einem befreundeten Kollegen von Kains, der seine Kanzlei schloss, nachdem er bemerkte, dass jede seiner beiden Sekretärinnen am Ende eines Monats mehr Geld in der Tasche übrig hatte als er selbst.
Er schloss die Pforten seiner Kanzlei mit den Worten: „Ich habe keine Lust, mir zwölf Stunden am Tag das Hirn zu zermartern, damit meine Frau den Rest ihres Lebens auf meine Kosten von der Selbsterfahrungsgruppe zum Friseur, zur Kosmetik, zum Fitnesskurs und nicht zuletzt zum Kochkurs der Volkshochschule pilgert, anstatt einer geregelten Arbeit nachzugehen!“
Unseren Vorwurf, dass sein Verhalten verantwortungslos sei, weil seine Frau damit der Sozialhilfe anheimfallen werde, konterte er gelassen: „Jetzt kann meine Frau endlich die Karriere machen, die sie angeblich zugunsten der Familie vor 20 Jahren geopfert hat. Viel Spaß dabei!“
Warum die Ehe von Heldrich gescheitert ist, wissen wir nicht. Nachdem in Deutschlands Großstädten inzwischen fast schon jede zweite Ehe geschieden wird, liegt er im Trend. Sein konsequenter Ausstieg aus dem Berufsleben allerdings gibt Anlass zur Sorge. Sollte es Schule machen, dass Deutschlands geschiedene Männer lieber in die Arbeitslosigkeit wandern, als Unterhalt zu zahlen, dann hat das nicht nur für die Ehefrauen finanzielle Auswirkungen, sondern auch für das Personal. Wenn zukünftig auch nur jeder dritte selbstständige Anwalt oder Steuerberater seine Kanzlei nach seiner Scheidung schließt, dann tummelt sich demnächst ein Heer von arbeitslosen Sekretärinnen beim Arbeitsamt. Verständlich also, dass meine Kollegin und ich schon im eigenen Interesse hoffen, dass unser Chef durch einen guten Ehevertrag sicherstellt, das Vater Schnell im Falle einer Trennung für seine Tochter aufkommt.
Von Büroorganisation hat Kains ganz eindeutig keine Ahnung. Auf seinem Schreibtisch herrscht das kreative Chaos, obwohl wir ihm täglich die Akten bestens aufbereitet vorlegen. An uns Bürodamen liegt es eindeutig nicht, dass er immer auf der Suche nach der passenden Akte ist.
Als Jurist ist er genial. Ich habe von ihm mehr gelernt als von allen Professoren an der Uni zusammen. Er hat die Gabe, selbst sehr komplizierte Fälle so strukturiert darzustellen, dass jeder sie verstehen kann, die Mandanten, die Mitarbeiter und vor allem auch die gegnerischen Anwälte und die Richter.
„Wenn alle verstehen, worum es geht, dann tut man sich einfach leichter, gemeinsam eine Lösung des Problems zu finden“ lautet sein Credo und es scheint viel Wahres dran zu sein, denn der Erfolg gibt ihm Recht.
Tatsache ist, dass ich erst seitdem ich bei Kains arbeite, fest davon überzeugt bin, dass ich mit Jura das richtige Studium gewählt habe. Nach zwei Semestern Professorenkauderwelsch hatte ich eine ernsthafte Krise. Ich war nahe daran, mein Studium hinzuwerfen. Die Professoren hatten mich so weit, dass ich davon überzeugt war, zu dumm für die Juristerei zu sein.
Mein Vater ist gelernter Schlosser, meine Mutter hat nach dem Krieg Schneiderin gelernt. Wenn es mir gelingt, das Studium erfolgreich zu beenden, bin ich der erste Akademiker überhaupt in unserer Familie. Das erfüllt meine Eltern zwar mit Stolz, aber mein Vater hegt auch ein gewisses Misstrauen, ob sich seine Investitionen in mein Studium einmal amortisieren werden. Er ist ein glühender Verfechter der Hausfrauenehe. Deshalb geht er davon aus, dass seine drei Töchter einmal für Kinder, Küche und Kirche, die drei klassischen „K“ eben, zuständig sein werden, wie sich das für eine normale Frau der Mittelschicht in den siebziger Jahren in Deutschland gehört.
Als ich meine Eltern davon in Kenntnis setzte, dass ich nach dem Abitur beabsichtige zu studieren, fragte mich mein Vater leicht irritiert: „Was hast du eigentlich davon, wenn du Akademikerin bist und später mit all deinen akademischen Würden ausschließlich in Alete rumrührst?“
Ich gehe einmal wohlwollend davon aus, dass er diesen Spruch nicht böse meinte. Er sprach nur das offen aus, was die meisten Männer in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts über die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft dachten.
Mein Vater hat in den 20 Jahren seiner Ehe, umgeben von vier Frauen, schon häufiger feststellen müssen, dass er in familiären und gesellschaftspolitischen Dingen eine Minderheitsmeinung vertritt. Er hat inzwischen gelernt, dass er gut beraten ist, sich Mehrheitsmeinungen im Hause zu beugen. Das heißt natürlich nicht, dass er seine Meinung korrigiert. Es zeigt nur, dass er darauf verzichtet, sie zu Hause durchzusetzen, weil er nach einem 12-Stunden-Arbeitstag zu Hause seine Ruhe will. Es ist ihm schlicht auch nicht so wichtig, ob seine Töchter studieren oder eine nichtakademische Ausbildung haben. Hauptsache sie sind glücklich und er hat seine Ruhe.
Meine Mutter ist eine gute Verbündete ihrer Töchter. Sie ist der festen Überzeugung: „Eine Frau kann gar nicht genug lernen, wenn sie ein eigenverantwortliches, selbstständiges Leben führen will, egal in welcher Rolle“.
Ihr Credo ist: „Wissen ist Macht“.
Meine Mutter ist Jahrgang 1930. Sie war gerade neun Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg begann. Ihre Heimatstadt Köln gehört zu den Städten in Deutschland, die am stärksten zerstört wurden. Als der Krieg 1945 zu Ende war, war sie 15 und hatte die Schule bereits verlassen. Ihr Vater schickte sie in ein Kölner Kaufhaus zur Schneiderlehre mit den Worten: „Da lernst du was Gescheites, denn Kleidung brauchen die Menschen immer!“ Während ihrer Schulzeit saß sie öfter im Bunker als auf der Schulbank. Ein Leben lang litt sie unter ihrer schlechten Schulausbildung. „Was kann ich schon? Ein bisschen rechnen und für einen Brief an die Verwandtschaft reicht es gerade auch noch, aber damit hört es schon auf.“
Ihren Beruf hat sie gehasst, deshalb ist es ihr heute umso wichtiger, dass ihre drei Töchter einmal die Möglichkeit haben, einen Beruf auszuüben, den sie lieben und der sie auch noch gut ernährt.
Während unsere Mutter eine Befürworterin einer möglichst umfassenden Schulausbildung ist, vertritt unser Vater die gegenteilige Meinung: „Das Leben lehrt die Menschen die wirklich wichtigen Dinge, nicht die Schule.“
Diese spielt bei ihm eine eher untergeordnete Rolle. Er leidet auch nicht darunter, nur einen Volksschulabschluss zu besitzen. Er ist heute ein erfolgreicher Unternehmer, auch ohne eine höhere Schulausbildung.
Vor dem Hintergrund dieser beiden unterschiedlichen Erziehungsmodelle ist es zu verstehen, dass mein Vater seine Investition in meine Ausbildung übersichtlich gestalten möchte. Als ich mich im September 1972 von ihm verabschiedete, um zum Studieren nach München zu ziehen, stellte er klar: „Ich hoffe, du weißt, was du tust. Denk daran, ich bezahle nur eine Ausbildung. Solltest du auf die Idee kommen, das Studium abzubrechen, musst du selber sehen, wie du weiterkommst.“
Ich weiß zwar nicht, ob er seine Drohung wahr gemacht hätte, aber zuzutrauen wäre es ihm. Dank der motivierenden Arbeit bei Rechtsanwalt Kains muss ich allerdings die Finanzierungsbereitschaft meines Vaters für ein neues Studium und damit auch die Belastbarkeit des Familienfriedens nicht testen.
Also verdanke ich es Kains, dass ich die Krise überwunden habe und kurz vor dem Examen stehe. Die Juristerei macht mir inzwischen sogar richtig viel Spaß. Nun besteht nur noch die Gefahr, dass ich mehr Zeit in der Kanzlei verbringe als in der Uni.
Aber jetzt ist endgültig Schluss für heute, schließlich ist es Freitag und schon 17 Uhr.
Ich habe weder Zeit noch Lust zu warten, bis mein verliebter Arbeitgeber sein Gespräch mit seiner Herzallerliebsten endlich beendet. Das kann bekanntlich dauern. Dieses Mal bin ich nicht bereit, Rücksicht zu nehmen. Aber den Schriftsatz muss ich noch loswerden, damit er weiß, dass ich pünktlich mit allem fertig geworden bin. Ich bin wild entschlossen, innerhalb der nächsten fünf Minuten das Büro zu verlassen. Da hilft nur eines: Unter Missachtung aller Anstandsregeln gehe ich, ohne zu klopfen, in sein Büro und lege den Schriftsatz vor ihn auf den Schreibtisch, allerdings ringe ich mir ein entschuldigendes Lächeln ab.
Offensichtlich ist Kains viel zu verliebt, um an diesem Tag überhaupt jemandem böse zu sein. Ganz im Gegenteil: Als er feststellt, dass der Schriftsatz in Sachen Völlinger fertig getippt vor ihm liegt, sieht er mich strahlend an und hebt seinen linken Daumen nach oben, was ich eindeutig als Zeichen der Anerkennung deute. In der rechten Hand hält er den Telefonhörer, aus dem eine weibliche Stimme schallt.
Kains strahlt glücklich. Selbstbewusst bilde ich mir ein, dass dieses Lächeln auf mein Konto geht und in diesem Moment nicht Fräulein Schnell die Ursache für sein Wohlbefinden ist. Wenn der Chef glücklich ist, dann sind es die Angestellten bekanntlich auch. Deshalb lächele ich fröhlich zurück, bevor ich fluchtartig das Büro verlasse. Auf mich wartet ein wunderbares Wochenende. Ich habe mir fest vorgenommen, drei Tage lang nur zu faulenzen.
Die freien Tage habe ich mir redlich verdient, denn die vergangene Woche war verdammt hart. Anita, die hauptamtliche Sekretärin hat sich eine Woche Urlaub genommen. Sie ist eine wahre Meisterin der Urlaubsplanung. Ihr stehen 30 Tage Urlaub im Jahr zu, aber sie schafft es in manchen Jahren locker aus den sechs Wochen acht Wochen zu machen, indem sie jeden Feiertag optimal für ihre Urlaubsplanung nutzt.
Obwohl wir anderen Sekretärinnen unter Anitas Urlaubsplanung leiden, gönnen wir ihr die Freizeit. Sie ist eine wirklich tolle Kollegin. Sofern sie an ihrem Arbeitsplatz ist, ist sie sehr fleißig, hilfsbereit und loyal. Anita ist der Profi unter uns im Büro. Sie managt nicht nur ihre Kolleginnen und die Mandanten der Kanzlei, sondern hat auch ihren Chef fest im Griff. Sie tippt wie eine Weltmeisterin und bereitet nebenbei einfache Fälle so vor, dass Kains sie nur noch unterzeichnen muss. Dabei bleibt sie auch im schlimmsten Stress immer hilfsbereit und freundlich. Sie ist die Seele des Büros, alle lieben sie, alle verzeihen ihr die etwas eigensinnige Urlaubsplanung.
Kains wäre ohne Anita am Anfang seiner Karriere ein armer Hund gewesen, denn von den Abläufen eines Kanzleibetriebs hatte er keine Ahnung. Unser Chef gibt ehrlich zu, dass schon so simple Sachen wie die korrekte Anlage einer Akte, Wiedervorlagesysteme und Formulare für ihn absolutes Neuland waren.
Anita arbeitet nur 30 Stunden in der Woche, was viel zu wenig ist, um die ganze Arbeit zu schaffen. Deshalb beschäftigt Kains noch zwei Aushilfen, die Anita entlasten. Eine davon bin ich, Ramona heißt die andere. Ramona arbeitet montags und mittwochs und ich arbeite dienstags und donnerstags. Das finde ich sehr angenehm, weil ich so auch einmal in den Genuss eines verlängerten Wochenendes komme.
Wenn Anita allerdings Urlaub nimmt, arbeite ich voll, meist 40 Stunden und mehr in der Woche. Ramona hilft, wo sie kann. Leider hat sie selten mehr Zeit als drei Tage in der Woche. Sie studiert Zahnmedizin, was zeitaufwendiger zu sein scheint als Jura. Hinzu kommt natürlich, dass Ramona und ich keine Profis sind und deshalb für die Erledigung der meisten Angelegenheiten deutlich länger brauchen als unsere pfiffige Kollegin Anita. Außerdem müssen wir Kains auch viel häufiger um Rat fragen. Das ist für uns alle lästig. Auf dem Weg zur U-Bahn bin ich wie erlöst. Die Verantwortung für das Büro hat in der letzten Woche doch sehr an meinen Nerven gezerrt. Ich freue mich, ja es macht mich sogar ein bisschen stolz, dass ich alles so gut geschafft habe. Anita kann wirklich nicht meckern. Es ist nichts liegengeblieben. Am Montag findet sie ein aufgeräumtes Büro vor, genau so, wie sie es verlassen hat.
Ich habe Glück: Meine Bahn, die U6, fährt gerade in den Bahnhof ein. Ein paar Sitzplätze sind noch frei, ich habe die Wahl. Eine fünfjährige, leidvolle Beziehung zur Münchner U-Bahn hat mich gelehrt, mir die Fahrgäste erst einmal genau anzusehen, bevor ich mich neben sie setze. Es ist Sommer und heute ist es sehr heiß, mindestens 30 Grad im Schatten, in der U-Bahn gefühlte 35. Die Bahn hat keine Klimaanlage, die Menschen schwitzen alle still vor sich hin. Meine überempfindliche Nase zwingt mich zu einer sorgfältigen Auswahl meines Sitznachbarn, wenn ich die nächsten 30 Minuten ohne innere Qualen überleben will. Meine Laune kann in Sekundenschnelle auf den absoluten Tiefpunkt sinken, wenn meine Nase den Geruch von Schweiß, Zigaretten oder Knoblauch ertragen muss. Bin ich dann erst einmal schlecht gelaunt, kann nichts und niemand meine Stimmung mehr heben. Für den Rest des Tages leide ich dann unter einer undefinierbaren Abneigung gegen alle Menschen, unter der auch meine Familie zu leiden hat. Dieses Risiko will ich heute auf keinen Fall eingehen.
Mit dem Blick einer routinierten U-Bahn-Fahrerin suche ich mir einen gepflegten Mann um die 40 Jahre aus. Im schlimmsten Fall dringt in den nächsten Minuten ein Hauch von Aftershave in meine Nase, aber damit kann ich leben. Auch von gegenüber droht keine Gefahr. Dort sitzen zwei Damen um die siebzig, herausgeputzt in gepflegten bayerischen Loden, offensichtlich auf dem Weg zum nächsten Damenkränzchen. Gegen Lavendel und Kölnisch Wasser habe ich nichts.
Ich setze mich und nehme einen vorsichtigen Atemzug. Ich hatte recht, der junge Mann schwitzt nicht und riecht auch nicht nach Knoblauch oder kaltem Zigarettenrauch, nicht einmal eine Welle von Aftershave erreicht meine gequälte Nase. Ich habe also allen Grund zu entspannen und mich auf das kommende Wochenende zu freuen.Starten werde ich mit einer Badewannenorgie. Ich werde mir ein lauwarmes Schaumbad gönnen, ein Glas Weißwein und die Zeitung werden die einzigen Zeugen meiner Entspannung sein. Kein Freund und auch keine kleine Schwester werden mich heute um mein Vergnügen bringen. Beide haben angekündigt, dass sie nicht vor acht Uhr abends zu Hause sein werden. Die kleine Schwester ist beim Sport, mein Freund arbeitet länger und will danach in der Stadt einkaufen gehen. Er ist nicht nur für unsere Versorgung mit Nahrungsmitteln zuständig, sondern auch der Koch der Familie. Er kocht sehr gerne und meistens auch gut. Jedenfalls besser, als ich es kann, deshalb hat er von Beginn unserer Beziehung an diese ehrenvolle Aufgabe übernommen. Freiwillig, wohlgemerkt.
Die U-Bahn setzt sich in Gang und schon ein paar Sekunden später fahren wir in die Tunnelröhre ein. Es gibt nichts mehr zu sehen außer der langweiligen, hässlichen Tunnelwand. Die Fahrgäste sind gezwungen, ihren eigenen Gedanken nachzugehen. Meine Gedanken kreisen noch immer um den Prozess Völlinger gegen die Firma Bauinvest. Die dreißigminütige Heimfahrt von der Kanzlei quer durch die Stadt nach Hause in den Münchner Norden tut mir meist gut. Ich kann dabei sehr gut abschalten. Bis ich zu Hause ankomme, ist der Kopf frei für die Familie, das bekommt allen gut. Heute gelingt mir das allerdings nicht wirklich.
Der Fall Völlinger beschäftigt die Kanzlei schon seit Monaten und liegt mir fast genauso lange auf der Seele. Einmal abgesehen davon, dass alle Schriftsätze in dieser Sache geradezu unverschämt lang sind, wie die 85 Seiten von heute wieder einmal bewiesen haben, ist der Fall auch noch tragisch, denn es geht im wahrsten Sinne des Wortes um das wirtschaftliche Überleben einer jungen Familie. Wir vertreten die Gegenseite, den Bauinvestor, was die Sache nicht leichter für mich macht. Seit Wochen drückt mich immer wieder das schlechte Gewissen, wenn dieser Fall auf den Tisch kommt, obwohl ich an dem Unglück der Familie natürlich völlig unschuldig bin. Meinem Arbeitgeber geht es wohl ähnlich, denn er drückt sich um die Schriftsätze so lang er kann. Gestern aber musste er ran, denn heute läuft die Frist ab. Wenn er also nicht Gefahr laufen will, den Prozess zu verlieren, muss er den Schriftsatz heute noch in den Nachtbriefkasten werfen. Ich hoffe, er vergisst es nicht.
Der Fall ist schnell erzählt: Die junge Familie Völlinger hat von unserer Mandantin, der Firma Bauinvest, eine Eigentumswohnung in einem schönen Münchener Altbau gekauft: 4 Zimmer, Küche, Bad, in Sendling, direkt am Harras, gar nicht weit von unserer Kanzlei.
Sechs Monate nach Bezug der Wohnung ist die Familie fluchtartig ausgezogen. Es herrscht Schimmelalarm. Schimmel, soviel weiß inzwischen jedes Kind, ist gesundheitsgefährdend. Schimmel an Neu- oder Altbauten kann zwei Ursachen haben und darin liegt das Problem. Völlingers werfen unserer Mandantin vor, bei der Sanierung des Gebäudes geschlampt zu haben, weil sie an der falschen Stelle gespart haben. Statt eines hochwertigen diffusionsoffenen Dämmmaterials soll preisgünstiges Styropor zur Dämmung der Außenwände verwendet worden sein.
Unsere Mandantin weist alle Schuld von sich und geht zur Gegenoffensive über. Sie behauptet, dass sich der Schimmel deshalb gebildet hat, weil die junge Familie Geld sparen wollte und deshalb kaum geheizt hat und selten lüftete. Bauinvest beruft sich darauf, dass nachweislich in 95 von 100 Fällen die Bewohner selbst schuld an der Schimmelbildung sind. Sie trägt weiter vor, dass es doch sehr verwunderlich ist, dass sich bisher außer der Familie Völlinger kein anderer Bewohner des Hauses über Schimmel beschwert hat. Tatsache ist, dass alle Familienmitglieder krank sind. Sie leiden seit Wochen an einem lästigen Reizhusten. Die kleinen Kinder im Alter von vier und sechs Jahren bekommen schon bei der kleinsten Anstrengung keine Luft. Der Kinderarzt hat eine Art Asthma im Anfangsstadium diagnostiziert, wahrscheinlich verursacht durch Umweltschäden. Die Untersuchungen laufen noch.
Herr und Frau Völlinger leiden an Hautreizungen, die sie verzweifeln lassen. Bis heute hat kein Arzt ein Mittel gegen den ständigen Juckreiz gefunden. Völlingers haben sich inzwischen an jeder Stelle ihres Körpers blutig gekratzt. Der arme Herr Völlinger sieht mit seiner blutig gekratzten Nase und den geschwollenen Augen inzwischen aus, als hätte er sich mit Max Schmeling einen Boxkampf geliefert. Die ganze Familie tut mir aufrichtig leid. Vor allem, da Völlingers inzwischen pleite sind. Das Schicksal der jungen Familie stand sogar schon in der Presse im Lokalteil der Abendzeitung.
Damit kam etwas Schwung in die ganze Angelegenheit.
Einen Tag nach dem Erscheinen des Artikels hat der Vorstand der Firma Bauinvest persönlich bei Kains angerufen. Er wollte wissen, ob man die Sache nicht beschleunigen könnte, schon wegen der schlechten Presse. Kains, dem die Angelegenheit auch schwer im Magen liegt, regte einen außergerichtlichen Vergleich an, was allerdings mit Kosten verbunden gewesen wäre.
Davon wollte der Vorstand nichts wissen: „Dann sollen sie doch klagen. Wenn sie ihr Geld zum Fenster rauswerfen wollen, dann ist das ihre Sache. Der Prozess kommt die teuer zu stehen, die werden sich noch wundern!“
Der zaghafte Versuch von Kains, den Vorstand zum Einlenken zu bewegen, indem er auf die imageschädigende Wirkung des Zeitungsartikels hinwies, wischte dieser mit den Worten weg: „Ach was, nichts ist so alt wie Presse von gestern. Es bleibt dabei, wir zahlen nicht, sollen sie doch klagen!“
Recht haben und Recht bekommen ist offensichtlich zweierlei, so viel kann man bei diesem Prozess lernen. Diese Erkenntnis ist schmerzlich, aber wahr.
Inzwischen hat die U-Bahn den Tunnel verlassen, ab Studentenstadt Freimann fährt sie wieder oberirdisch. Noch zwei Haltestellen und ich bin zu Hause, Kieferngarten ist meine Hausstation. Es wird also Zeit, dass ich meine trüben Gedanken beiseiteschiebe und mich den wirklich schönen Dingen des Lebens zuwende, dem geruhsamen Wochenende, welches unmittelbar vor der Türe steht. Der Wetterbericht hat fantastisches Wetter vorausgesagt. Während ich meine Tasche und Jacke zusammenpacke, denke ich: Heute kann kommen, was will, mich erschüttert nichts mehr. Schaumbad, ich komme!
Ich betrachte mein Spiegelbild in der Fensterscheibe der U-Bahn. Als ich mir gestern Abend die Zähne geputzt habe, habe ich mit Schrecken festgestellt, dass sich unzählige kleine Mundfalten über meiner Oberlippe gebildet haben. Außerdem macht sich zwischen meinen Augenbrauen eine tiefe Furche breit, beides verleiht meinem Gesicht einen griesgrämigen, abweisenden Ausdruck. Man wird im Alter nicht schöner, so viel steht fest. Dass der Verfall bei mir schon mit 25 Jahren anfängt, beunruhigt mich sehr. Ich habe Angst, dass ich mit 30 Jahren aussehe wie Mutter Theresa nach ihrem jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz für die Armen in Indien. Um diesem Schicksal zu entgehen, muss ich dem sichtbaren Verfall unverzüglich entgegenwirken, das habe ich gestern Abend noch entschieden. Den Anfang macht heute eine Gesichtspackung, die nach einer zehnminütigen Einwirkzeit eine deutlich sichtbare Glättung der beanspruchten Haut bewirken soll. Ich hoffe, die Packung hält, was die Werbung verspricht.
Die letzten zwölf Monate sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ich habe viele Überstunden im Büro gemacht. Ich arbeite gerne, denn erstens macht mir mein Job Spaß und zweitens können wir das Geld nach dem Umzug aus dem Appartement in der Studentenstadt in eine größere Zweizimmerwohnung in Kieferngarten gut gebrauchen. Der Umzug hat Geld gekostet und die Miete ist auch viel teurer. Es ist eine für Münchner Verhältnisse zwar sehr faire Miete, aber trotzdem für zwei Studenten und eine Schülerin, die auf BAföG oder Unterhaltszahlungen vom Vater angewiesen sind, sehr teuer.
So kurz vor dem Examen fordert die Uni ihren Tribut. Wenn ich nicht Gefahr laufen will, durch das erste Examen zu rauschen, muss ich mein Lernpensum drastisch steigern und samstags zu den Klausurenkursen gehen, was mehr als lästig ist. Immer wenn ich auf dem Weg zur Uni bin und den vielen gutgelaunten Menschen auf der Leopoldstraße begegne, tue ich mir selbst aufrichtig leid. Ich bedauere mich, weil ich die nächsten fünf Stunden in einem muffigen Hörsaal sitzen muss und mein Hirn mit der Lösung eines Falles quäle, der in der Regel nur einen sehr niedrigen Unterhaltungswert hat. Die Lösung muss sauber unter den einschlägigen Gesetzestext subsumiert, soll heißen, begründet werden, und zwar brillant formuliert auf etwa zehn Seiten. Leider hat sich inzwischen herausgestellt, dass meine Handschrift mein größter Feind ist. Zwei Klausuren wurden mit „nicht ausreichend“ bewertet, weil die Prüfer meine Schrift nicht lesen konnten und die Arbeit deshalb erst überhaupt nicht korrigiert haben. In diesen Momenten hasse ich mein Studium. Aber es hilft ja alles nichts, da muss ich die nächsten Monate noch durch. Nach dem Examen wird alles besser. Keine Vorlesungen, keine Klausuren.
Seit über einem Jahr wohnt Sylvie, meine zehn Jahre jüngere Schwester, bei uns in München. Mein Freund Klaus und ich haben zwei Jahre lang in einem schönen Ehepaar-Appartement in der Studentenstadt Freimann gewohnt, obwohl wir nicht verheiratet sind. Es war ein glatter Glücksfall, dass diese Wohnung gerade frei stand, als Klaus und ich auf der Suche nach einer Bleibe waren. Statt zwei getrennten Appartements bot uns die nette Frau von der Studentenstadtverwaltung diese schöne kleine Zweizimmerwohnung an. Natürlich haben wir sofort zugegriffen und waren sicher, dass wir in der Wohnung bis zum Ende unseres Studiums bleiben würden. Man darf drei Jahre in der Studentenstadt wohnen. Damit möglichst viele Studenten in den Genuss einer günstigen Wohnung kommen, ist die Wohnzeit begrenzt. Ich finde das durchaus gerecht und deshalb richtig. Ich habe das Leben in der Studentenstadt geliebt. Die Wohnung hatte zwei Zimmer, plus kleines Duschbad. Groß genug für zwei Personen, leider zu klein für drei, besonders wenn eine Person erst 14 Jahre alt ist und spätestens ab 22 Uhr schlafen sollte. Die Lage der Studentenstadt ist fantastisch. Direkt am Englischen Garten gelegen, der Aumeister, einer der traditionsreichsten Münchner Biergärten, nur einen Steinwurf entfernt, keine fünf Minuten mit der U-Bahn zur Uni. Wir hatten viel Spaß in der Studentenstadt. Es war immer etwas los. Es gab mehrere Discos und eine nette Bar im obersten Stock des Hanns-Seidel-Hauses, mit einem traumhaften Blick über ganz München.
Als Sylvie letztes Jahr nach München zog, lebten wir noch rund fünf Monate zu dritt in dem kleinen Appartement in der Studentenstadt. Es wurde uns aber sehr schnell klar, dass das auf Dauer nicht gut gehen konnte. Wenn drei Leute lernen müssen, dann braucht jeder einen Schreibtisch. Dafür war die Wohnung aber viel zu klein, also sind wir auf die Suche nach einer neuen, größeren Wohnung gegangen. Weil die meisten unserer Freunde im Münchner Norden oder Schwabing leben, suchten wir schwerpunktmäßig eine Wohnung in diesen Stadtbezirken. Wir hatten Glück. Eine kleine Annonce im Nordanzeiger klang vielversprechend. Die Zweizimmerwohnung in Freimann in einem Zweifamilienhaus in einer ruhigen Seitenstraße ist fast doppelt so groß wie unsere alte und wie für uns gemacht. Sie hatte nur den Nachteil, dass die Vermieter im Erdgeschoss des Hauses lebten, was für mich nach ständiger Kontrolle roch. Aus taktischen Gründen hatte ich der Vermieterin am Telefon nicht gebeichtet, dass wir ein unverheiratetes Studentenpaar mit kleiner Schwester waren. Konstellationen dieser Art waren in den siebziger Jahren bei Münchner Vermietern nicht sehr gefragt, was ich sogar verstehen kann. Dennoch lief alles ganz anders ab als gedacht.
Unsere zukünftige Vermieterin, Frau Braun, begrüßte uns so herzlich, als hätte sie ihr Leben lang auf uns gewartet. Eine ungewöhnliche, offene Frau, die meine Vorurteile über die konservativen Münchner schon bei der ersten Begegnung über den Haufen warf. Offensichtlich hatte sie sofort Gefallen an meiner Schwester gefunden. Ein paar Wochen später gestand sie mir, dass sie Sylvie an ihre Tochter Marie erinnert. Nach einer halben Stunde waren wir uns über die Konditionen einig und vier Wochen später zogen wir in unser neues Heim. Seitdem leben wir zu dritt in unserem neuen Zuhause in München Freimann, zwei Haltestellen von der Studentenstadt entfernt.
Bis heute läuft unser Zusammenleben besser als gedacht, Es ist alles eitle Harmonie, was ich uns nicht zugetraut hätte, wenn ich ehrlich bin. Sylvie hat ihr eigenes Zimmer, in dem sie tun und lassen kann, was sie will. Die Wohnung ist wunderbar hell und die Vermieter sind sehr nett.
Jetzt hätte ich vor lauter Träumereien fast meine Haltestelle verpasst! Es ist wirklich nicht zu glauben, dass mich die Aussicht auf zwei Stunden Einsamkeit in der Badewanne mit Gesichtspackung, etwas Musik und Wein, so ins Träumen versetzen kann, dass ich das Aussteigen vergesse. Mit mir ist es wirklich weit gekommen. Meine Anforderungen an ein bisschen Glück sind mittlerweile sehr bescheiden. „Nächster Halt: Kieferngarten. Endstation!“ schallt es in gewohnt bayerisch-nasalem Dialekt aus dem U-Bahnlautsprecher, als ich aussteige.
Drei Minuten später stehe ich vor unserer Gartentüre. Ich nehme die Post aus dem Briefkasten und klemme sie mir unter den Arm. Wie jeden Tag fängt danach die Suche nach dem Haustürschlüssel in meiner Handtasche an. Die Tasche ist schick und auch praktisch, weil sie sehr groß ist, nur findet man leider nichts in ihr. Ich wühle mit der rechten Hand in meiner Tasche, die ich mir über die Schulter gehängt habe, als mir die Hälfte meiner Post auf den Boden fällt.
„So ein Mist!“, stöhne ich laut auf und suche hektisch nach meinem Haustürschlüssel. Ich bin kurz davor, den gesamten Tascheninhalt auf dem Boden auszuleeren, als meine Finger endlich die metallische Kühle meiner Schlüssel spüren. Inzwischen habe ich auch einen starken Druck auf meiner Blase. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber sobald ich unser Toilettenfenster von außen sehe, muss ich ganz dringend. Es ist zwar albern, aber wahr: Immer, wenn ich auf unser Haus zugehe, bemühe ich mich mittlerweile geradezu zwanghaft, nicht zu unserer Wohnung hinaufzusehen, aus lauter Angst, dass mein Blick unser Badezimmerfenster streift, bevor ich meinen Schlüssel in der Hand halte. Es gibt nämlich nichts Unwürdigeres, als wenn man dringend auf die Toilette muss und deshalb mit verschränkten Beinen leicht zappelnd vor seiner verschlossenen Gartentüre steht, weil man minutenlang nach seinem Schlüssel sucht. Diese erniedrigende Situation habe ich in meinem Leben schon mehrfach durchlebt und werde deshalb fast panisch, wenn ich vor einer verschlossenen Haustüre stehe und sich meine Blase meldet.
Als ich den Schlüssel endlich in der Hand habe, bücke ich mich, um die heruntergefallene Post aufzuheben. Ich will sie mir gerade wieder unter den linken Arm klemmen, als ein weißes DIN A4 Blatt zu Boden flattert.
„Das gibt es doch nicht, jetzt langt‘s mir aber!“, fluche ich.
Langsam werde ich hektisch, denn der Druck meiner Blase steigt beständig. Ich hebe das Blatt auf und registriere dabei, dass auf dem Blatt Papier schwarze Buchstaben aufgeklebt sind.
„Ich hasse Werbung!“ Entnervt stöhne ich auf und unternehme gleichzeitig einen weiteren Versuch, die gesamte Post unter meinem linken Arm zu deponieren, damit ich endlich mit der rechten Hand die Haustüre aufsperren kann. Dieses Mal klappt es auch und kurz darauf stehe ich in unserer Wohnung. Ich werfe die Post auf den Küchentisch, die Tasche auf den Stuhl und renne ins Bad. Gerettet, in letzter Sekunde.
Der Griff zum Wasserhahn der Badewanne ist mühelos von der Toilette aus zu erreichen. Mechanisch lasse ich Wasser in die Badewanne ein. Als mir der Geruch des Badesalzes in die Nase steigt, ist der Ärger verflogen. Jetzt kommt der gemütliche Teil des Tages, daran kann mich nichts und keiner mehr hindern.
Bevor ich in mein Dampfbad steige, höre ich gewohnheitsmäßig den Anrufbeantworter ab. Klaus hat angerufen. Er informiert mich darüber, dass er in seiner Mittagspause Lebensmittel eingekauft hat, damit ist unsere Versorgung für das Wochenende gerettet. Erleichtert denke ich seit Langem wieder einmal: „Er ist der Beste!“
Klaus und ich haben uns vor fünf Jahren an der Uni kennengelernt. Am Tag der Einschreibung standen wir nebeneinander in einer Menschenschlange. Hunderte von Studenten vor uns, die alle dasselbe wollten: den Immatrikulations-Stempel. In Anbetracht der Länge der Schlange konnte es leicht Stunden dauern, bis ich an die Reihe kommen sollte.
Da ich keine Lust hatte, die Zeit stumm zu verbringen, riskierte erst einmal einen Blick zu meinen direkten Nachbarn auf meiner rechten Seite.
„Leute gucken“ gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, damit kann ich Stunden verbringen. Ich schaue mir die Menschen an und male mir aus, was es für Typen sind, welches Leben sie wohl führen.
Der Kollege rechts neben mir war von der Sorte: „Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was!“ Ich schätzte, dass er das Abitur über den zweiten, vielleicht sogar dritten Bildungsweg gemacht hatte. Später sollte sich herausstellen, dass ich mit meiner Einschätzung Recht gehabt hatte. Der Knabe studierte Jura und hatte die gleichen Kurse wie ich belegt. Manfred war sein Name. Er war deutlich älter als die anderen Studenten, ich schätzte, dass er schon an der 30 knabberte. Er hatte leider so gar nichts von einem flotten Studenten. Hätte ich ihn in der U-Bahn das erste Mal getroffen, hätte ich ihn in die Kategorie Bankangestellter, Versicherungsfachmann oder Siemens-Mitarbeiter, mittlere Laufbahn, eingeordnet. Er hatte eine Glatze, einen kleinen Bauchansatz, trug Cordhose und Sandalen mit Socken.
Ich gestehe freimütig, dass ich ein Mensch bin, der seine Vorurteile hütet wie einen Augapfel. Manche Enttäuschung bleibt mir dadurch erspart. Beweisen kann ich es natürlich nicht, aber mit meinen Vorurteilen liege ich nur selten daneben. Bereits mehrfach bestätigt wurde mein Vorurteil, wonach Männer in Cordhosen, Socken und Sandalen schreckliche Spießer oder Muttersöhnchen sind, darauf gehe ich inzwischen jede Wette ein. Manfred gehörte zur letzten Sorte. In den Jahren unseres gemeinsamen Studiums hatte ich ihn zigmal mit Frau Mama und Dackel zur Uni kommen sehen. Selbst zur Prüfung hatte ihn die Mama begleitet und gewartet, bis der liebe Bub in den Gemäuern des Justizpalasts verschwand.
Mein Nachbar zur Linken war zwar auch kein Robert Redford, aber doch deutlich attraktiver. Dunkelhaarig, schlank, 186 cm groß und Brillenträger. Zugegeben, die Brille war scheußlich, aber das konnte man leicht korrigieren. Gegen Bauchansatz und Glatze ist Frau hingegen machtlos. Klaus sah auf jeden Fall wie einer aus, der auch ohne Anleitung seiner Mutter den Hörsaal findet. Ich beschloss, ihn anzureden. Es sollte keine plumpe Anmache sein, deshalb suchte ich einen intelligenten Vorwand.
Ich zog meine Immatrikulationspapiere aus der Tasche und einen Kugelschreiber und sprach ihn mit meinem liebenswertesten Lächeln an: „Kannst du mir sagen, wie die Uni hier heißt?“
Seine Antwort verblüffte mehr, als dass sie mich weiter brachte: „Wieso?“
„Weil man den Namen der Uni hier oben in das Formular eintragen muss und ich gestehen muss, dass ich ihn nicht weiß.“
Erst als ich die Begründung für meine Frage lieferte, fiel mir selber auf, wie peinlich sie war.
Der Mann an meiner Seite ließ sich jedoch nicht anmerken, ob er mich gleich unter der Rubrik „Frau, blond und doof“ einordnete, denn er antworte ganz freundlich: „Ach so, natürlich. Das ist hier die Ludwig-Maximilians-Universität.“
Nach einer kleinen Pause fügte er zur Sicherheit hinzu:
„Von München.“
Er war offensichtlich der Meinung, dass jemand, der den Namen der Uni nicht wusste, auf der er beabsichtigte, die nächsten fünf Jahre zu verbringen, möglicherweise auch den Namen des Ortes nicht wusste, an dem er sich gerade befand. Egal für wie blöd er mich hielt, es hielt ihn nicht davon ab, mit mir eine sehr anregende Unterhaltung zu beginnen.
Nach fast zwei Stunden hatte ich einiges von ihm erfahren. Er war 22 Jahre alt, kam aus der schönen Pfalz und war zwei Wochen zuvor aus der Bundeswehr entlassen worden, wo er die letzten zwei Jahre als Zeitsoldat verbracht hatte.
Die Bundeswehrzeit brachte ihm bei mir gleich Minuspunkte ein. Als überzeugte Pazifistin war ich grundsätzlich gegen die Bundeswehr und ganz besonders gegen ihre Soldaten. Ein weiteres von mir gepflegtes Vorurteil war: „Soldaten sind alles fremdbestimmte Befehlsempfänger und Säufer und deshalb blöd.“ Gekannt hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt keinen Soldaten persönlich. Deshalb ja auch das Bekenntnis zu einem Vorurteil.
Klaus schien meine unausgesprochene Abneigung gegen die Bundeswehr zu spüren, denn er sah sich unaufgefordert veranlasst, mir den Grund für seine zwei freiwilligen Jahre beim Bund zu erläutern. Er war der Jüngste von fünf Geschwistern, sein Vater war selbstständiger Sattlermeister gewesen, inzwischen aber schon in Rente, seine Mutter eine gute katholische Hausfrau. Das Geld war immer knapp im Hause Koch. Klaus beabsichtigte, Betriebswirtschaft zu studieren und brauchte etwas Geld. Während der zwei Jahre beim Bund konnte er gut für sein Studium sparen. Zeitsoldaten verdienten nämlich deutlich mehr als die normalen Wehrdienstleistenden, die nur sechs Monate weniger für das Vaterland im Einsatz waren, aber deutlich weniger Sold erhielten.
Sein Lebenslauf und seine familiäre Situation erklärten mir zwar seine Entscheidung, gutheißen konnte ich diese trotzdem nicht. Dennoch fand ich, meinem Vorurteil zum Trotz, Klaus gleich sympathisch, wenn ich mich auch nicht gleich in ihn verliebte.
Klaus gestand mir ein paar Wochen später, dass es bei ihm Liebe auf den ersten Blick gewesen war, wovon ich selbst aber nichts merkte. Das mag daran gelegen haben, dass ich, zumindest noch mit halbem Herzen an meinem Freund Jürgen hing, der allerdings im fernen Marburg studieren wollte. Die Beziehung zu Jürgen dauerte schon fast zwei Jahre und hielt überhaupt nur deshalb so lange, weil wir ständig getrennt waren. Ich lebte bis zum Abitur in der Nähe von Frankfurt, er in Marburg. Jürgen und ich passten einfach nicht zusammen, das wussten alle anderen von Anfang an und wir beide ahnten es inzwischen auch. Nach dem Abitur war uns jedenfalls klar geworden: Keiner liebte den anderen so sehr, als dass er auf seinen Lieblingsstudienort verzichtet hätte. Meiner war München, was jeder verstehen konnte, und seiner eben Marburg, warum auch immer. Heute weiß ich, der Grund hieß Gesine und wurde 18 Monate später seine erste Ehefrau. So weit waren wir aber im Oktober 1972 noch nicht und deshalb tat sich Klaus erst einmal schwer mit mir, obwohl er sich von Anfang an sehr anstrengte.
Nachdem wir unsere vollständigen Immatrikulationsunterlagen persönlich bei der zuständigen Verwaltungsstelle eingereicht hatten, beschlossen wir, zur Belohnung erst einen Kaffee trinken und danach ins Kino zu gehen. Es war „Der Diktator“ von Charly Chaplin. Der Film ist heute noch Kult und gefiel uns beiden sehr. Wir stellten eine erste Gemeinsamkeit fest, unsere Begeisterung für Kino. Am späten Nachmittag trennten wir uns mit den Worten: „Man sieht sich!“
Zugegeben eine sehr optimistische Form der Verabredung in Anbetracht der Tatsache, dass München rund eine Millionen Einwohner hat und circa 20.000 davon Studenten sind. Aber es stellte sich sehr bald heraus, dass Klaus nicht umsonst bei der Bundeswehr gewesen war, denn er ging in der darauffolgenden Woche generalstabsmäßig vor. Ich hatte ihm erzählt, dass ich im Münchner Osten zur Untermiete wohnte und deshalb immer mit der Straßenbahn der Linie 4 und der U-Bahn zur Uni fuhr. Also was tat mein Bundeswehr geschulter neuer Verehrer Klaus? Er informierte sich darüber, wann die Grundkurse für Juristen stattfanden und stellte sich dann an die Straßenbahnhaltestelle Perusastraße und wartete auf mich. Am dritten Tag hatte er Erfolg. Er stand schon an der Haltestelle, als ich kam und strahlte mir entgegen. Ich freute mich auch, ihn so unerwartet und bald wiederzusehen, denn ich kannte noch nicht so viele Menschen in München, mit denen ich mich so anregend unterhalten konnte wie mit Klaus. Leider hatte Klaus an diesem Tag viel Pech gehabt. Er hatte seinen Haustürschlüssel am Morgen zu Hause liegen lassen und konnte deshalb nicht in seine Studentenbude, bis sein Vermieter von der Arbeit nach Hause kam. Das konnte aber noch leicht zwei bis drei Stunden dauern. Es regnete fürchterlich und wir waren beide trotz Schirm schon ziemlich durchnässt. Deshalb schlug ich ihm spontan vor, mit zu mir nach Hause zu kommen: „Ich koche uns einen Tee oder Kaffee und wir quatschen einfach. Wir kriegen die Zeit schon rum, bis dein Vermieter nach Hause kommt.“
Klaus war sichtlich dankbar über meinen Vorschlag, denn er sagte sofort zu, wenn auch unter dem kleinen Vorbehalt: „Aber du musst mir versprechen, dass ich nächste Woche einmal für dich kochen darf, als kleines Dankeschön dafür, dass du mir heute Asyl gewährst.“
Klaus hatte instinktiv meinen schwächsten Punkt getroffen, nämlich meine große Leidenschaft für gutes Essen. Meine beiden Eltern konnten sehr gut kochen, ich hingegen leider nicht. Das Essen in der Mensa war ungenießbar und das in den Münchner-Kneipen unbezahlbar. Deshalb litt ich unter einer starken Unterversorgung an warmen Mahlzeiten, seitdem ich in München lebte. Ich war für jedes Angebot, das diesen leidigen Zustand unterbrach, sehr dankbar.
Erstaunlicherweise bin ich nie auf die Idee gekommen, Klaus zu fragen, warum er an diesem Tag an der Haltestelle Perusa-straße der Linie 4 stand. Er fuhr nämlich immer mit der S-Bahn in eine ganz andere Richtung und das wusste ich auch. Als er mich viele Wochen und warme Mahlzeiten später über seine Strategie aufklärte, war ich sehr gerührt, vor allem aber sehr geschmeichelt über so viel Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt gehörte Jürgen endgültig der Vergangenheit an, sodass ich mich auch gefühlsmäßig einem neuen Mann zuwenden konnte. Seit über fünf Jahren sind wir jetzt ein Paar, seit drei Jahren leben wir zusammen und seit einem Jahr zu dritt mit meiner kleinen Schwester Sylvie.
Als ich Klaus meinen Eltern vorstellte, sah ich ihren Mienen sofort an, dass sie von ihm alles andere als begeistert waren. Als geübte Tochter bemerkte ich es an den Blicken, die sie sich gegenseitig zuwarfen. Dabei gab es an Klaus auf den ersten Blick überhaupt nichts auszusetzen. Gegenüber meinen Verflossenen hatte er einen sichtbaren Vorteil, er war nämlich deutlich größer als ich, mit 1,86 m überragte er mich um fast zehn Zentimeter. Er hatte keine Glatze, keinen Bauch und er kaute nicht an den Fingernägeln, die dazu noch sauber waren. Dreckige, abgefressene Fingernägel sind bei meinen Eltern ein K.o.-Kriterium. Klaus konnte perfekt mit Messer und Gabel essen, was insbesondere für meinen Vater besonders wichtig war, schließlich hatte er seinen Töchtern schon mit knapp fünf Jahren beigebracht, wie man Hähnchen mit Messer und Gabel zerteilt und isst. Ich denke heute noch mit Grauen an die vielen Übungsstunden in unserer Lieblingskneipe im Dorf. Einmal in der Woche ging es zum Hähnchenessen in unsere Dorfkneipe „Zur glücklichen Henne“. Wenn unser Vater uns in die Anatomie des deutschen Huhns einweihte und uns freundlich zum Zerlegen des knusprigen Hähnchens mit Messer und Gabel aufforderte, hielt unsere Mutter jedes Mal den Atem an. Es dauerte nicht lange und eine ihrer drei Töchter stellte die Frage nach dem „Warum“: „Warum müssen nur wir das Hähnchen mit Messer und Gabel essen? Alle anderen Menschen um uns herum essen es doch auch einfach mit den Fingern!“ Unser Vater antwortete über Jahrzehnte, so lange dauerte es nämlich, bis auch die Jüngste die Anatomie des deutschen Grillhähnchens begriffen hatte, immer gleich: „Erstens sind wir nicht „andere Leute“, sondern die Familie Schneider und die isst Hähnchen mit Messer und Gabel und zweitens werdet ihr es mir noch einmal danken, dass ihr frühzeitig anständige Tischmanieren gelernt habt.“ Aus heutiger Sicht, fast 20 Jahre später, gebe ich ihm Recht. Vor kleineren Missgeschicken blieben wir alle nicht verschont, auch unser Vater nicht. Der eine oder andere Hähnchenschenkel flog schon mal eine letzte Runde und landete auf dem Boden, statt in unserem Magen. Die anderen Gäste verfolgten das Schauspiel aus sicherer Distanz mit einer Mischung aus Mitleid und Bewunderung.
Klaus allerdings hat eine ganz besondere Eigenschaft, die in unserer Familie nicht besonders ausgeprägt ist. Er kann gut zuhören und er quatscht nicht dazwischen, wenn sich andere Leute unterhalten, sondern wartet, bis man ihn aufmunternd anschaut. Allein wegen dieser Eigenschaft hätten ihn meine Eltern eigentlich lieben müssen. Ich vermute jedoch, dass sie ihm diese Rücksichtnahme als Schwäche auslegten. Tatsache ist, dass Klaus im Kreis unserer Familie deutlich weniger Gesprächsanteile hat als alle anderen Familienmitglieder. Wenn er allerdings zu Wort kommt, dann verschafft er sich auch Gehör. Er redet nur, wenn er gefragt wird oder wenn er etwas von „Bedeutung“ zu sagen hat. Meist sitzt er schweigend in unserer Runde, was meine Mutter zu der Bewertung veranlasste: „Der arme Klaus!“
Ich kann es schon nicht mehr hören, immer heißt es: „Der arme Klaus, kommt bei dir nicht zu Wort!“ Der arme Klaus muss waschen, kochen, putzen, der arme Klaus dieses und der arme Klaus jenes. Ich komme mir schon vor wie eine Xanthippe. Schließlich kann ich ja nichts dafür, dass der Mann den Mund nicht aufbringt, von mir aus kann er reden, so viel er will. Ich bin mir fast sicher, dass meine Mutter inzwischen die Vorteile von Klaus zu schätzen weiß. Wahrscheinlich ist sie sogar der Meinung, dass Klaus eine nettere, liebenswürdigere Frau verdient hätte als ihre älteste Tochter, aber sie nimmt ihn nach wie vor nicht ganz für voll. Klaus ist einfach zu nett, um von meiner Familie hoch geschätzt zu werden.
Ich nehme mir fest vor, Klaus heute Abend besonders liebevoll zu begrüßen, auch dann, wenn er mit zig Einkaufstüten vor mir steht. Auf keinen Fall darf ich heute meckern, selbst dann, wenn er wieder einmal die ganze Lebensmittelabteilung des Kaufhofes am Marienplatz aufgekauft hat und ich heute schon weiß, dass wir einiges davon spätestens am Mittwoch wegschmeißen müssen, weil wir es gar nicht alles aufessen können.
Klaus gehört zu der ungewöhnlichen Sorte Mensch, die mit ständig wachsender Begeisterung durch die Lebensmittelabteilungen sämtlicher Einkaufshäuser Münchens geht. Dabei besteht immer die Gefahr, dass er einem wahren Kaufrausch erliegt. Er scheint geradezu magisch angezogen von den Delikatessen der Frischwarenabteilungen seiner bevorzugten Lebensmittelhändler. Egal ob Fleisch, Fisch, Käse, Obst oder Gemüse, Klaus hat an allem seine Freude. Geradezu glücklich ist er, wenn ihm kleine Kostproben angeboten werden. Er nimmt sich gerne die Zeit und so kann er Stunden in der Lebensmittelabteilung zubringen. Was Lebensmittel angeht, verhält sich Klaus total atypisch zu seinem sonstigen Charakter, denn in allen anderen Lebenslagen neigt er zu großer Sparsamkeit, um das Wort Geiz zu vermeiden.
Ich dagegen werde bei Lebensmitteleinkäufen von der reinen Vernunft geleitet. Zielstrebig gehe ich von Regal zu Regal und kaufe die Sachen, die mir aufgetragen wurden oder von denen ich weiß, dass sie aufgefüllt werden müssen, weil es unter der Würde meiner Mitbewohner ist, an so profane Dinge wie Klopapier, Wasch- und Putzmittel oder die immer wieder gerne vergessene Zahnpasta zu denken. Ich bin der Gegenbeweis für die Regel, dass jeder, der gerne isst, auch gerne kocht. Tatsache ist, dass meine fehlende Begeisterung für zeitintensive Besuche in den Lebensmittelabteilungen der Münchner Kaufhäuser oder auch Tante-Emma-Läden eher daher rührt, dass ich keine Ahnung vom Kochen habe. Dank der Kochbegeisterung meiner Mitbewohner kann ich mich bisher auch immer erfolgreich ums Kochen drücken, obwohl ich leidenschaftlich gerne esse.
Meine Eltern kochen sehr gut, besonders mein Vater kocht hervorragend und auch sehr gerne. Bei meiner Mutter hält sich die Begeisterung fürs Kochen wie bei mir in Grenzen. Wer sieben Tage in der Woche für fünf Leute kochen muss und für seine Arbeit nur selten Komplimente erhält, der verliert schon einmal die Lust am Kochen. Mein Vater bereitet immer noch mit Begeisterung das Essen zu, bevorzugt natürlich an den Wochenenden. Eigentlich gilt im Hause der Familie Schneider die klassische Rollenverteilung der Nachkriegsjahre. Mit Ausnahme der Essenszubereitung. Beim Kochen übernahm Vater sehr schnell die Vorherrschaft in der Küche. Der Grund dafür lag in einem kleinen Missgeschick unserer Mutter gleich zu Beginn der Ehe: Vater liebte Kalbsleber mit Zwiebeln und Kartoffelpüree. Mutters Versuch, ihrem frisch angetrauten Ehemann das Lieblingsgericht zu bereiten, ging gründlich schief. Die Leber war schwarz wie die Nacht und schmeckte nach Schuhsohlen. Behauptet jedenfalls Vater, Mutter verweist auf den Hang zu Übertreibungen ihres Mannes, wenn diese Geschichte zum wiederholten Male die Runde macht.
Fakt ist, seitdem ich denken kann, ist Vater für alle Fleisch- und Fischgerichte zuständig. Mutter für den Rest, inklusive der Beseitigung aller Schmutzspuren, die ihr Ehemann bei der Zubereitung seiner Gerichte hinterlässt. Vaters üppiger Gebrauch von unzähligen Töpfen, Schüsseln und sonstigen Küchenutensilien führt bei unseren Eltern regelmäßig zu Streit. Selbst seitdem die Spülmaschine in den Haushalt meiner Eltern eingezogen ist, kommt es zu hitzigen Wortgefechten über die Frage der Notwendigkeit, bei der Zubereitung eines einzigen Fleischgerichtes alle Pfannen und Töpfe nutzen zu müssen, die der Haushalt bereit hält. Die Kapazitäten der Spülmaschine reichen nie aus, wenn Vater für seinen Fünfpersonenhaushalt aufkocht. Es bleiben immer Töpfe, Pfannen und viel Geschirr übrig, die Mutter nach den Mahlzeiten mit der Hand abwaschen muss. Leider bleiben auch wir Kinder von der lästigen Reinigungsarbeit nicht verschont. Nach dem Motto „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ verdonnert uns Mutter regelmäßig zu Aufräumarbeiten in der Küche.
Vaters Leidenschaft für das Kochen hat sich inzwischen bei allen Verwandten und Freunden der Familie herumgesprochen. Jeder, der in den Genuss seiner Kochkünste kommt, lobt ihn überschwänglich. Völlig zu Recht, wie ich meine. Egal, ob vom Rind oder Schwein, seine Fleischgerichte sind zart und rosa, au Point, wie der Meister zu sagen pflegt. Bei seinen Geflügelgerichten ist die Haut kross und das Fleisch saftig und die Krönung von allem sind seine Wildgerichte, die er an besonderen Feiertagen serviert. Die Beilagen unserer Mutter krönen jeden Gang. Beide zusammen sind ein perfektes Team in der Küche, wenn da nur nicht immer der Streit um die lästigen Aufräumarbeiten wäre. Vater weigert sich beharrlich und bis heute auch erfolgreich, sich an diesen, wie er meint, klassischen Frauenarbeiten zu beteiligen. Aber immerhin ist mein Vater in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis der einzige Mann seiner Generation, der sich überhaupt in der Küche blicken lässt.
Vater ist der Exot unter seinen Geschlechtsgenossen. Kochen ist in deren Augen Weiberkram. In den 60er und 70er Jahren interessiert sich ein richtiger Mann für Fußball, Boxen und wenn er ein Weichei ist, vielleicht noch fürs Eiskunstlaufen, spätestens seitdem Marika Kilius und Hans Jürgen Bäumler die Eiskunstlaufszene eroberten. Die Frauen beneiden meine Mutter wegen der Kochbegeisterung ihres Mannes und himmeln meinen gutaussehenden Vater noch mehr an. Mutter trägt es mit Fassung. Allerdings erlaubt sie sich gelegentlich, auf die Verwüstungen in ihrer Küche hinzuweisen. Aber auch diese Einblicke trüben die Begeisterung der Gäste nicht, warum auch, schließlich müssen sie ja nicht aufräumen. Vater ist als Gastgeber der ungekrönte König und er genießt es sehr, von seinen Gästen die Bewunderung zu erhalten, die ihm seine Familienmitglieder wegen ein paar schmutziger Töpfe und Pfannen häufig verweigern.
Damit es mir nicht genauso geht wie meiner Mutter, habe ich die gesamte Kocharbeit meinem Lebensgefährten Klaus überlassen und freiwillig die leidigen Aufräumarbeiten danach übernommen. Ich denke, die Aufteilung ist gerecht, Klaus kocht gerne und auch gut. Allerdings braucht er deutlich mehr Zeit fürs Einkaufen und Kochen, als ich für das Aufräumen danach. Dafür macht ihm die Arbeit Spaß, während ich still vor mich hin leide.
Seit Sylvie bei uns wohnt, hat Klaus Gesellschaft in der Küche. Sylvie hat offensichtlich das Kochinteresse von ihrem Vater geerbt. Für mich ein Grund mehr, der Küche fernzubleiben, denn zu dritt haben wir in ihr einfach keinen Platz.
Seit wir eine Spülmaschine unser Eigen nennen, trage ich die Bürde des Abwaschens mit deutlich mehr Gelassenheit. Bei uns landet alles in der Spülmaschine, Geschirr, Besteck, Töpfe, egal ob spülmaschinenfest oder nicht, in diesem Punkt habe ich keine Gnade. Bei uns überleben nur die Besten, das gilt auch für das Geschirr.
Ich finde, wir drei sind ein gutes Team. Jeder macht das, was er kann. Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich nicht die perfekte Köchin bin und es meinen beiden Mitbewohnern überlasse, den Kochlöffel zu schwingen. Wir leben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ich praktizierte die Emanzipation, ich rede nicht nur darüber. Klaus ist ein emanzipierter Mann. Er hat offensichtlich keine Schwierigkeiten damit, in unserem gemeinsamen Haushalt klassische Frauenaufgaben zu übernehmen, die von seinen Geschlechtskollegen kategorisch abgelehnt werden. Es stimmt mich allerdings sehr nachdenklich, wenn meine Altersgenossinnen sehr schnell bereit sind, sich die Rolle ihrer Mütter aufdrücken zu lassen und die Zuständigkeit für Kinder, Küche, Kirche wieder übernehmen. Ich behaupte von mir, dass ich heute noch Jungfrau wäre, wenn dies nur dann zu vermeiden gewesen wäre, wenn ich für einen Mann kochen, putzen, waschen und die Hemden bügeln müsste. Gott sei Dank muss ich diesen Beweis nicht antreten, denn Klaus lief mir schon mit knapp zwanzig über den Weg, früh genug also, um nicht als alte Jungfer abgestempelt zu werden.
Die Wanne ist immer noch nicht vollgelaufen, Zeit genug, um den AB noch einmal abzuhören. Der zweite Anruf ist von meiner Freundin Karin. Sie schlägt vor, dass wir uns am Samstagabend zum Kino treffen. Sie will uns ihren neuen Freund Toni vorstellen. Es ist der dritte in zwei Jahren. Jedes Mal ist es die große Liebe, leider hält die dann nur wenige Monate. Gerade wenn ich mich an die Herren gewöhnt habe, ist die Beziehung schon wieder zu Ende. Ich komme mir nach fünf Jahren mit meinem Klaus dabei schon richtig spießig vor. Ich fürchte mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich es später einmal bereuen könnte, dass ich ab meinem zwanzigsten Lebensjahr immer mit demselben Mann zusammen war. Aber so weit sind wir ja schließlich auch noch nicht. Schließlich sind wir erst fünfundzwanzig und es ist noch ein langer Weg bis zum gemeinsamen Einzug in ein Altersheim. Da kann noch viel passieren, aber heute bestimmt nicht, denn heute ist ja Liebe und Verständnis angesagt.
Bevor Klaus in mein Leben trat, war mein Liebesleben nicht aufregend. Die Freunde kamen und gingen auch wieder, ohne besonderes Leid oder tiefere Spuren zu hinterlassen. Die Erde hat noch bei keinem Kuss gebebt und bebt auch sonst nicht. Ich schreibe das weniger meiner fehlenden Leidenschaft als dem Hang zur Übertreibung der Verfasser von Liebesromanen zu, egal ob Klassik oder Trivialliteratur. Wenn es bei Klaus bleibt, komme ich gerade mal auf drei Männer in meinem Leben und damit liege ich deutlich unter dem Durchschnitt, was die Zahl der Geschlechtspartner einer deutschen Frau betrifft. Die Statistiken künden von neun verschiedenen Geschlechtspartnern des Durchschnittsdeutschen. Die Statistik unterscheidet dabei nicht zwischen dem Liebesleben eines Mönchs, eines Callboys, einer katholischen Hausfrau in Niederbayern oder einer überzeugten Singlefrau in Berlin, rein statistisch sind alle Menschen sexuell gleich aktiv. Wenn die katholische Hausfrau das hält, was sie ihrem Mann am Traualtar versprochen hat, nämlich ewige Treue, dann ist die Singlefrau in Berlin wohl zu beneiden, sonst kämen die Statistiken nicht auf den angeführten Schnitt.
Ich bin seit fünf Jahren mit Klaus zusammen und bis heute immer treu gewesen. Dazu hat mich meine Mama erzogen und so soll es auch bleiben, selbst wenn es ab und zu schwerfällt.
Sollte ich mit Klaus zusammenbleiben, steht zu befürchten, dass ich in einem der wichtigsten und vor allem aufregendsten Bereiche meines Lebens weit unterdurchschnittlich bleibe. Ich habe es immer gehasst, Mittelmaß zu sein, musste aber lernen, es zu akzeptieren. Damit habe ich mich inzwischen abgefunden, alles andere wäre lächerlich. Aber muss ich denn wirklich in Sachen Liebeserfahrung unter dem Durchschnitt bleiben? Das wäre doch zu ärgerlich!
Schluss mit trüben Gedanken, egal ob Durchschnitt oder nicht, heute Abend heißt mein Traummann Klaus, alles Weitere ergibt sich später.
Meine Freundin Karin leistet in diesem Bereich weit Überdurchschnittliches, so viel steht heute schon fest. Auf ihren Neuen bin ich schon sehr gespannt, obwohl sie immer demselben Beuteschema erliegt und ihre Männer alle aussehen wie die kleinen Brüder von Alain Delon, was ja grundsätzlich für einen guten Geschmack spricht.
Wir müssen morgen unbedingt mit den beiden ins Kino gehen. Wenn ich richtig nachrechne, geht Karin jetzt schon fünf Wochen mit Toni. Wie ich das Tempo meiner Freundin kenne, neigt sich der erst Liebesrausch auch schon wieder dem Ende zu. Es besteht die Gefahr, dass Toni morgen schon wieder Geschichte ist, und zwar bevor ich seine Bekanntschaft gemacht habe. Das wäre wirklich schade, denn ich habe den Ehrgeiz, jeden Lover meiner Freundin mindestens einmal zu sprechen. Schon um mir die Frage beantworten zu können, ob ich mit meiner spießigen, monogamen Beziehung mit Klaus Wesentliches verpasse. Bisher kommt noch kein Neid auf, aber man weiß ja nie, wen Karin noch anschleppt.
Ich habe Durst und gehe zurück in die Küche, um eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank zu nehmen. Vergeblich suche ich ein Wasserglas im Küchenschrank. Kurzfristig bin ich versucht, aus der Flasche zu trinken, eine kleine Schwäche aus meiner Singlezeit. Aber die ist ja nun vorbei, inzwischen bin ich ja eine Art Mutterersatz und muss Vorbild für meine kleine Schwester sein.
Seitdem ich in einer Wohngemeinschaft lebe, habe ich mir angewöhnt, aus einem Glas zu trinken, in der stillen Hoffnung, dass es meine Mitbewohner mir gleichtun. Ich liebe sie zwar beide sehr, aber der Gedanke, dass wir alle drei abwechselnd an ein und derselben Mineralflasche nuckeln, ist mir zuwider. Doch auch in der Spülmaschine werde ich nicht fündig. Das Geschirr der letzten zwei Tage steht dreckig in der Maschine und verströmt einen leicht säuerlichen Geruch. Die Spülmaschine ist das einzige Luxusobjekt in unserem Haushalt und wurde ausschließlich zur Wahrung des Familienfriedens angeschafft. Den handbetriebenen Abwasch hassen wir alle drei so sehr, dass an der Spülmaschine kein Weg vorbeiführte. Wir wollten nicht riskieren, dass wir uns wegen dreckigem Geschirr ständig in den Haaren liegen. Erstaunlicherweise hat keiner ein Problem damit, das dreckige Geschirr in die Spülmaschine zu stellen und auch das Ausräumen der Maschine klappt in der Regel wunderbar. Der heutige Tag beweist allerdings, dass wir noch daran arbeiten müssen, dass sich immer auch einer finden muss, der die Spülmaschine in Betrieb setzt. Das Problem wird sich lösen lassen, da bin ich mir sicher.
Schnell schließe ich die Spülmaschinentüre wieder und vergesse spontan alle meine guten Vorsätze und mein Grauen vor fremdem Speichel. Genüsslich setze ich die kühle Mineralflasche an meinen Mund und lasse das eiskalte Wasser meinen Rachen herunter rinnen. Nachdem ich die Flasche wieder in den Kühlschrank gestellt habe, setze ich mich an den Küchentisch, um einen kurzen Blick in die Post zu werfen.