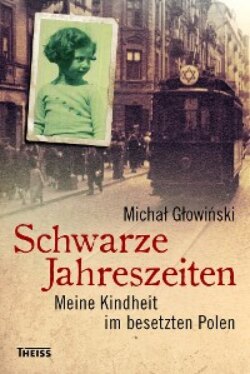Читать книгу Schwarze Jahreszeiten - Michal Glowinski - Страница 13
Der Keller
ОглавлениеWas ich jetzt erzählen werde, geschah bereits in der Zeit jener Kulmination, als diese beiden Wörter auf den Lippen aller lagen, die hinter den Mauern eingeschlossen waren. Es war erst der Beginn der Liquidierungsaktion; an diesem Tag waren wir an der Reihe, wir sollten zum Umschlagplatz gejagt – und direkt ins Gas gebracht werden. Meine Familie versteckte sich so wie ein guter Teil der Nachbarn (vielleicht alle?) in einem der am weitesten vom Eingang entfernt gelegenen, wenngleich mit Sicherheit nicht allzu gut getarnten Kellerräume. Soweit ich mich erinnere, wurde er vom Hauswart von außen verschlossen. Ich habe seine Figur vor Augen: Es war ein junger, großer und breitschultriger Mann. Er selbst versteckte sich noch nicht mit uns zusammen, sicher dachte er, dass ihn die ausgeübte Funktion vor der Deportation schützen würde, doch seine Frau war wohl bei uns. Und tatsächlich, diesmal wurde er nicht mitgenommen.
Es fällt mir heute schwer, viel über unsere Zeit im Versteck zu sagen, die Einzelheiten sind zu Nebel verschwommen. Es herrschte Enge, und das Deckengewölbe war so niedrig, dass man nicht zu stehen vermochte. Ich wusste bereits gut, worum es hier ging, was wir vermeiden wollten, indem wir uns an einem Ort versteckten, der sich nicht zum Leben eignet. Jeder von außen kommende Ton rief Entsetzen hervor. Und auch ich war, verständlicherweise, von Angst erfüllt. Ich schmiegte mich an meine Eltern, aber in dieser Lage waren selbst sie keine Sicherheitsgarantie, ich war mir darüber im Klaren, dass sie genauso in Gefahr waren wie ich und alle anderen. Es war dunkel, es herrschte absolutes Schweigen, denn keinerlei Lebenszeichen durfte aus diesen Mauern herausdringen.
An diese Episode erinnere ich mich am besten: Auf einmal wurde die Stille radikal gestört. Eine der sich versteckenden Frauen hielt einen Säugling auf dem Arm, der wohl gerade einmal wenige Monate alt war (vielleicht war es die Frau des Hauswarts?). Er begann krampfhaft zu weinen und ließ sich nicht beruhigen. Die Mutter wiegte ihn, hielt ihm den Mund zu, schließlich gab man ihm ein Beruhigungsmittel. Man flüsterte sich zu, dass wir durch dieses Kind entdeckt und umkommen werden. Einige Stimmen verlangten, es zu ersticken, ansonsten würden es und mit ihm wir alle sterben, die wir uns in dem Keller verbargen. Eine Diskussion entstand, doch die junge Frau willigte nicht in die Ermordung ihres Kindes ein. Dazu kam es auch nicht; vielleicht beruhigte sich der Säugling, vielleicht aber löste auch ein Mann die Spannung, der sagte: „Dieses Kind wird unser Maskottchen sein, es bringt uns Glück.” Die Regeln der Erinnerung sind merkwürdig, von dieser ganzen Geschichte erinnere ich mich augenscheinlich gerade an diese Worte – vielleicht, weil aus ihnen Hoffnung hervorlugte. Tatsächlich kam bald darauf der Hauswart und öffnete den Keller. Die Mannschaft, bei der den Deutschen die sogenannten „Šaulis” und „Czubaryks” halfen, hatte sich getrollt. Diesmal war es gelungen, den Weg zum Umschlagplatz zu vermeiden.
Ich weiß nicht, wie lange wir uns in dem Keller aufhielten, sicherlich einige Stunden. Aber selbst wenn ich es wüsste, hätte das keine größere Bedeutung, denn eine solche Zeit lässt sich nicht mit einfachen Maßstäben messen, in derlei Momenten sind dies wenig hilfreiche Werkzeuge. Ich denke auch deshalb so darüber, weil der Aufenthalt in dem Keller in mir bis heute andauert und nicht mit dem Öffnen der Tür beendet war – und das nicht nur, weil mit dem Augenblick, in dem diese konkrete Bedrohung endete, die Gefahr nicht vorüber war. In einer Welt, in der der einzige Gesetzgeber und Regelsetzer ein systematisch nach einem vorab beschlossenen Plan vollzogenes Verbrechen ist, haben Bedrohungen und Gefahren kein Ende, ihre finale Phase kann eigentlich erst seine Erfüllung sein, die vollständige Durchführung, nach der nichts mehr übrig ist. Natürlich war ich mir dessen im Sommer 1942 nicht bewusst, ich war noch nicht einmal acht Jahre alt. Aber ich denke, dass die meisten Erwachsenen schon davon wussten. Ganz sicher waren sich diejenigen dieses Sachverhalts bewusst, die meinten, der Grundsatz contra spem spero, die Hoffnung stirbt zuletzt, fände hier keine Anwendung – denn wenn es um alles oder nichts geht, zeigt sich, wie nutzlos er ist.
Das war meine erste Konfrontation mit einem derartigen Eingeschlossensein. Ich hatte schon früher erfahren, was es damit auf sich hat, als man uns aus dem kurzlebigen Ghetto in Pruszków ins Warschauer Ghetto gebracht hatte; diese Fahrt in einem Zug, den man nicht verlassen konnte, dauerte zwei Tage, obwohl mein Heimatstädtchen nur etwa 15 Kilometer von der Hauptstadt entfernt liegt. Dennoch war das etwas anderes.