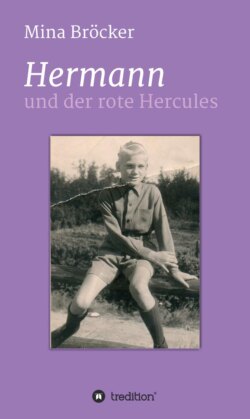Читать книгу Hermann und der rote Hercules - Mina Bröcker - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSaint-Nazaire, November 1962
Hermann legte den Kopf in den Nacken. Er sah Oskars Hände vor sich. Wie sie den Pinsel führten und wunderschöne riesige Rosenranken auf die Tapete malten. Und wie sein Großvater im Handstand die Treppe zum Hof hoch- und runterstieg, um ihn und seine Freunde zu erheitern. Er dachte an Jürgen und die scheinbar endlosen Sommertage am Lankenauer Höft. All das schien eine Ewigkeit her.
„Hermann? Was ist mit dir?“
„Hmm?“
Hermann öffnete seine Augen. Sein Blick traf auf Jeanne. Sie ordnete ihr dichtes dunkles Haar und beobachtete ihn im Spiegel. Ihr Chignon, der Knoten, hatte sich gelöst. Mit geübtem Griff nahm sie die Klammer aus dem Mund und steckte die Strähnen hinter dem Ohr fest. Ihr Blick blieb dabei auf ihn geheftet. Noch vor ein paar Minuten hätte er sie am liebsten wieder ausgezogen, doch jetzt schien er überrascht, sie zu sehen.
„Was ist denn passiert? Du bist ja ganz blass!“
Hermann schaute auf das Papier in seiner Hand. „Es ist nichts!“, sagte er.
„Cheri!“
Jeanne schüttelte ihren Kopf und drehte sich um. Sie und Hermann waren noch nicht sehr lange ein Paar, aber sie kannte ihn bereits gut genug, um zu wissen, dass das nicht stimmte. Seit dem Sommer trafen sie sich heimlich in seiner Mansarde, in der nichts weiter stand als ein Bett, ein Nachtschrank, eine Kommode und ein Stuhl. Hier liebten sie sich voller Hast, bevor Jeanne wieder zurück in das Kurzwarengeschäft musste, in dem sie arbeitete. Sie nahm ihre Strickjacke vom Stuhl und spielte mit dem Ärmel. Offenbar hatte sie es diesmal nicht eilig, pünktlich ins Geschäft zurückzukehren.
Hermann überlegte, wie er Jeanne versichern konnte, dass alles gut sei. Aber für einen abwiegelnden Satz fehlten ihm die feinen Nuancen der französischen Sprache. So beschloss er zu sagen, was er soeben erfahren hatte.
„Meinem Großvater geht es nicht gut.“
„Was soll das heißen, ihm geht es nicht gut? Ist er krank?“ fragte Jeanne und setzte sich neben ihn aufs Bett.
„Es kann sein, dass er bald stirbt“, antwortete Hermann.
„Mon Dieu!“ Jeanne schlug sich die Hand vor den Mund. Dann besann sie sich und schlug schnell ein Kreuz vor ihrer Brust.
„Das heißt, du fährst nach Deutschland? Wenn du willst, frage ich Papa, ob er dich von der Arbeit abmelden kann. Ich werde ihm alles erklären“, sagte sie.
„Halt Jeanne, warte! Warte! Ich… ich werde nicht nach Hause fahren!“
„Wie? Warum nicht? Willst du deinen Großvater nicht noch einmal sehen?“
Jeanne sah Hermann fragend an. Manchmal verstand sie nicht, was ihm durch den Kopf ging und warum er immer so verschwiegen war. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen hatte sie sich in ihn verliebt und zwar just an jenem Abend, an dem ihr Bruder François den fremden blonden Mann mit nach Hause gebracht hatte.
Auch Hermann war vom ersten Augenblick an von Jeanne angetan. Erst wollte er es sich nicht eingestehen und dann ließ er sich nichts anmerken. Das hatte vor allem mit Jeannes Vater zu tun. Hermann hatte großen Respekt vor Pierre. Er liebte ihn und schaute zu ihm auf. Und er hatte eine Heidenangst vor seiner Reaktion, wenn er erführe, dass Hermann und Jeanne ein Paar waren.
Pierre Guimard war freundlich zu Hermann gewesen, hatte sein Haus für ihn geöffnet und ihn in seine Familie, in sein Innerstes, aufgenommen. Das war nicht selbstverständlich für einen Franzosen und schon gar nicht für einen aus Saint-Nazaire. Seit 16 Jahren war der Krieg zu Ende, aber noch immer spaltete der riesige U-Boot-Bunker die Stadt.
Hermann wusste, dass Pierre ihn mochte, aber würde er ihn auch als Schwiegersohn akzeptieren? Wollte er denn überhaupt heiraten, Vater werden, für immer an einem Ort bleiben? Hermann atmete tief durch. Er musste seine Gedanken sortieren.
„Natürlich will ich meinen Großvater sehen. Ich muss nur vorher noch ein paar Dinge klären“, beschwichtigte er Jeannes Unruhe und küsste sie auf die Nase.
Als Jeanne fort war, zog Hermann sich an und ging raus. Er wollte ans Ufer der Loire, den Kopf frei bekommen. Seit jeher hatte Wasser eine beruhigende Wirkung auf ihn. Er verließ das Haus in der Rue de Vieille Église. Draußen war es nasskalt, es nieselte – bretonisches Wetter. „Genauso ein Schietwetter wie in Bremen“, dachte Hermann und schlug den Mantelkragen hoch.
Das Zimmer, das er erst Anfang des Sommers angemietet hatte, lag im Hafenviertel, von hier konnte er zu Fuß zur Werft gehen. Sie arbeiteten im Schichtbetrieb, auch die Monteure, alle zwei bis drei Tage im Wechsel Früh-, Spät- und Nachtschicht und zwischendurch ein paar Tage frei. Hermann verließ das Hafengebiet und ging über die Drehbrücke Richtung Stadt. An der Ecke war ein Kiosk, der Postkarten verkaufte. Auf den meisten war das maritime Saint-Nazaire zu sehen. Sie erinnerten an längst vergangene Zeiten. Wie die mit dem traditionsreichen Ozeandampfer Normandie, der malerisch in Richtung Horizont zieht, während sich an der Promenade gut gekleidete Menschen in ihren weißen Anzügen und Sommerkleidern tummeln.
An diesem Novembermorgen war die Stadt einfach nur trist. Das Zentrum befand sich auf der anderen Seite des Boulevards de la Légion d’Honneur, wohin es nach dem Krieg verlegt worden. Es gab eine langgezogene Einkaufsstraße mit Bekleidungsgeschäften und zweitklassigen Restaurants, in denen man ein Drei-Gänge-Menü schon für wenige Francs bekam. Doch Hermann hatte keinen Hunger und er wollte nicht in die Stadt. Also bog er in die Rue du Port ein und ging zum Strand.
Es war Ebbe. Die Loire hatte sich zurückgezogen und Bänke weißer Muscheln freigelegt, auf deren Schalen die Wellen ihre geriffelten Reliefs hinterlassen hatten. Eine Frau sammelte Austern und Miesmuscheln auf. Möwen kreischten und konkurrierten mit den Enten um die Wattwürmer. Bereit zur Attacke kreisten die Raubvögel im Himmel. Es roch nach Fisch, Tang und Meer. Hermann musste an Jürgen denken. Er wünschte sich, sein bester Freund wäre bei ihm in Frankreich. Noch nie hatte er mit jemanden darüber geredet. Mit Jeanne nicht, mit Jürgen nicht und auch nicht mit Peter. Jeanne hatte er nur erzählt, dass er bei seinen Großeltern aufgewachsen war und dass er keine glückliche Kindheit hatte. Aber das stimmte nicht. Er hatte eine glückliche Kindheit.