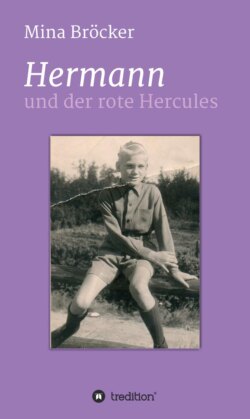Читать книгу Hermann und der rote Hercules - Mina Bröcker - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBremen, März 1951
Der Tag war für eine Beerdigung fast beleidigend schön. Es war zwar bitterkalt, doch das erste Mal seit Wochen ließ sich die Sonne blicken. Sie schien durch die bunten Fenster der Kapelle und warf rote, gelbe, blaue und grüne Flecken auf die weiß gekalkte Wand.
Hermann sah das Farbspiel nicht. Er klammerte sich an die weiße Rose in seiner Hand. Vergeblich versuchte er zu weinen, doch keine einzige Träne wollte ihm die Wange herunterlaufen. Damit niemand es bemerkte, hielt er den Blick fest auf die ebenmäßigen Blütenblätter der Rose gerichtet.
Links von ihm saß sein Großvater, Oskar. Rechts von ihm seine Großmutter Henny. Hinter ihnen hatten Hannah, Gerd und Hans Platz genommen, die Geschwister seiner Mutter. In einem Moment der Stille ging ein Husten, Räuspern und Schniefen durch die Trauergemeinde.
Hermann hörte ein schweres Ächzen hinter sich, vorsichtig lugte er über seine Schulter. Zwei Reihen hinter ihm saß eine Frau, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Sie hatte die Schultern hochgezogen. Um die Brust hatte sie ein wollenes Tuch geschlungen. Ihre Augen waren gerötet. Sie presste ein Taschentuch auf ihren aufgerissenen Mund, um nicht laut aufzuschluchzen und nur anhand ihrer zuckenden Schultern erahnte Hermann, dass sie weinte. Geplagt vom schlechten Gewissen, nicht weinen zu können, drehte er sich weg. Es war nicht so, dass er seine Mutter nicht geliebt hätte. Er hatte seine Mutter geliebt, sehr sogar. Aber er konnte einfach nicht glauben, dass sie dort vorne in dem schlichten hölzernen Sarg liegen sollte. Seine Großeltern hatten ihm verboten, den Leichnam zu sehen. Aber vielleicht hätte es ihm geholfen zu realisieren, dass seine Mutter nun tot war.
„Behalt‘ deine Mutter so im Kopf wie sie noch gesund war“, hatte Henny nur gesagt.
Hermann rief sich das Bild seiner Mutter Sophie ins Gedächtnis. Damals, als sie noch ein Backfisch war. Gesund, rosig, mit vollen Wangen und zu Schnecken gedrehten Haaren. Es gelang ihm, das andere Bild von ihr zu verdrängen. Das Bild der letzten Jahre, als sie bereits von der Krankheit gezeichnet war: hager, mit scharfen Gesichtszügen und bleichen Augen.
Da erklang eine Melodie, die ihm bekannt vorkam. Auld Lang Syne. Die Melodie hatte seine Mutter ihm vorgesummt, wenn sie ihn beruhigen wollte. Es war eines ihrer Lieblingslieder gewesen. Den Text kannte Hermann nicht. Doch als die Gesangsstimme erklang, begann seine Brust zu beben. Das Beben rollte nach oben, brach sich Bahn bis zum Hals, wo ein dicker Klumpen saß, der das Grollen aufhielt. Doch es wurde stärker. Hermanns Kinn fing an zu zittern und mit einem sich aufbäumenden Schluchzen ergab sich sein kleiner Körper. Er klappte nach vorn auf seine Knie und schluchzte. Tränen liefen seine Wangen hinunter und wollten nicht enden. Sein Großvater streichelte ihm den Rücken, ließ ihn gewähren und drückte ihn immer wieder an sich. Ganz so als wollte er sagen: „Alles wird gut!
Als das Lied endete, kamen die Sargträger. Der Trauerzug mit Hermann und seinen Großeltern an der Spitze folgte ihnen nach draußen ins Freie. Die Sonne schien so gleißend vom klaren blauen Himmel, dass sie die Augen schließen mussten, um nicht geblendet zu werden.
Die Totengräber hatten ihre Mühe damit gehabt, das Grab auszuheben. Die Erde war steinhart gefroren und mit einem Feuer hatten sie zunächst die obersten Schichten auftauen müssen, um sie beiseite schaufeln zu können. Nun lag die Erde in dicken, dunkelbraunen Brocken neben dem Grab. Der Sarg wurde eingelassen und Hermann trat hervor, um seine Rose hinabzuwerfen.
Die Trauerfeier fand in der Wohnung von Henny und Oskar statt. Die Wohnung befand sich im ersten Stock eines einfachen Mehrfamilienhauses, dessen einziger Zweck es war, den Menschen nach dem Krieg schnell ein Dach über dem Kopf zu bieten. Zu siebt lebten sie auf 60 Quadratmetern Wohnfläche. Es gab zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und ein Bad. Gerd, Lore und ihr Sohn Axel schliefen im Schlafzimmer, das sich Hermann zuvor mit seiner Mutter und seiner Tante Hannah geteilt hatte. Nun saßen alle zusammen in der Küche, die den Mittelpunkt der Wohnung bildete. Henny servierte Bohnenkaffee und stellte ein Blech Butterkuchen, den sie frühmorgens noch gebacken hatte, auf den Tisch. Dass die Gäste eine anständige Bewirtung erhielten, war Hannah zu verdanken, die alles bezahlte. Erst am Vorabend war sie aus Heidelberg angereist.
Neben der Familie waren noch Nachbarn sowie Sophies Arbeitskolleginnen und Freundinnen gekommen. Die Frau mit dem wollenen Tuch war auch dabei. Sie hieß Else und kannte Sophie noch aus Findorff. Mittlerweile lebte sie im Bremer Umland in Twistringen und war mit einem reichen Bauern verheiratet.
Hermann war nach der Beerdigung erschöpft ins Bett gegangen. Als er Stunden später wieder aufwachte, war es draußen schon dunkel. Hermann wusste nicht, wie spät es war, schätzte aber, dass es früher Abend sein musste. Aus der Küche hörte er Stimmen. Die Erwachsenen saßen am Tisch und diskutierten. Einzelne Gesprächsfetzen drangen an sein Ohr. Jemand sagte seinen Namen. Schlaftrunken lauschte Hermann in die Dunkelheit hinein. Er hörte den Bügelverschluss einer Bierflasche ploppen. Hermann streckte sich und beschloss aufzustehen. Er hatte Hunger, seit dem Frühstück hatte er nichts mehr gegessen. Auf nackten Füßen tappte er durch den dunklen schmalen Flur Richtung Küche. Die Holztür war nur angelehnt. Durch einen schmalen Spalt fiel das Licht der Deckenlampe auf die Dielen.
Er hörte Oskars Stimme. „Wir müssen es ihm sagen. Der Junge hat ein Recht darauf.“
„Oskar, lass gut sein. Das sind olle Kamellen“, sagte seine Großmutter. „Viel wichtiger ist die Frage, wie es jetzt weitergehen soll. Hannah, was ist mit Heinrich und dir? Ihr habt ein großes Haus.“
„Mutter, ich habe gesagt, es geht nicht.“
„Aber ihr seid jung und habt keine Kinder. Oskar und ich sind alt und wir wohnen hier zu siebt.“
„Und wie stellst du dir das vor? Heinrich fährt nächsten Monat für einen Vortrag in die Schweiz, von dort wollen wir weiter an den Gardasee. Da kann ich Hermann unmöglich mitnehmen und ich habe nicht vor zuhause bleiben.“
„Was bist du nur für ein egoistischer Satansbraten!“, zischte Henny.
„Satansbraten? Ich gebe dir gleich Satansbraten!“ erregte sich Hannah.
„Menschenskinners! Könnt ihr euch nicht zusammennehmen? Wenigstens an einem Tag wie heute?“ Oskars Gesicht war zornesrot. Nicht einmal einen halben Tag hatte es gedauert, bis Hannah und ihre Mutter aneinandergeraten waren.
„Ist schon gut Vaddern“, sagte Hannah und zündete sich eine Zigarette an. Sie nahm einen tiefen Zug und pustete den Rauch langsam aus. Dann beugte sie sich vor: „Wir machen es so: Der Junge bleibt bei euch und ich schicke euch jeden Monat Geld bis er 14 Jahre alt ist und sein eigenes Geld verdienen kann.“
Oskar sah Henny an. Henny seufzte. Sie wusste, ihre Tochter war durch nichts umzustimmen Sie war genauso dickköpfig und resolut wie sie selbst. Außerdem wagte sie es nicht, ihre älteste Tochter zu bedrängen. Immerhin war es Hannah gewesen, die die Familie durch den Hungerwinter 1946 gebracht und sie auch danach mit dem Nötigsten versorgt hatte. Sie waren eine Familie und die Familie hielt zusammen. Zwar ging sie schon auf die 60 zu, aber hatte sie nicht auch ihre eigenen vier Kinder durch die Depression und durch die Wirren der jungen Republik bekommen? Hermann war ein guter Junge. Ordentlich und fleißig. Und er beklagte sich nie. „Ein besserer Bub als meine Jungs“, wie Henny insgeheim zugeben musste. Also nickte sie.
Die Tür knarrte. Henny erschrak, als sie ihren Enkel im Türrahmen stehen sah. „Hermann, was machst du hier? Ich dachte du schläfst!“ Ihre Stimme klang vorwurfsvoller als beabsichtigt. Henny fühlte sich ertappt, weil sie über ihren Enkel gesprochen hatten. Wie lange mochte er wohl schon dort gestanden haben?
„Ich bin aufgewacht“, sagte Hermann und gähnte. „Ich habe Durst. Und Hunger!“
Hennys Gesichtsausdruck entspannte sich, als sie den zerzausten Jungen ansah. Sein blondes Haar war verstrubbelt, das rechte Bein der langen Unterhose bis zum Knie hochgerutscht - das Kind war ja noch halb am Schlafen! Sie stand von ihrem Stuhl auf und strich ihren Rock glatt. „Na komm man her min Jung! Ich mach‘ dir was zu essen.“
Henny Westen hieß eigentlich Henriette, wurde aber von niemandem so genannt. Sie war klein, rund und runzelig und wirkte wie ein gutmütiges Großmütterchen. Doch das täuschte. Aus ihrem Gesicht blitzten die hellblauen Augen wach und scharfsinnig. Einmal hatte Hermann erlebt, wie Henny eine dahergelaufene Maus mit einem Feudel erschlagen hatte. Ein anderes Mal hatte Henny ihren Mann aus der Kneipe gezerrt nachdem sie spitzbekommen hatte, dass er donnerstags seine Lohntüte als erstes hierhin trug. Seitdem wartete sie Woche für Woche mit ausgestreckter Hand vor dem Werkstor der Werft, wo Oskar als Maler arbeitete. Ohne zu murren, händigte er ihr den Lohn aus. Denn obwohl Henny mindestens zwei Köpfe kleiner war als ihr Mann, gab sie in der Familie den Ton an und Oskar hatte im Laufe der Ehejahre gelernt, seiner Frau nicht zu widersprechen.
Hermann liebte seinen Opa über alles. Sie waren Komplizen im Geiste und Verbündete im Schabernack. Oskar Westen war gutmütig und lustig. Als Hermann noch kleiner war, hatte sein Opa ihm Seemannslieder vorgesungen und Geschichten von früher erzählt. Und wenn Oskar das Lied „Das schmeißt doch einen Seemann nicht gleich um“ anstimmte und bei „so'n lüdden, lüdden, lüdden Buddel Rum“ kräftig das r rollte, klatschte der kleine Hermann vor Vergnügen in seine dicken Händchen.
Mittlerweile war Hermann neun Jahre alt. Er machte es sich auf dem Stuhl vor dem Ofen bequem. Normalerweise war das Hennys Stammplatz. Hier war es schön mollig warm und Henny hatte „Rücken“, wie sie zu sagen pflegte. Hermann stellte seine nackten Füße auf der Stuhlkante auf und schlang seine Arme um die angezogenen Knie. Der Ofen bollerte und verströmte eine angenehme Hitze. Obendrauf knurrte noch die Kanne mit dem Kaffee vom Nachmittag vor sich hin. Sicher war er schon ganz bitter und klebrig. Der Stuhl knarrte, als Hermann sich bewegte. Das Holz war trocken von der Wärme und hatte sich zusammengezogen. Doch noch hielt es. Henny schnitt Hermann eine dicke Scheibe Graubrot vom Laib, bestrich sie mit Butter und Leberwurst und goss ihm Milch in einen Becher. Die Erwachsenen tranken Bier.
„Worüber habt ihr gerade gesprochen?“ fragte Hermann und biss in sein Butterbrot. Es schmeckte herrlich. Die Krume war weich, die Kante knusprig. Henny hatte das Brot auch am Morgen gebacken, genauso wie den Butterkuchen, den er so liebte. Von dem Kuchen jedoch war nichts mehr übrig. Hannah zückte eine neue Zigarette aus ihrer Schatulle. „Nix, was für deine Ohren bestimmt ist“, sagte sie eine Spur zu unwirsch.
Hermann wusste es trotzdem. Sie hatten über ihn gesprochen und wie es mit ihm weitergehen sollte. Er war jetzt nämlich ein Waisenkind. Eine „Vollwaise“ wie er heute gelernt hatte.
Wie fast jeder in seiner Klasse war Hermann ohne Vater aufgewachsen, entweder waren die Väter gefallen, verschollen oder noch in Kriegsgefangenschaft. Und nun war auch seine Mutter tot. Kauend betrachtete Hermann seine Tante. Hannah war 33 und die Älteste von Henny und Oskars Kindern. Seine Mutter Sophie war zwei Jahre jünger gewesen, danach folgten Gerd und mit großem Abstand Hans, der 20 Jahre alt war und von Henny vergöttert wurde. Hannah kam vom Wesen her ganz nach ihrer Mutter, hart im Nehmen und im Geben. Und sie war schön. So schön, dass sie es noch besser getroffen hatte als Else mit ihrem reichen Bauern.
Einige der Trauergäste hatten Hannah seit Jahren nicht gesehen und bemerkten mit einer Mischung aus Neid und Bewunderung die edle Kleidung und den teuren Schmuck, den sie trug. „Die ischa’n büschen etepete geworden“, raunte Frau Diemers ihrem Mann zu als Hannah in die Kapelle trat.
Hermann fand, dass seine Tante ein bisschen aussah wie Rita Hayworth. Erst neulich hatte er die amerikanische Filmschauspielerin auf einem großen Kinoplakat gesehen. Die beiden Frauen hatten die gleichen Haare, die gleichen verführerisch blickenden Augen. Hannahs Gesichtszüge waren zwar etwas markanter, aber der Mund war weich und hübsch geschwungen, die Lippen dunkelrot geschminkt.
Wie eine echte Dame saß Hannah auf dem Holzstuhl. Den Rücken durchgedrückt, die Beine leicht schräg nebeneinander aufgestellt. Und dann ihre Garderobe: Für die Trauerfeier hatte Hannah ein schwarzes Kostüm gewählt. Dazu trug sie schwarze halblange Handschuhe, Nylons und schwarze Pumps. An ihrem Hut, der mehr Kopfschmuck als Bedeckung war, hing ein kleiner schwarzer Schleier, der, wenn sie ihn herunterzog, ihr halbes Gesicht bedeckte. Zuhause zog sie die Handschuhe aus, weiße langgliedrige Finger kamen zum Vorschein, die Fingernägel dunkelrot lackiert. Kaum zu glauben, dass Hannah aus einer Arbeiterfamilie stammen sollte.
Ihre Schönheit war ein Segen für sie alle gewesen. Als die ersten Gerüchte über das „Fräuleinkarussel“ vor dem Kasino der Amerikaner aufkamen, ließ sie sich schon von ihren Liebhabern im Jeep durch die Stadt kutschieren. Stets kam Hannah mit einer Wurst, Konserven oder Zigaretten nach Hause. Henny rümpfte zwar die Nase über ihre älteste Tochter, nahm die Annehmlichkeiten jedoch gerne an. „Jede Zeit erfordert ihre Opfer“, sagte sie entschuldigend.
Den Volltreffer landete Hannah bei einer Abendveranstaltung der amerikanischen Militärregierung in Bremen. Dort lernte sie Heinrich Hesekamp kennen. Hesekamp war Physiker. Vor dem Krieg war er in die USA emigriert. Sein ehemaliger Doktorvater lehrte am Massachusetts Institute of Technology und hatte ihn als seinen Mitarbeiter nachgeholt. An der MIT promovierte Hesekamp und verfasste seine Habilitationsschrift. Gebürtig stammte er aus Bremen. Daher war er gerne der Einladung gefolgt, an jenem Abend die dinner speech über die neuesten Entwicklungen in der Kernphysik zu halten. Von dort aus sollte es für ihn an die Universität Heidelberg gehen, die ihm eine Professur angeboten hatte.
Wie Hannah den spröden Wissenschaftler im Laufe nur eines Abends von sich überzeugen konnte, war Henny ein Rätsel. Auch wie Hannah es überhaupt geschafft hatte, bei der Veranstaltung dabei zu sein. Doch einen Monat später packte Hannah ihre Koffer und zog zu Hesekamp nach Heidelberg, wo die beiden heirateten.
Sophie hätte auch gerne einen Mann kennengelernt. Anfangs, als das Fraternisierungsverbot gerade aufgehoben wurde, hatte sie ihre Schwester zu den amerikanischen Tanzveranstaltungen im Rotkreuzclub in der Glocke noch begleitet. Doch dann wurde sie krank geworden. Hermann hätte nichts gegen einen Amerikaner als Stiefvater gehabt. Im Gegenteil. Er mochte die Amerikaner sehr.
Den ersten sah er als er etwa fünf Jahre alt war. Hermann ging gerade mit seiner Mutter die Obernstraße hoch zur Straßenbahnhaltestelle. Auf der anderen Straßenseite umringte eine Gruppe von Kindern vier GIs. Sie bettelten um Zigaretten, die sie auf dem Schwarzmarkt zu tauschen hofften.
„Häff ju ä Zigarett for mein Vadder?“ hörte Hermann ein Mädchen sagen und sah, wie die GIs den Kindern Schokolade gaben. Er wollte auch hingehen, doch Sophie hielt ihren Jungen fest an der Hand.
„Betteln ist nicht erlaubt“, sagte sie streng und wollte weitergehen. Hermann jedoch blieb stehen und warf den Kindern verstohlene Blicke zu, als ihn einer der Männer bemerkte, sich aus der Gruppe löste und auf ihn zukam.
„Hey, Buddy. What’s your name?" fragte der Soldat, hockte sich vor Hermann hin und entblößte eine Reihe schneeweißer Zähne. In seiner Hand hielt er einen Block Schokolade, die in glänzendes Silberpapier eingewickelt war. Die Haut des Mannes war schwarz. Hermann hatte noch nie zuvor einen Schwarzen gesehen und noch nie so weiße Zähne. Er schmiegte sich eng an die Beine seiner Mutter, konnte aber den Blick nicht von dem Stück Silberpapier abwenden. Der GI lachte, brach eine Rippe von der Schokolade ab und gab sie dem Jungen. Dann klopfte er Hermann auf die Schulter, sprang auf und verschwand. Hermann war verwirrt, in seinem Kopf rasten die Gedanken durcheinander. Noch nie hatte ihm jemand Schokolade geschenkt. Dafür gab es nur eine Erklärung.
„Mama?“
„Ja?“
„War das Papa?“
Sophie schnappte hörbar nach Luft. „Wie bitte? Schätzchen, dein Papa ist im Himmel, das weißt du doch.“
„Ja, aber du hast doch gesagt, dass er ein Soldat war.“
Sophie schaute ihren Sohn an. Es brach ihr das Herz, wie er sie mit seiner Schokolade in der Hand erwartungsvoll anblickte. Sie kniete sich hin, nahm ihn in die Arme und drückte ihn fest an sich. Dann legte sie Hermann beide Hände auf die Schultern und blickte ihm fest ins Gesicht. Sie versuchte ihrer Stimme einen unbekümmerten Klang zu geben: „Stimmt mein Schatz, du hast Recht, dein Papa war Soldat. Der Mann eben war aber ein amerikanischer Soldat. Dein Papa ist schon vor langer Zeit gestorben und liegt auf Bornholm begraben.“
„Bornholm? Ich dachte, er ist im Himmel!“
„Ja, seine Seele ist im Himmel. Begraben ist er auf Bornholm. Das ist eine dänische Insel und weit weg.“
„Ach so.“
Hermann vermisste seinen Vater nicht. Er kannte ihn ja nicht. Nur manchmal, wenn er andere Kinder mit ihren Vätern sah, packte ihn die Sehnsucht. Da fragte er nach und wollte wissen, wie sein Vater ausgesehen hatte. Da lachte seine Mutter nur und sagte: „Dein Vater war genauso ein hübscher Bengel wie du!“
Wenige Monate nach der Begegnung mit dem freundlichen GI erkrankte Sophie. Zunächst war sie nur erschöpft und verspürte trotz der harten Arbeit in der Wäscherei keinen Appetit. Zudem plagte sie ein hartnäckiger Husten. Eines Tages entdeckte Sophie blutige Schlieren im Taschentuch. Henny schalt sie: „Sophie, so geht das nicht, du musst zum Arzt. Oder willst du uns etwa alle anstecken?“
Sophie kam direkt auf die Tuberkulose-Station in Friedehorst. Während ihres Reichsarbeitsdienstes hatte sie Tuberkulosepatienten versorgen müssen und sich offenbar selbst angesteckt. Jetzt erst war die Krankheit ausgebrochen. Immer schon schlank gewesen, magerte sie innerhalb kürzester Zeit ab, so dass sich die Rippen unter der dünnen Haut abzeichneten. Mit einem Mal war ihre Nase keine Stupsnase mehr, sondern ragte spitz aus dem eingefallenen Gesicht hervor. Die zwei Grübchen zeichneten sich scharf auf der bleichen Haut ab. An ihrem Körper war nichts mehr rund und weich. „Wer nimmt mich schon mit diesen Beinen?“, fragte sie Hannah bei einem ihrer Besuche, schlug die Decke beiseite und lachte beim Anblick ihrer dürren Waden und Oberschenkel bitter.
Im Dezember 1950 bestand sie nur noch aus pergamentdünner Haut und Knochen. Die nassgeschwitzten Haare klebten an ihrer Kopfhaut. Hannah versuchte vergeblich, für ihre Schwester Penicillin auf dem Schwarzmarkt zu ergattern. Das Medikament galt als das neue Wunderheilmittel. Doch es war knapp und nur für Amerikaner zur Syphilis-Behandlung vorgesehen, da halfen auch Hannahs gute Beziehungen nichts. Wegen der Ansteckungsgefahr durfte Hermann seine Mutter im Krankenhaus nicht besuchen. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als sich unten in den Krankenhauspark zu stellen und ihr von dort zuzuwinken. Seine Mutter winkend auf einem Balkon. Dies sollte das Letzte sein, was Hermann von seiner Mutter zu sehen bekam. Am Ende schaffte sie es nicht mehr von dem Stuhl hoch. Im März 1951 starb Sophie mit 31 Jahren. Und Hermann sollte in jenem Sommer zehn Jahre alt werden.
Das Fahrrad
In den ersten Wochen nach ihrem Tod dachte Hermann noch oft an seine Mutter. Auch als sie bereits im Krankenhaus gelegen hatte, war sie in seinem Alltag präsent. Man unterhielt sich über ihren Gesundheitszustand, sie strickte Strümpfe für alle und ließ ihm Grüße ausrichten. Jetzt sprach kaum noch jemand von ihr und seine Erinnerungen verblassten. Das Schlimmste für ihn war, dass er sich fortan das Zimmer mit Hans teilen musste. Hans war ein unberechenbarer Taugenichts. Ein falsches Wort und Hermann bekam eine Backpfeife. Seine Mutter hatte ihn immer beschützt, wenn Hans ausrastete, nun musste er alleine mit seinem Onkel zurechtkommen. Auf seine Großeltern konnte er in diesem Fall nicht zählen. Hans passte die Augenblicke ab, wo er alleine mit Hermann war. Und wenn Hermann sich an seine Großeltern wandte, so fand Henny immer eine Ausrede für ihren jüngsten Sohn. Henny liebte diesen Nichtsnutz auf sonderbare Weise und Oskar durfte sich nicht einmischen.
So oft es ging, verbrachte Hermann die Zeit draußen. Sein bester Freund war Jürgen Koch. Sie wohnten im gleichen Haus und gingen in die gleiche Klasse. Meist spielten sie Fußball. Ihr Nachbar Herbert Schlehn besaß eine Kirsche, einen echten Lederball. Der Ball war dunkelbraun und hatte eine dicke weiße Naht. Eines Nachmittags spielten sie vier gegen vier. Einer im Tor, drei auf dem Feld. Herbert wählte Jürgen, Hermann und Schorse in seine Mannschaft. Mit ihren Pullovern markierten sie die Tore. Sie waren mitten im Spiel, als Jürgen den Ball nach links verschoss. Sie hörten Glas klirren und eine Frau vor Schreck laut aufschreien.
„Mist!“, fluchte Herbert.
„Au Backe!“ sagte Schorse.
„Ausgerechnet bei der Martens, die meckert eh schon immer rum!“ stöhnte Hermann.
Nur Jürgen sagte nichts. Er blickte ungläubig auf die zerborstene Scheibe.
„Was ist Jürgen? Hol den Ball!“, forderte Herbert ihn auf.
„Mein Vater“, sagte Jürgen. „Wenn mein Vater das mitkriegt.“ Seine Augen füllten sich mit Tränen. Er schluckte.
„Ich geh‘ schon“, sagte Hermann.
„Was?“ Jürgen schaute Hermann an.
Der nickte und wiederholte: „Ich geh‘ und hole den Ball.“
Hermann verschwand im Hauseingang. Er würde einfach behaupten, er sei es gewesen. Zwar wusste er nicht, wie er es Henny und Oskar beibringen sollte, aber wenigstens drohte ihm kein Unheil. Manchmal war es eben doch besser, wenn man keinen Vater hatte, zumindest keinen, der einen prügelte. Zaghaft drückte er auf die Klingel von Frau Martens. Später wusste er nicht mehr, was sie ihm alles entgegengeschleudert hatte. Er erinnerte sich nur an ihr dickes rotes Gesicht und ihren verzerrten Mund. Er murmelte eine Entschuldigung, doch die Martens weigerte sich, ihm den Ball auszuhändigen. Hermann verstand, dass sie auf eine Entschädigung pochte. Er nickte ungeduldig.
„Ja, machen wir doch, ich sage meinem Opa Bescheid, der repariert das wieder!“
Henny schnaubte, als sie von dem Unglück hörte. „Und warum nimmst du das auf deine Kappe? Das kann doch Jürgens Vater selber reparieren, das müssen wir doch nicht machen!“
„Bitte Oma, du darfst Jürgens Eltern nichts sagen. Jürgen hat versprochen, die Scheibe zu bezahlen. Er wird das Geld schon irgendwie besorgen. Opa muss sie nur einsetzen, sonst fliegt alles auf“, bettelte Hermann.
Henny warf Oskar einen Blick über den Tisch zu. Sie saßen in der Küche. Lore hatte Axel nach seinem Mittagsschlaf geweckt und versuchte ihm beizubringen, mit Messer und Gabel den Kartoffelbrei und die Frikadellen zu essen. Hans war beim Boxtraining. Gerd las die Zeitung.
„Also wenn ihr mich fragt, würde ich es machen“, sagte Lore und sah auf. Axel nutzte den Augenblick, langte mit seiner Hand in den Kartoffelbrei und schmierte ihn in seine Haare. „Oh du Ferkelchen!“ schimpfte Lore.
„Dich hat aber keiner gefragt. Jetzt siehste, was du davon hast!“ sagte Gerd bösartig. Lore warf ihm einen wütenden Blick zu, verkniff sich aber eine Erwiderung.
Da stand Oskar auf.
„Oskar, wo willst du drauf los?“ fragte Henny.
„Ich hol‘ den Hammer und mach der Martens erst einmal ein Brett vors Fenster. Jürgen soll die Scheibe besorgen, dann erledige ich den Rest“, antwortete er und ging Richtung Keller. Hermann rannte ihm hinterher. Von hinten umschlang er Oskars Beine. „Danke Opa!“
„Da nicht für!“ Er streichelte Hermann über den Schopf. „Los, und jetzt sag Jürgen Bescheid!“
Hermann stürmte aus der Wohnung. Erleichtert über den Ausgang und froh, der schlechten Stimmung zwischen Gerd und Lore entkommen zu sein.
Wochen später – die Scheibe war längst repariert – stiegen die Temperaturen bereits in der ersten Juniwoche auf über 25 Grad. Es war heiß und Jürgen holte Hermann zum Schwimmen ab.
„Hermann, nu‘ komm inne Puschen!“ Ungeduldig trat Jürgen von einem Bein aufs andere. Seine Haare waren verschwitzt und die Kniestrümpfe verrutscht. Er, der eh stets gerötete Bäckchen zu haben schien, glühte heute noch mehr, aber nicht, weil ihm so warm war, sondern vor Aufregung.
Hermann schulterte seine Tasche mit den Schwimmsachen und sprang die letzten Stufen runter auf den Bürgersteig. Jürgen wippte auf den Zehen und strahlte.
„Was ist los? Warum hast du es so eilig?“, fragte Hermann.
„Die haben bei Dutschke ein neues Fahrrad! Das musst du dir angucken! Komm mit!“
„Ich dachte, wir wollten schwimmen gehen!“
„Danach! Komm, es dauert nicht lange!“
Jürgen hatte von seinen Eltern zu seinem zehnten Geburtstag ein eigenes Fahrrad versprochen bekommen. Seitdem redete Jürgen von nichts anderem mehr. Sie überquerten die Gröpelinger Heerstraße und bogen in die Lindenhofstraße ein. Vor dem Schaufenster des Fahrradhändlers blieben die beiden Jungs stehen. Hermann sah das Fahrrad sofort. Genauer gesagt, waren es zwei. Zwei Sporträder. Ein weinrotes und ein blaues. Davor ein Reklameschild mit einem Foto von einem Hercules-Fahrrad, das mit einem Seil zwischen zwei Zugwaggons befestigt war.
„Mensch, schau dir das an. Guck mal, was da geschrieben steht: ‚Stark wie der sagenumwobene Held Hercules! Dieses Fahrrad kann acht vollbeladene Waggons hinter sich herziehen und hat die berühmte Zerreißprobe mit Bravour bestanden!“ las Jürgen laut vor. Seine Augen leuchteten und auch Hermann war fasziniert. Er trat näher an die Schaufensterscheibe heran und schirmte seine Augen vor der blendenden Sonne ab. Das rote Fahrrad gefiel ihm besonders. Es hatte einen leicht geschwungenen Lenker mit blanken Handgriffen. Auf dem Boden drapiert lagen die dazugehörigen Lenkerbänder in schwarz und weiß. Daneben noch ein Tachometer und eine Radlaufklingel. In einem Ständer steckte eine Auswahl bunter Wimpel. An ihnen baumelten die Preisschilder. Hermann rechnete. Lautlos bewegte er seine Lippen. Insgesamt 300 Mark würde das Fahrrad samt Utensilien kosten. Sein Blick verfinsterte sich.
„Komm, lass uns reingehen!“, sagte Jürgen.
„Nee, geh mal alleine. Ich warte hier auf dich“, erwiderte Hermann.
Jürgen sah Hermann enttäuscht an. Dann zuckte er die Schultern und stieß die Tür auf. Ein Glöckchen bimmelte und die Tür fiel ins Schloss.
Unschlüssig blieb Hermann vor dem Schaufenster stehen. Mit den Händen in den Hosentaschen kickte er die kleinen Steinchen auf dem Bürgersteig weg. Nach außen hin gab er sich unbekümmert, doch in seinem Inneren rumorte es. Wütend krallte er seine Finger an dem Innenfutter seiner Hosentaschen fest. Gerne hätte er auch ein neues Fahrrad. Aber er konnte es sich nicht leisten. Stattdessen fuhr er Opas altes schwarzes Fahrrad, das viel zu groß und zu schwer für ihn war. Er musste im Stehen fahren, anders kam er nicht an die Pedale ran. Er spürte einen leichten Anflug von Neid auf seinen Freund und schämte sich im gleichen Augenblick dafür. Noch nie hatte er etwas Neues besessen oder geschenkt bekommen. Stets bekam er die abgetragene Kleidung von Hans und Gerd zum Anziehen. Die Hemden waren meist geflickt, die Hosen zu kurz oder zu lang, der Saum abgelassen oder der Stoff dünn gescheuert und verschlissen. Selbst seine Strümpfe und Schuhe waren gebraucht.
Jedes Mal, wenn er einen Schuss gemacht hatte, nahm Henny ihn bei der Hand und ging mit ihm zur Schuhtauschzentrale. Für Hermann war es ein Graus, die gebrauchten Schuhe anderer Menschen aufzutragen. Er schüttelte sich bei dem Gedanken an das Gefühl, das ihn befiel, wenn seine Füße die Wölbungen berührten, die die Füße seines Vorgängers im Schuhbett hinterlassen hatten. In der Kleiderkammer war es nicht besser. Henny wickelte die Strümpfe einmal um seine Faust und wenn das langte, nahm sie sie mit. Hermann träumte von einem eigenen Paar neuer Schuhe. Doch das Geld, das Tante Hannah schickte, deckte gerade einmal seinen Anteil für Kost und Logis sowie die Kosten für die Schulsachen ab. An ein Fahrrad war da gar nicht erst zu denken.
Die Türglocke klingelte erneut. Mit einem breiten Grinsen trat Jürgen auf die Straße.
„Hast du das gesehen? Ich durfte das Fahrrad sogar fahren.“
Hermann zuckte mit den Schultern. Jürgen war sein bester Freund, doch in Momenten wie diesen verspürte er einen leichten Stich ins Herz. Denn im Gegensatz zu ihm hatte Jürgen noch beide Eltern, zwei Brüder und eine Schwester.
„Du hättest wirklich mit reinkommen sollen“, sagte Jürgen. Er ahnte Hermanns Gedanken, trotzdem war er enttäuscht, dass sein Freund seine Freude nicht mit ihm teilen konnte.
„Ja, ja, das nächste Mal“, knurrte Hermann. „Lass uns jetzt schwimmen gehen!“
Wie aus Jacek Jürgen wurde
Ursprünglich stammte Jürgen aus Schlesien. 1940 musste der Vater an die Front und kam direkt nach Stalingrad und von dort in russische Kriegsgefangenschaft. Als der Krieg 1945 endete und die Russen nach Schlesien vorrückten, floh Jürgens Mutter Roswitha mit den vier Kindern und ihrer Schwester Magdalena über Schwerin nach Delmenhorst. Sie strandeten in Bremen-Nord in einem Flüchtlingslager und suchten den Vater über das Rote Kreuz. Und dann, eines Tages, stand er plötzlich vor ihrer Baracke. Abgemagert und verhärmt. Selbst die ältesten Kinder erkannten den Vater nicht wieder. Nur Jürgens Mutter stieß einen spitzen Schrei aus, als sie ihren Mann sah und warf sich gegen seine Brust. Jürgen würde wohl nie dieses Bild vergessen, wie seltsam unbeholfen der fremde Mann dastand, seine Arme hob und wieder sinken ließ. Regungslos ließ er die Küsse und Umarmungen seiner Frau über sich ergehen.
110.000 deutsche Soldaten waren nach der Schlacht von Stalingrad in russische Kriegsgefangenschaft geraten, nur knapp 6.000 kamen zurück. Pawel war einer der wenigen Glücklichen. Roswitha päppelte ihren Mann in den Monaten nach seiner Rückkehr mit allem auf, was sich auf den Kohl- und Rübenfeldern der Bauern finden ließ und was sie sich vom Munde absparen konnte. Es dauerte nicht lange und das Paar fand in seine alten Rollen zurück. Zwar hatten Roswitha und Magdalena die Familie durch die schwerste Zeit nach dem Krieg gebracht, aber nun war der Mann zurück im Haus.
Der Vater sprach nicht viel, wenn, dann brüllte er. Kein Wort verlor er über die Front oder die Gefangenschaft. Nach außen hin hatte er keine sichtbaren Verletzungen außer zwei erfrorene Zehen, weswegen er humpelte. Er trank und die Kinder lernten schnell, dass es besser war, ihm zu gehorchen. Wenn sie es nicht taten, setzte es eine Tracht Prügel. Nur abends, wenn Pawel mit den anderen Männern beim Schnapsbrennen zusammensaß, sprachen sie leise über den Krieg. Jürgen folgte seinem Vater oft heimlich und versteckte sich in einer dunklen Ecke. Hier lauschte er den Erzählungen der Männer und bestaunte die kupferglänzenden Kessel.
1948 bekamen Jürgens Eltern die Wohnung in Gröpelingen zugewiesen. Und Pawel, kriegsversehrt zwar, aber intakt genug, um am Band zu arbeiten, konnte ein Jahr später bei Borgward in der Motorenfertigung anfangen, wo er gut verdiente. Trotzdem hatte die Familie es schwer.
„Geht wieder dahin zurück, wo ihr hergekommen seid ihr Polacken“, wurden sie ein ums andere Mal beschimpft, wenn sie als Flüchtlinge erkannt wurden. Um nicht aufzufallen, versuchten die Eltern ihren Akzent so gut es ging zu unterdrücken. Und sie änderten ihre Namen. Aus Pawel Kociak wurde Paul Koch, aus Roswitha Rosemarie, aus Magdalena Marianne, aus Jacek Jürgen, aus Marek Markus, aus Eugen Ernst und aus Jadwiga Johanna.
Hermann wusste von alldem natürlich nichts. Eigentlich kümmerte es keinen aus seiner Klasse, wenn nicht die Eltern gewesen wären, die zuhause am Abendtisch schimpften, dass „die Polacken“ ihnen nicht nur die Unterkünfte und das Essen, sondern jetzt auch noch die Arbeit wegnehmen würden. Henny und Oskar redeten so nicht. Sie hatten zwei Kriege erlebt und waren ausgebombt worden. Sie wussten, was Hunger und der Verlust der Heimat bedeuteten. Vielleicht war Hermann deswegen so unvoreingenommen im Umgang mit Jürgen, der ihm das mit tiefer Freundschaft dankte.
Lankenauer Höft
Der Sommer hielt, was der Juni versprochen hatte. Es blieb heiß und trocken. Vereinzelt gab es Wärmegewitter, die jedoch keine Abkühlung brachten. Jürgen wurde zehn und bekam das blaue Fahrrad aus dem Laden geschenkt.
Fröhlich klingelnd radelte Jürgen durch die Straßen, während Hermann nichts anderes übrigblieb als auf Oskars altem Fahrrad keuchend hinterher zu strampeln. Immer im Blick den bunten Wimpel, den Jürgen am Gepäckträger befestigt hatte, und der lustig hin und her hüpfte, wenn Jürgen den Bordstein hoch- und runterfuhr.
Auf der Straße spielte eine Gruppe von Mädchen mit dem Kreisel. Sie hielten inne und schauten dem Zweiergespann hinterher. Vor dem Grünstreifen knieten die Nachbarsjungen und versuchten einen Pot Murmeln aus einem Erdloch zu befördern. Bei Hermanns Anblick fingen sie an zu lachen.
„Ist wohl eine Nummer zu groß für dich, was Hermann?“ spottete einer. Hermann erkannte, dass es Manfred aus der Selsinger Straße war. Bockig warf er den Kopf in den Nacken und rief zurück: „Lach du nur. Mein Fahrrad steht noch bei Dutschke im Keller. Nächste Woche kann ich es abholen.“
Das war natürlich gelogen. Also schäumte Hermann und malte sich aus, wie er Manfred bei der nächsten Gelegenheit ein paar auf die Nase geben würde. Jürgen nahm von alldem nichts wahr. Stolz klingelte er die Passanten aus dem Weg, die ihm mit dem Finger drohten. Über die Gröpelinger Heerstraße bogen sie in die Grasberger Straße Richtung Fähranleger. Sie setzten über zum Lankenauer Höft, wo sie schwimmen gehen wollten. Hermann lehnte sich an die Reling und betrachtete das braungrüne Wasser, das in kleinen Wellen sachte gegen die Schiffswand schlug.
„Alles in Ordnung?“, fragte Jürgen.
„Hmm!“, brummte Hermann.
„Ach komm, mach dir nichts draus was der Manfred sagt. Irgendwann verdienst du ganz viel Geld und dann kaufst du dir den roten Hercules!“
„Hmm!“, sagte Hermann wieder.
Jürgen drehte sich um und lehnte sich ans Geländer. Aufgeregt knuffte er Hermann in die Seite. „Guck mal da!", sagte er und wies mit dem Kinn auf eine Gruppe von Mädchen.
Hermann schaute auf die andere Seite des Schiffes. Dort standen vier Mädchen, unter ihnen Lisbeth aus der Parallelklasse. Kichernd drehte sie sich weg als sich ihre Blicke kreuzten.
„Du hast vielleicht kein eigenes Fahrrad, aber die Mädchen mögen dich trotzdem!", griente Jürgen.
„Blödmann!“ sagte Hermann und knuffte Jürgen zurück. Sein Ärger war verraucht.
Am Strand ließen sie zuerst Steine über die Weser ditschen. Doch es war zu heiß. Flink zogen sie sich aus. An einem Baum hatte jemand ein Seil befestigt. Mit großem Geschrei schwangen sie sich über den Fluss und ließen sich in das tiefe Wasser plumpsen. Hermann war ein guter Schwimmer und kraulte raus zur Mitte des Flusses. Oskar hatte ihm schon früh Brust- und Kraulschwimmen beigebracht.
Oskar war gebürtiger Berliner. Als Soldat war er bei der Preußischen Armee und hatte dort die Köpenickiade erlebt, zumindest behauptete er das. Demnach war er gerade mit seinen Kompagnons auf dem Weg zum Schwimmtraining in der Müggelspree als sie von einem Hauptmann nach dem Weg zum Köpenicker Rathaus gefragt wurden. Ein ganzer Zug begleitete den Hauptmann schließlich dorthin. Der Hauptmann besetzte das Rathaus und raubte die Staatskasse. Wie sich später herausstellte, war der Hauptmann jedoch gar kein Hauptmann, sondern ein verkleideter Schuster. Der Streich ging als Köpenickiade in die Geschichte ein und die junge Republik lachte über die obrigkeitshörigen Beamten und Soldaten.
Bei Oskars Geschichten wusste man nie so recht, was Wahrheit und was Legende war. Er erzählte so allerlei Seemannsgarn. Doch meistens enthielten seine Geschichten einen Kern von Wahrheit, den er mit Spinnereien auszuschmücken verstand. Doch ganz gleich, ob die Geschichte wahr war oder nicht, Oskar war ein hervorragender Schwimmer. Er konnte länger tauchen und die Luft unter Wasser anhalten als alle anderen Menschen, die Hermann kannte. Und er konnte im Handstand die Treppe hoch- und runterlaufen.
Mit ein paar kräftigen Armzügen schwamm Hermann weit raus. Er drehte sich auf den Rücken und ließ sich treiben. Mit den Ohren unter Wasser nahm er die Geräusche vom Strand nur gedämpft wahr. Er hatte das Gefühl, zu schweben und fing an zu träumen. Eines Tages würde er richtig viel Geld verdienen. Dann würde er sich ein eigenes Fahrrad kaufen und jeden Tag einen anderen Anzug anziehen mit Oberhemd, Krawatte und einem Hut mit dem richtigen Kniff und allem, was dazu gehörte. Da platschte ein Ball neben Hermanns Kopf auf und holte ihn unsanft in die Realität zurück.
„He du Drömelkopp, komm her! Wir brauchen dich hier!“, rief Jürgen, der tropfnass am Ufer stand und lachte.
Onkel Hans
Der Sonntag war der langweiligste Tag der Woche. Morgens um neun fuhr Jürgen geschniegelt und im schneeweißen Hemd zur katholischen Messe in die Stadt. Erst zur Mittagszeit kam er wieder zurück und musste dann erst einmal mit der Familie essen, bevor er sich mit Hermann treffen durfte.
Hermann saß beim Frühstück und stippte seinen Zwieback in die warme Milch. Danach trottete er raus auf den Innenhof. Am Vorabend hatte es noch ein Gewitter gegeben und sein Fußball, der diesen Namen nicht wirklich verdiente, hatte sich mit Regenwasser vollgesogen. Der Ball war kein echter Lederball, sondern ein aus Lumpen zusammengenähter Klumpen und vom Regen so schwer und nass, dass er nach jedem Schuss gegen die Hauswand tief schmatzend auf den Boden fiel und auf der Stelle liegen blieb. Zu schwer, um weiterzurollen. Hermann entwickelte den Ehrgeiz, das gesamte Regenwasser aus dem Ball herauszutreten. Wieder und wieder trat er den Ball gegen die Hauswand und hatte nur die dunklen Flecken im Blick, die der Ball auf der hellen Mauer hinterließ. Er war so konzentriert, dass er die herannahenden Schritte nicht hörte.
Plötzlich wurde er am Nacken gepackt und rumgerissen. „Ich habe gesagt, du sollst aufhören“, brüllte Hans ihn an.
Hermann blickte in das hassverzerrte Gesicht seines Onkels. Die Zähne gefletscht, die Augen zu Schlitzen verengt, aus dem Mund flogen Speichelfetzen. Noch nie hatte Hermann so etwas Hässliches gesehen. Und dann schlug Hans mit voller Wucht zu. Hermann hörte das Brechen seiner Nase. Es folgte ein kurzer heftiger Schmerz, er strudelte in ein tiefes schwarzes Loch. Bewusstlos fiel er auf den Boden. Hans warf sich auf den erschlafften Körper seines Neffen und drosch auf ihn ein.
Henny eilte in den Innenhof und versuchte, Hans wegzureißen. „Bist du verrückt geworden! Hans, Hans!“
Blind vor Wut schlug Hans nach seiner Mutter und traf sie mit dem Handrücken im Gesicht. Henny stieß einen spitzen Schrei aus. Da kam Oskar angerannt. Er warf sich auf seinen Sohn und umschlang ihn mit seinen langen Armen. Hans raste und brüllte und versuchte, sich aus dem Klammergriff zu befreien, doch Oskar hielt ihn fest. Widerwillig beruhigte sich Hans und hörte auf, um sich zu treten und zu schlagen. Keuchend verharrten Vater und Sohn auf dem Boden.
„Lass mich los!“ zischte Hans und stieß seinen Vater weg. „Die kleine Kröte hat selbst schuld!“
Dann ging er weg, als ob nichts geschehen sei. Henny duckte sich intuitiv und Oskar trug den bewusstlosen Hermann ins Haus.
„Mein Junge, mein lieber Junge!“ Oskar weinte. Er legte Hermann in sein Bett. Henny kam nach, stumm, verstört. Als sie Hermanns entstelltes Gesicht sah, besann sie sich und holte eine Schüssel mit kaltem Wasser aus der Küche und einen Waschlappen. Hermanns Nase war geschwollen und rot. Als Hermanns Augenlider sich flatternd öffneten, sah er seine Großmutter zittern.
„Hermann bitte, du darfst den Hans nicht reizen!“ flüsterte sie.
„Aber Oma, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gespielt!“ Hermanns Augen brannten, er fing an zu weinen. Seine Haut spannte und schmerzte. „Ich glaube, meine Nase ist gebrochen. Es tut so weh. Ich kriege keine Luft.“
„Bitte versprich mir Hermann, dass du Hans aus dem Weg gehst. Wir können dich nicht beschützen“, sagte Henny leise. Sie tauchte den Lappen ins Wasser und kühlte Hermanns Gesicht. Am Abend holte Oskar Doktor Klamroth.
„Ich kann nicht versprechen, dass die Nase wieder gerade wird. Dafür haben sie zulange gewartet. Was ist denn überhaupt passiert?“ fragte der Arzt.
„Hermann hat Fußball gespielt und ist mit dem Gesicht auf einen Pflasterstein gefallen“, log Henny.
„Aha“, sagte Doktor Klamroth und zog die Augenbrauen hoch, unschlüssig, ob er der Geschichte Glauben schenken sollte oder nicht. Er entschied sich für ersteres, bandagierte Hermanns Nase und verließ die Wohnung.
Im Bett hörte Hermann wie sich Henny und Oskar heftig stritten. Das geschah nicht oft. Oskar brüllte und seine Großmutter weinte. Zu erschöpft, um sich darüber zu wundern, schlief er ein.
Seine Nase heilte ohne Komplikationen. Nur wer genau hinsah, bemerkte, dass sie etwas schief war. Hans tat so, als sei nichts geschehen. Doch Hermann war seit dem Vorfall noch mehr auf der Hut und ging Hans so gut es ging aus dem Weg. Er war froh, dass Hans die meiste Zeit im Boxclub oder in der Kneipe verbrachte. Von ihm aus konnte er bleiben, wo der Pfeffer wuchs und Hermann schwor sich, niemals solch ein Saufbold wie Hans zu werden.
Auch nach den Ferien blieb es warm. Die Hitze staute sich im Klassenraum und die Schüler brüteten über den Mathematik-Aufgaben. Kopfrechnen war Hermanns Stärke und meist ging er als Sieger aus der Mathe-Olympiade hervor, die sich Lehrer Cordt Hansen für sie ausgedacht hatte. Hierbei traten immer zwei Schüler im direkten Stechen gegeneinander an. Wer als erster die Rechenaufgabe im Kopf gelöst hatte, durfte stehenbleiben und sich mit seinem nächsten Herausforderer messen. Eines Nachmittags bat Hansen den Jungen nach dem Unterricht zu sich nach vorne.
„Hermann, sag mal, wer übt mit dir zu Hause Rechnen?“
„Keiner“, antwortete Hermann wahrheitsgetreu.
„Hmm.“ Hansen strich über seinen Schnäuzer. „Deine Eltern leben nicht mehr, richtig?“
„Ja, das ist richtig.“ „Und du wohnst bei deinen Großeltern?“, fragte Hansen.
„Ja.“
„Gut, dann richte ihnen bitte aus, dass ich sie sprechen möchte. Sagen wir nächste Woche Dienstagnachmittag?“
Hermann durfte in der Küche bleiben, als der Lehrer kam. Herr Hansen setzte sich auf die Bank und wartete während Henny ihm Kaffee in die Tasse goss. Freundlich nickte er Hermann zu, der nervös auf seiner Unterlippe kaute. Henny und Oskar setzten sich Hansen gegenüber an den Tisch.
„Der Junge hat doch nichts angestellt, hoffe ich?“ eröffnete Henny das Gespräch.
„Nein, um Gottes Willen, nein!“ Herr Hansen hob beschwichtigend die Hände. „Im Gegenteil. Ich bin wegen etwas anderem hier. Die Prüfung für die höhere Schule steht an und ich wollte fragen, ob sie Hermann dafür anmelden wollen.“
„Welche Prüfung?“, fragte Henny.
„Die Prüfung nach der Grundschule. Sie können Hermann natürlich die vollen sechs Jahre in der Grundschule lassen, aber ich glaube, der Junge könnte jetzt schon wechseln. Ein Versuch wäre es wert. Er ist sehr gut im Rechnen und seine Diktate sind tadellos.“ Hansen blickte die Eheleute erstaunt an. „Wussten Sie das gar nicht?“
„Ja, doch, schon…“ stotterte Henny. „Aber da sagen Sie was Herr Hansen! Ehrlich gesagt, haben wir uns darüber noch gar keine Gedanken gemacht.“
„Haben Sie denn noch gar nicht darüber gesprochen, was Hermann später einmal machen könnte?“, fragte Hansen.
Henny schaute zu Hermann. „Nun ja. Wir dachten, dass er die Volksschule zu Ende bringt und dann in die Lehre geht. Maler, Schlosser, irgendwie sowas.“
„Nun“, sagte Hansen „es ist natürlich Ihre Entscheidung. Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass Hermann auch aufs Gymnasium gehen könnte. Und wenn Sie es ihm ermöglichen können, würde ich Ihnen empfehlen, das zu tun!“
Als Hansen weg war, sah Henny Hermann nachdenklich an. „Ach min Jung, was sollen wir nur mit dir machen, was soll nur aus dir werden?“ sagte sie und strich ihm über den Kopf.
„Na wat schon?“, sagte Oskar ärgerlich. „Wenn der Junge tüchtig ist, kann er alles werden. Vielleicht kann er sogar mal studieren?“
„Und wer soll das bezahlen?“, fragte Henny. „Du hast doch gehört, was Hannah gesagt hat. Bis der Junge 14 ist, zahlt sie für ihn. Danach muss er für sich selber aufkommen.“
Hermann war das nur recht. Er wollte möglichst schnell sein eigenes Geld verdienen und nicht mehr abhängig sein vom Wohlwollen anderer. Und bald wusste er auch schon, womit er sein Geld verdienen wollte.
Stapellauf des Frachters Werratal
Im Potsdamer Abkommen 1945 hatten sich die Alliierten auf ein Schiffbau- und Flugzeugbau-Verbot für die Deutschen geeinigt. Das Verbot traf Bremen hart und Bremens Bürgermeister Wilhelm Kaisen nutzte jedes Treffen mit der amerikanischen Militärregierung und der deutschen Bundesregierung, um auf eine Aufhebung des Verbots zu drängen.
„Bremen kann seine Wirtschaftskraft nur aufrechterhalten, wenn Schiffe gebaut werden und Schifffahrt betrieben werden darf“, wiederholte Kaisen wie ein Mantra in den Gesprächen mit den Amerikanern und Adenauer.
Letztlich konnten die Amerikaner ihre Augen nicht vor den Nöten der hungernden deutschen Bevölkerung verschließen. Im März 1949 gab es eine erste Lockerung und kleinere Schiffe wie Fischdampfer durften gebaut werden. Ein halbes Jahr erzielte der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer das Ende der Demontagen der Schiffswerften und die Bremer Werft A.G. Weser erhielt die Erlaubnis, Schiffsreparaturen durchzuführen. So kam Oskar, da schon fast 60 Jahre alt, noch einmal als Betriebsmaler in Lohn und Brot.
Kaisen gab sich damit jedoch nicht zufrieden und drängte auf weitere Verbesserungen. 1950 flog er nach Washington, wo die westalliierten Außenminister der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs – Dean Acheson, Ernest Bevin und Robert Schuman – zusammengekommen waren, um über den Wiederaufbau Deutschlands zu beraten. Er bat um Vorlass und sprach direkt beim französischen und britischen Außenminister sowie Acheson Staatssekretär Foster Dulles vor.
„Die Menschen müssen arbeiten, um sich durchbringen zu können. Wir müssen Nahrung importieren, uns fehlen die Agrargebiete des Ostens. Millionen Flüchtlinge haben wir aufgenommen und in diesem brodelnden Kessel des ausgemergelten Landes soll eine Demokratie aufgebaut werden? Ziel des Marshall-Plans ist es, dass alle Länder am Wettbewerb teilhaben sollen. Wie soll das gelingen, wenn wir einen großen Teil der Gelder für Frachtkosten aufbringen müssen?“
Kaisen sprach kein Englisch. Doch bei jedem seiner Sätze ließ er die Faust auf die Tischplatte sausen. Kaisens Anliegen fand Gehör. Im April 1950 erhielt die A.G. Weser die Genehmigung für den Bau neuer Export- und Handelsschiffe. Der Frachter Werratal war der erste Neubau, der am 10. Mai 1952 in Bremen vom Stapel lief.
„Henny, mach dich fein du flotte Deern! Wir gehen jetzt aus!“ Vor lauter Freude gab Oskar seiner Frau einen kräftigen Klaps auf den Hintern, nur um im nächsten Moment zu fluchen: „Wo zum Teufel ist mein guter Anzug?“
„Nun mal sachte Oskar. Schau doch erst einmal in den Schrank, bevor du schimpfst! Er ist da, wo er immer ist. Aber guck erst einmal, ob auch keine Mottenlöcher drinne sind!“ antwortete Henny.
„Was ist denn los Opa?“ fragte Hermann. Er studierte die Fußballergebnisse im Sportteil der Zeitung und blickte seinen Opa verwundert an.
Oskar tippte auf die Titelseite des Weser Kuriers. „Heute läuft die Werratal vom Stapel.“
Hermann sprang von seinem Stuhl auf. „Stimmt ja, hätte ich beinahe vergessen. Ich sag schnell Jürgen Bescheid!“ Er rannte los, um seinen Freund zu holen.
„Warte Hermann, du musst dir noch was Vernünftiges anziehen!“, rief Oskar ihm hinterher, doch Hermann hörte ihn schon nicht mehr.
Die Sonne strahlte und aus allen Ecken strömten die Gröpelinger zum Helgen. Keiner wollte das Großereignis verpassen. Gleich drei Motorfrachter hatte die Hamburger Reederei J.A. Reinecke bei der A.G. Weser bestellt. Heute sollte der erste getauft werden.
Henny, Oskar, Hermann und Jürgen reihten sich in die Menschentraube ein. Es ging nur schleppend voran, also beschleunigten Hermann und Jürgen ihre Schritte und verloren Henny und Oskar aus den Augen. Schon von weitem sahen sie den Frachter in der Sonne glänzen. Die Ankerketten zierten in hübschen Bögen den Schiffsrumpf. „Wie die Halskette von Tante Hannah“, dachte Hermann. Er fühlte sich gelöst und beschwingt zugleich. Stolz, dass sein Großvater auf der gleichen Werft arbeitete, die dieses Schiff gebaut hatte.
Der Wind wehte leicht. Gemächlich bauschte sich die Bremer Speckflagge auf. Es herrschte eine ruhige, erwartungsfrohe, fast schon andächtige Stimmung. Neben den Hunderten Schaulustigen waren der Bremer Senat, der amerikanische Landeskommissar Charles Richardson Jeffs, Vertreter der Gewerkschaften und der Bundesregierung sowie eine Delegation der Hamburger Reederei erschienen. Hermann hörte den Ausführungen des technischen Werftleiters konzentriert zu. Anfangs sei der Neubau eine Herausforderung gewesen. Walzmaterial war knapp, Hallen und Hellinge noch nicht ausgestattet. Doch sie hatten es geschafft. Hermanns Wangen glühten vor Aufregung. Er blickte nach hinten und sah seinen Großvater winken. Er freute sich und winkte zurück. Oskar kämpfte sich gemeinsam mit Henny zu ihm durch.
Leicht verärgert bemerkte Oskar, dass der Taufpate ein Mann war. „Wie kann man nur so ignorant sein. Taufpate muss immer eine Frau sein, sonst bringt das Unglück!“, grummelte er.
„Oskar, nun hab dich nicht so. Du immer mit deinem Aberglauben“, schimpfte Henny.
„Das ist kein Aberglaube, das ist Tradition!“, konterte Oskar und reckte seinen dürren Hals.
Hermann lachte. Ihm war es gleich, ob ein Mann oder eine Frau das Schiff taufte. Normalerweise oblag diese Ehre sowieso dem Auftraggeber und seinen Angehörigen, doch in dieser historischen Situation hatte der Reeder dem Bremer Wirtschaftssenator den Vortritt gelassen. Hermann Apelt schleuderte die Sektflasche kräftig gegen die Bordwand. Das Glas zerschellte, der Sekt schäumte und als ob das Schiff zu wissen schien, dass der heutige Tag, der Sonnenschein und der Auflauf am Kai einzig und allein ihm galten, glitt es erst langsam, dann immer schneller und unter lauten „Hurra“-Rufen von der Helge ins Wasser.
Beim Eintauchen löste das Schiff eine Bugwelle aus, die gegen die Kaimauer klatschte. Das Schiff glitt weiter raus. Die Ankerketten ratterten runter und gruben sich in den sandigen Weserboden ein. Die Pressefotografen rannten dem Schiff hinterher. Hermann hörte noch, wie jemand „Achtung!“ rief und dann sah er schon die Welle. Ihm stockte der Atem. Die Welle erfasste eines der Schlepperboote, in dem einer der Zimmermänner saß. Es kenterte. Die Menge schrie vor Schreck auf. Doch da tauchte der Mann nach Luft japsend wieder aus dem Wasser auf. Die Haare hingen ihm in der Stirn. Und auch die Fotografen, von denen die vorwitzigsten zu weit vorgelaufen waren, waren pitschnass. Diejenigen, die ihre Kamera um den Hals getragen hatten, hatten noch Glück gehabt. Die anderen hatten ihre Kamera verloren. Als jedoch klar war, dass nichts Schlimmeres passiert war, brachen die Menschen in schallendes Gelächter aus. Und auch Hermann, Jürgen, Henny und Oskar prusteten los.
„Das haben sie nun davon“, sagte Oskar selbstzufrieden. „Ich sach doch, Taufpate muss immer eine Frau sein!“
Hermann war in diesem Augenblick unbändig stolz auf seine Stadt und sein Viertel. Und endlich wusste er, was er wollte. Er wollte mit seinen Händen etwas erschaffen. Etwas bauen, das man sehen, greifen und bewundern könnte. Er wollte Schiffbauer werden.
Zwischen Tabak und Bananen
Mit Ende der Volksschule trennten sich die Wege von Jürgen und Hermann. Jürgen ging auf Wunsch seiner Eltern aufs Gymnasium, Hermann bewarb sich bei der A.G. Weser.
Zum Vorstellungsgespräch zog er einen alten Anzug von Hans an und band die schwarze Krawatte um, die Oskar bei der Beerdigung von Sophie getragen hatte. Obwohl Henny ihm den Anzug angepasst und umgenäht hatte, schlackerte er an Hermanns schmalen Körper.
Das Vorstellungsgespräch fand im Verwaltungsgebäude statt. Oskar bot Hermann an, ihn zu begleiten, doch Hermann wollte es alleine schaffen. Niedergeschlagen kehrte er vom Gespräch zurück. Oskar fegte gerade den Innenhof und sah, wie Hermann durch den Hausflur nach oben huschen wollte.
„Hermann? Bist du schon wieder zurück?“ Dankbar für die kurze Pause, stützte sich Oskar auf dem Besenstiel ab. Seine Knochen fühlten sich an, als ob sie auf Schmirgelpapier sitzen würden.
Hermann stöhnte. Mit mürrischem Gesicht trat er hinaus.
„Wie ist es gelaufen?“ fragte Oskar freundlich.
„Nicht gut!“, sagte Hermann bitter. „Die haben gesagt, dass ich zu mickrig bin für einen Schiffbauer.“
„Tja“, sagte Oskar und blickte seinen Enkel von unten nach oben an. Der Anzug hing trotz Hennys Bemühungen wie ein Kartoffelsack an Hermanns Körper. Er kratzte sein Kinn. „Das stimmt. Als Schiffbauer musst du schwere Sachen tragen können.“
Hermann hob empört den Kopf. „Und sie haben gefragt, ob ich nicht lieber in der Buchhaltung arbeiten möchte, weil ich so gut im Kopf rechnen kann!“
„Ja, aber das ist doch eine gute Sache, das Beste, was dir passieren kann. Du sitzt im warmen Büro, brauchst keine Angst vor Unfällen zu haben, verdienst gutes Geld“, mischte sich Henny ein.
„Ich will aber nicht im Büro sitzen. Ich will Schiffe bauen!“ Hermann lief vor lauter Ärger rot an. Er zerrte an der geliehenen Krawatte, die ihm die Luft abschnürte.
Oskar stellte den Besen beiseite und zeigte auf die Bank. „Komm Junge, wir setzen uns hin.“
„Ich will nach oben!“
„Setz‘ dich hin und hör mir zu. Ich habe eine Idee. Wir fragen den Edgar. Der arbeitet am Hafen. Die brauchen immer neue Leute. Dann hilfst du ein bisschen beim Packen und Stapeln und kriegst ein paar Muckis. Und nächstes Jahr versuchst du es einfach noch einmal bei der A.G. Weser.“
„Warum sollten die mich ausgerechnet am Hafen nehmen? Die brauchen dort doch erst recht kräftige Männer, die anpacken können!“
„Lass mich das mal machen!“ Und an Henny gewandt sagte Oskar: „So Henny, und du kochst unserem Jungen mal was Anständiges zu essen. Und sei nich‘ so knickerich mit dem Fleisch!“
Bereits die Woche darauf konnte Hermann am Hafen anfangen. Henny weckte ihn frühmorgens um 6 Uhr für seine erste Schicht. Hermann aß ein Butterbrot und trank Kaffee mit Milch und Zucker. Um 6.45 Uhr sollte er Edgar vor dem Hafenhaus treffen. Der Weg war nicht weit, Hermann konnte mit Oskars Fahrrad fahren. Er radelte über die Gröpelinger Heerstraße hin zur Hafenrandstraße. An der Straßenbahnhaltestelle stieg ein Tross Arbeiter aus, die ihre Lungen erst einmal kräftig freihusteten. In der Luft roch es nach Tabak, Kaffee und Fischmehl. Hermann rümpfte die Nase. Er kannte den Geruch. Je nach Windrichtung zog er an manchen Tagen bis zu ihnen nach Hause, aber so intensiv wie jetzt hatte er ihn noch nie wahrgenommen. Vielleicht lag das aber auch an der frühen Uhrzeit. Edgar wartete bereits auf ihn. Er stand angelehnt an dem roten Backsteingebäude und zeigte auf den Zaun vor dem Hafenhaus.
„Hermann, moin! Du kannst dein Rad da vorne abstellen.“
„Moin!“ sagte Hermann und weil er sich besonders gut präsentieren wollte, schüttelte er dem Älteren die Hand.
„Ja, ja, lass man gut sein. Du kommst heute in meine Kolonne, ab morgen musst du selber zusehen, wo du eingeteilt wirst. Treffpunkt ist um 6.30 Uhr hier am Hafenhaus. So, und nun komm mal mit! Wir machen heute Apfelsinen. Da ist gerade eine größere Ladung aus Spanien angekommen!“
Hermann eilte Edgar hinterher und schaute sich um. Unzählige Schiffe aus Übersee hatten im Hafen festgemacht. Sie hatten vor allem Tabak, Baumwolle, Kaffee und Früchte geladen. Daneben tummelten sich Schlepper, Schuten und kleine Festmacherboote. Vor einem spanischen Schiff blieb Edgar stehen. Er wies Hermann seinen Platz zu und dann ging es los. Große schwielige Hände reichten ihm eine Holzkiste an, danach folgte die nächste und wieder die nächste, bis Hermann aufhörte zu zählen.
Nach einer halben Stunde schmerzten Hermanns Hände von dem rauen Holz, seine Schultern brannten von der Last der Kisten und er musste pinkeln. Doch Hermann biss sich auf die Zähne und packte weiter mit an. Seine Hände klebten vom Saft der Apfelsinen, die matschig geworden waren und deren Saft durch die Ritzen der Holzkisten drang.
Während die Männer die Ladung löschten, erzählten sie sich Geschichten. Walter, ein hagerer trockener Kerl, berichtete wie er im Golden City mit einem malaysischen Seemann aneinandergeraten war. Der Malaysier hatte Anspruch auf die Frau erhoben, mit der Walter gerade flirtete. Ein Wort gab das andere bis Walter seinem Kontrahenten einen Kinnhaken verpasste.
„Und dann kam der Wirt, packte diesen kleinen Malaysier einfach am Nacken wie so ein Kaninchen und schmiss ihn raus auf die Straße. Durch die Pendeltüren durch, wie in einem Western. Das hättet ihr sehen sollen, wie der geguckt hat! Der macht sich an keine fremde Frau mehr ran! Und geschimpft hat der, wie ein Rohrspatz!“ grinste Walter.
Die anderen lachten. Der Wirt im Golden City war bekannt dafür, dass er hart durchgriff, wenn es Ärger gab und immer packte er die Seeleute heftiger an als die Hafenarbeiter. Als Hermann Edgar fragte, warum das so sei, zuckte der nur mit den Schultern und sagte: „Der Hafenarbeiter kommt im Zweifel wieder, die Seeleute nicht, so ist das nunmal.“
Um 9 Uhr war die erste Pause. Edgar nahm Hermann mit in die Anbiethalle. Hier gab es schon frühmorgens warmes Essen. Edgar und die anderen aus der Kolonne bestellten sich ein krosses Brötchen mit Bockwürstchen. Hermann hatte nichts dabei. Als Edgar das sah, kaufte er ihm auch ein Wurstbrötchen und drückte es ihm in die Hand.
„Hier Junge, hast ordentlich gearbeitet!“
Glücklich biss Hermann in das knusprige, helle Brötchen mit der warmen würzigen Wurst. Danach ging es weiter. Sobald eine Palette voll war, brachten die Männer sie mit Handkarren in die Schuppen, wo die Küper der Kaufleute bereits ungeduldig darauf warteten, die Ware zu begutachten. Größere Lasten luden sie in kleine Eisenbahnwaggons. Mittags um 12 Uhr gab es eine zweite Pause und um 15.30 Uhr war Feierabend.
Jeden Morgen fand sich Hermann um 6.30 Uhr vor dem Hafenhaus ein und wartete auf seine Zuteilung. Er schichtete Tabakballen um Tabakballen und Kaffeesack um Kaffeesack auf die Paletten. Mehr als einmal beobachtete er, wie einige Arbeiter Zigaretten und Kaffeebohnen aus den Ladungen abzwackten und in ihren Taschen verschwinden ließen.
„Kaffee für zuhause und Zigarette für die Pause“, zwinkerte Günni und bot Hermann Kautabak an. „So hast du imma eine Hand frei!“, sagte er und schob sich den Priem in die Wangentasche.
Hermann winkte ab. Er mochte keinen Kautabak, wobei er sich mittlerweile an den Geruch gewöhnt hatte. Am schlimmsten war allerdings das Obst. Entweder war es matschig und gärte vor sich hin oder es krabbelte einem ein exotisches Tier entgegen, das versehentlich in einer der Kisten mitgereist war. Selbst gestandene Männer sprangen aufgeschreckt zur Seite, wenn eine dicke schwarze Spinne in Lauerposition in einer Bananenstaude hockte. Eine Bananenstaude wog bis zu 40 Kilogramm. Hermann trug sie ohne zu Murren.
„Nicht, dass du noch einen Plünnenbuckel kriegst!“, sorgte sich Henny. Viele der Hafenarbeiter bekamen mit den Jahren einen krummen Rücken, doch Hermann wusste nicht, wie er es sonst schaffen sollte, die Bananen auf die Waage des Küpers hochzuhieven. Ächzend holte er Schwung und schleuderte die Früchte auf die Waagschale.
„Pass doch auf! Wenn da Druckstellen drankommen, können wir die nicht mehr verkaufen!“, herrschte ihn der Küper an. Der Küper, gerade mal ein paar Jahre älter als Hermann, sah den Jungen aus bös‘ funkelnden Augen an. Die Küper waren die rechte Hand der Kaufleute, sie zählten und wogen die Ware und nahmen Proben, waren sich selbst aber zu fein, die Stauden, Säcke, Kisten und Ballen anzuheben.
„Heb das nochmal hoch, damit ich mir das ansehen kann“, sagte er barsch.
Hermann wollte ihm am liebsten etwas Unflätiges entgegnen, war aber zu müde und hielt vorsichtshalber den Mund. Er drehte die Bananenstaude um.
Der junge Mann inspizierte sie eingehend und befühlte die Schalen der obenliegenden Bananen.
„Ist in Ordnung“ grummelte er und schickte Hermann los, die nächsten Bananenstauden zu holen.
Trotz des rauen Tons war Hermann fasziniert von der Welt des Hafens. Die körperliche Arbeit machte ihm von Tag zu Tag weniger aus. Abends fiel er erschöpft, aber zufrieden ins Bett. Dann dachte er an die Geschichten, die die Männer sich in den Pausen und während der Arbeit von der Küstenstraße erzählten. Einige raunten die Namen der Etablissements nur und die anderen nickten wissend. Der Gedanke, dass es dort Frauen gab, die für Geld mit fremden Männern schliefen, ließ ihm keine Ruhe. Eines Nachts beschloss er, sich das Ganze einmal selber anzusehen. Am nächsten Morgen begab er sich früher als sonst auf den Weg zur Arbeit. Doch anstatt geradeaus durchzufahren, bog er links in die Nordstraße ab und radelte ein Stück hoch. Er war aufgeregt. Sein Herz klopfte und ausgerechnet jetzt musste er auf die Toilette. Er fuhr langsamer. Eine Bar nach der anderen reihte sich an der Küstenstraße und dann sah er sie. Müde sahen sie aus und zerzaust. Sie saßen auf Stühlen vor den Bars und hielten Zigaretten und Kaffeetassen in der Hand. Einige von ihnen trugen nur einen Morgenrock. Eine dickleibige Brünette mit rot geäderten Wangen blickte den Jungen auf dem Fahrrad aus ihren dicken geschwollenen Augen amüsiert an.
„Nä, wat süß! Büschen früh, wa? Oder hast du noch einen Ständer von heute Morgen?“
Laut und scheckig lachte sie auf. Die anderen Frauen stimmten mit ein. Hermann erschrak. Er spürte, wie ihm das Blut in den Ohren rauschte und die Röte ins Gesicht stieg. Er kehrte auf der Stelle um und fuhr schnell weg, ohne sich noch einmal umzudrehen. Hermann wusste nicht mehr, wo er war, doch er meinte, das Lachen noch immer zu hören. Endlich fand er einen Tunnel, der ihm den Weg zum Hafen wies. In dem Tunnel stank es nach Urin und Erbrochenem. Hermann fuhr mit angehaltener Luft durch.
Sein Herz pochte noch immer, als er bei der Arbeit ankam. Er genierte sich, dass er die Nerven verloren und sich von dem Spruch der Prostituierten so sehr hatte aus der Fassung bringen lassen. Schließlich war er kein kleiner Junge mehr. In der Pause kaufte er sich eine Schachtel Zigaretten. Die erste Packung seines Lebens. Er musste husten als er den ersten Zug nahm und ihm wurde schwindelig vor Augen. Trotzdem rauchte er die Zigarette zu Ende.
An einem der letzten Spätsommertage lud Hermann seine Großeltern zum Essen an die Lesum in Haesloops Sommergarten ein. In dem rustikalen, gehobenen Lokal fühlte Henny sich fehl am Platz.
„Das ist doch nur was für feine Leute“, gab sie zu Bedenken und wollte wieder umdrehen, als Hermann auf den mit einem weißen Tischtuch gedeckten runden Holztisch zusteuerte. Von dort aus hatte man einen wunderbaren Blick auf die Lesum und die kleine Schilfbucht.
„Für feine Leute und für uns“, entgegnete Hermann gut gelaunt. Er fasste seine Großmutter sachte am Ellenbogen und dirigierte sie durch die Tischreihen durch. Verlegen lächelnd und mit roten Bäckchen nickte Henny nach links und nach rechts. „Grüßt man hier die anderen?‘ fragte sie sich und ließ sich von Hermann den Stuhl zurechtrücken. Zu aufgeregt, um sich selber etwas auszusuchen, überließ sie Hermann die Bestellung. Er wählte für sie roh gebratene Bratkartoffeln mit Spiegelei, Speck und Essiggurken aus.
„Aber das können wir doch auch zuhause haben, das ist hier doch viel zu teuer“, wand Henny entrüstet ein, als der Kellner außer Hörweite war.
„Stimmt, aber hier bekommen wir es an den Tisch serviert“, sagte Hermann.
Henny zupfte an ihrer Bluse. Sie hatte den Kittel gegen eine weiße Bluse und Rock eingetauscht, trotzdem fühlte sie sich unwohl in ihrer Haut. Kritisch schaute sie ihren Mann an und runzelte die Stirn. Sie spuckte in ihre Fingerspitzen und plättete die Haare, die seitlich an Oskars Kopf abstanden. „So!“ „Menschenskinder, immer musst du an mir rumfummeln“, schimpfte Oskar und wehrte ihre Hand ab.
Erst nach dem zweiten Bier entspannte sich Henny. Sie rückte ihren Holzstuhl zurecht, so dass sie sich besser drehen und die anderen Gäste beobachten konnte. Das Publikum war gemischt und gar nicht so etepetete wie sie befürchtet hatte. An den Holztischen unter den Eichen und Linden saßen verliebte Pärchen, die Händchen hielten, und Familien deren Kinder nach dem Mittag noch einen Eisbecher essen durften. Aufmerksam registrierte Henny, dass dies die scheinbar Glücklichen waren, deren Männer und Väter heimgekehrt waren. Auf einmal streifte ihr Auge etwas und sie kicherte los wie ein kleines Mädchen. Die kleinen blassblauen Augen in dem spitzen Gesicht füllten sich mit Tränen vor unterdrückten Lachen. Sie biss in ihre Hand, um sich zu beherrschen und es war nicht ganz klar, ob Henny lachte oder weinte.
„Henny, was ist mit dir? Sag mal: Bist du etwa angetütert?“ fragte Oskar streng. Also manchmal war ihm seine Frau doch etwas peinlich. Wenn er zuviel trank, war es das eine, aber wenn seine Frau zuviel trank, war es das andere.
„Guck mal. Da drüben…. der Mann mit dem hellen Hut. Der gerade vom Klo wiedergekommen ist“, stieß Henny japsend hervor.
„Ja, und?“ fragte Oskar ungeduldig. Er reckte seinen langen Hals und schaute in die angezeigte Richtung, konnte aber nichts erkennen.
Auch Hermann versuchte zu erkennen, was seine Großmutter zum Lachen brachte.
„Da am Fuß. Da hängt noch das Toilettenpapier“, gluckste Henny.
„Wo?“
„Na da!“ rief sie und prustete los.
Oskar musste mitlachen und auch Hermann konnte es sich nicht verkneifen. Er betrachtete die beiden ihm so vertrauten Menschen wie sie zankten und lachten. Die Welt hatte sich verkehrt. Da saßen Henny und Oskar, die ihn umsorgt und großgezogen hatten, und hier war er, Hermann, der nun fast erwachsen war und seine Großeltern ausführte. Zum ersten Mal wirkten sie klein und schutzbedürftig auf ihn und Hermann spürte eine ungeahnte Zärtlichkeit in sich aufsteigen.