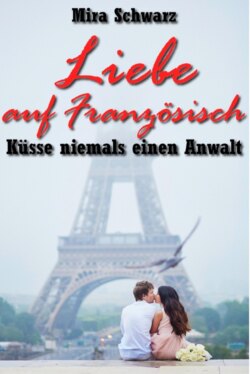Читать книгу Liebe auf Französisch - Küsse niemals einen Anwalt - Mira Schwarz - Страница 5
Kapitel 2 – Schatten der Vergangenheit
ОглавлениеPaul trat aus dem kleinen Blumenladen und schloss die Tür hinter sich.
Wie beiläufig hörte er eine kleine Glocke bimmeln. Ruhig wandte sich nach links zur nächsten Eingangstür, die etwas versteckt hinter einer großen Kletterpflanze lag. Er tippte die Nummer in das elektronische Schloss, drückte die Tür auf und überquerte den Hof, der hinter der unscheinbaren Tür lag.
Am gegenüberliegenden Ende des Hofes schloss er eine weiße Tür mit einem Schlüssel auf und betrat das helle, freundliche Treppenhaus. Die Holzstufen knarrten, als er die Treppe emporstieg. Im zweiten Stock musste erneut eine Tür aufschließen. Er stand mit dem kleinen Mäusejäger im Flur seiner Wohnung. »Da kann man sich schon fragen, wie du es immer wieder hier hinaus schaffst«, knurrte er den Kater gutmütig an. »Drei Türen!«
Der kleine Kater sprang mit einem Satz von seinem Arm und lief in die Küche. Er hatte Hunger. Paul ging ihm hinterher, holte aus einem der Schränke einen Karton mit Katzenfutter und füllte den Napf. Der Stubentiger fraß mit einem tiefen Gurren. Danach sprang er auf das dicke gemütliche Kissen, das Paul ihm in die Fensterbank gelegt hatte, leckte seinen Pfoten und rollte sich zusammen, so dass er mit dem Rücken zur Küche lag und das Treiben auf der Rue Cailloux gut beobachten konnte.
Paul streichelte ihm noch einmal über den Kopf und ging dann zurück in den Flur. Er schloss die Tür sorgfältig hinter sich und ging denselben Weg, Treppenhaus, Hof, Eingangspforte, kopfschüttelnd wieder zurück. Wie kam der Kater aus diesem Hof, verdammt?
Er hatte keine Ahnung. Gut, oben im Treppenhaus war er durch die Tür entwischt. Da hatte er ihn noch gesehen. Aber dann?
Auf der Rue Cailloux wandte er sich nach links und ging auf dem Gehweg entlang in Richtung Metro. Als er seine Monatsfahrkarte aus der Tasche ziehen wollte, bemerkte er, dass er die weiße Rose noch immer in der Hand hielt. Er hatte sie ganz vergessen. Erstaunlich, dass er sie gekauft hatte. Er zog sein Mobiltelefon aus der Tasche, drückte eine Tastenkombination und hielt sich das Gerät an sein Ohr. »Ah, ja, Claudine, hier ist Paul. Ich komme heute später... ja, das macht nichts, diesen Termin kannst du ein bisschen nach hinten schieben... ...nein, das wird Henry nichts ausmachen, ruf ihn doch einfach an. Ja. Bis später.«
Er steckte das Telefon zurück in die Innentasche seines Mantels und verließ die Vorhalle der Metrostation wieder. Nach einigen Minuten Fußmarsch auf der Rue Cailloux erreichte er das schmiedeeiserne Tor. Er drückte es auf und ließ das Alltagstreiben der Pariser Straßen hinter sich.
Paul hörte zwar noch den Lärm der Autos, die Worte der Menschen, die hinter der hohen Granitsteinmauer entlang gingen und sich unterhielten. Aber diese Geräusche waren auf einmal sehr weit weg. Die wunderbare Stille, die von diesem Ort ausging, umfing ihn, ließ ihn alles andere vergessen.
Er ging einen Kiesweg entlang. Ohne Probleme fand er sich zwischen den hunderten von Steinen, die rechts und links der Wege dicht an dicht standen, zurecht, obwohl er Ewigkeiten nicht mehr hier gewesen war. Er schlenderte durch die Gänge und fand den einen Stein, den er suchte.
Er sah auf die Inschrift - Manuela Santini, geboren am 3. Mai 1981 - gestorben am 8. August 2012 - und besah sich die Gedenktafeln, welche die Trauergäste damals aufgestellt hatten.
Mit leicht zittrigen Fingern legte er die Rose auf die Platte aus Marmor und trat wieder einen Schritt zurück. Dann besann er sich und schaute sich um. Gab es hier keine Vasen für echte Blumen? Die Gräber links und rechts waren mit künstlichen Blumen, manchmal aus Plastik, meist aus Porzellan, geschmückt.
Ewige Lichter brannten, nicht selten gab es Bilder der Verstorbenen, die in wetterfesten Rahmen auf den die Gräber deckenden Marmorplatten standen. Doch Vasen sah er keine. Er ging den Weg noch einmal zurück und schaute sich um. Aber überall dasselbe Bild. Es gab auf diesem Friedhof keine frischen Blumen und demnach auch keine Vasen.
Verwundert stellte er fest, dass es ihm noch nie so aufgefallen war. Aber selbst wenn: Er hätte ja wohl auch kaum eine Vase von einem anderen Grab nehmen können, um seine Rose dann darin auf ihrem Grab zu posieren. Also ging er wieder zurück und stellte sich vor das schlichte Grab, auf dem die weiße Rose lag. »Hallo Manu, lange her...« Er räusperte sich und kam sich wie immer ein bisschen dumm vor. Er sprach laut mit einer Steinplatte. Erneut. Überhaupt, was sollte er denn jetzt sagen?
»Hm. Ich habe dir eine Rose mitgebracht. Ich hab sie heute Morgen in Victoires Laden gekauft.« Er hielt inne. Das musste er erklären. Sie war ja nicht auf dem neusten Stand. »Victoire ist zurückgegangen. Er meinte, er hätte jetzt genug gearbeitet und wolle endlich mal wieder Sonne und Wärme genießen. Und ich kann ihn gut verstehen. Der Winter war dieses Jahr lang und kalt.« Paul atmete tief und blickte sich um, ob ihn jemand beobachtete.
»Nun ja, auf jeden Fall hat eine junge Frau den Laden von Victoire übernommen und ein Blumengeschäft darin eröffnet. Es sieht ganz anders aus als vorher, freundlich und hell, nicht so düster.« Und gammelig, fügte er in Gedanken hinzu. Schnell sagte er, als meinte, er könne sie beleidigt haben: »Victoire hat auch schon lange nichts mehr gemacht. Er wusste wohl schon, dass er bald abreisen wollte. Mir hat er natürlich erst ein paar Tage vorher gesagt, dass er Paris verlässt. Typisch.« Erneut eine Pause. Er räuspert sich.
»Der Kater war drin. Im Laden meine ich... heute Morgen. Also bin ich auch hinein gegangen, um deinen Tiger wieder nach Hause zu holen. Er scheint sich da ganz wohl zu fühlen.« Seine Stimme wurde leiser. »Und ich auch. Anders kann ich mir nicht erklären, warum ich dort eine Blume gekauft habe. Du weißt, für so etwas war ich nie der Typ.« Er war lange nicht mehr hier gewesen. Anfangs nicht, weil er nach ihrem Tod mit sich selbst nichts mehr anzufangen wusste und vor lauter Trauer auch nicht dazu fähig gewesen wäre. Später nicht, weil er es überflüssig fand, eine Steinplatte zu besuchen. Und Blumen hatte er hier auch noch nie hingestellt. Sie würde sowieso immer in seinem Herzen sein.
»Die junge Frau ist sehr nett zum Kater, keine Sorge.« Er stockte und trat von einem Fuß auf den anderen. Es tat ganz gut, hier zu sein, überlegte er. »Ich habe keine Vase für die Rose gefunden, Manu. Ich fürchte, ich muss morgen nochmal mit einer Vase vorbeikommen.« Und mit einer neuen Blume, die er bei Janine kaufen würde. Diese hier würde morgen nämlich verwelkt sein oder vom ständigen Ostwind fortgetragen.
»Bis morgen dann, Manu.« Er knöpfte seinen Mantel ordentlich zu und ging die Reihen durch die Gräber zurück zum schmiedeeisernen Tor. Aus der Stille trat er auf die lebendige Rue Cailloux und machte sich auf den Weg ins Büro zu seinem Termin. Als die Leute um ihn herum gingen, blieb er noch eine kurze Sekunde stehen und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Paul zog die Nase hoch und atmete durch.
Der letzte Besuch war viel zu lange her. Viel zu lange …
***
Während er die Rue Cailloux entlang ging, zurück zur Metro-Station, dachte er an Henry, seinen besten Freund. Bei dem Gedanken musste er lächeln. Henry, knapp 60 Jahre alt, und immer noch ein kleines Kind. Er war laut und hatte den Charme eines Vorschlaghammers. Gestern am Telefon hatte er ziemlich aufgeregt geklungen. Er war sicher wieder in irgendwelche Schwierigkeiten geraten. Henry hatte einen Riecher für gute Geschäfte, geriet aber immer mal wieder an windige Geschäftspartner. Wie oft hatte er ihm in den letzten Jahren aus der Patsche geholfen?
Vor etwa vier Jahren, Paul hatte gerade die Kanzlei seines Vaters übernommen, war Henry in sein Büro gestürmt und hatte verlangt, Pauls Vater zu sprechen. »Dann müssten Sie sich in den Zug setzen und in die Provence fahren. Da wohnt mein Vater jetzt.« Henry ließ sich ohne eine Aufforderung abzuwarten in einen der Besuchersessel fallen lassen und hatte laut aufgestöhnt.
Obwohl Paul den dicken, schwitzenden Mann, der wie ein Schluck Wasser in seinem neuen Lederfauteuil hing, irgendwie mochte, war er doch ärgerlich gewesen. Erst stand er ohne Termin vor seinem Schreibtisch, dann begrüßte er ihn noch nicht einmal und wollte zu guter Letzt seinen Vater sprechen, der alle seine Klienten in einem freundlichen Schreiben davon in Kenntnis gesetzt hatte, dass sein Sohn die Kanzlei übernehmen würde, da er jetzt in die wohlverdiente Rente ging.
Er bot Henry ein Glas Wasser an, das dieser kopfschüttelnd ablehnte. »Ein Cognac wäre besser.« Er nickte in Richtung der großen Globuskugel, die vor dem bodentiefen Fenster stand. Es war zehn Uhr dreißig morgens. Paul öffnete die Nordhalbkugel und holte eine Cognacflasche und ein Glas aus dem Globus, das er einige Sekunden später gefüllt vor Henry auf dem Glastisch absetzte.
Der Mann kannte das Büro offensichtlich, denn er wusste, wo der Cognac versteckt war. Wieso wusste er dann nicht, dass er die Kanzlei übernommen hatte? Er setzte sich ihm gegenüber, schlug die Beine übereinander und wartete, was ihm der Mann erzählen würde. Dieser leerte das Glas in einem Zug. »Sie sind dann also Paul junior?«
»Richtig. Und Sie sind...?«
»Henry Descartes – wie der Philosoph. Nur offensichtlich nicht so schlau.« Henry hatte ein Haus auf dem Montmartre gekauft, was an sich eine gute Investition war, denn die Immobilienpreise im ehemaligen Pariser Rotlichtviertel stiegen rasant.
Offensichtlich war er dabei an einen windigen Geschäftsmann aus dem Gewerbe geraten und seine Investitionsentscheidung drohte in ein finanzielles Desaster abzurutschen, da der Eigentümer von notwendigen Formalitäten nicht viel hielt und Henry ohne notarielle Bestätigung der Verträge bereits einen Haufen Geld als Anzahlung abgenommen hatte.
Der Verkäufer weigerte sich die notwendigen Gutachten ausführen zu lassen, die Henry dann auf eigene Faust durchführen ließ. Der Gebäudekomplex wies einige eklatante Mängel auf, die sich preismindernd ausgewirkt hätten, hätte Henry auf die übliche Prozedur bestanden und den Vorvertrag notariell abgeschlossen, bevor er eine Anzahlung an den Verkäufer übergab. Hatte er aber nicht.
Nun saß er jammernd vor Paul. »Dach- und Kellerrenovierung kosten mich einige Hunderttausend zusätzlich. Wie komme ich bloß aus dieser Nummer heraus?« Er rieb sich mit den Händen die Augen und Paul sah, dass er einen dicken Goldring mit einem roten Stein am kleinen Finger trug. Sicher ein Rubin. Schlecht konnte es dem Mann nicht gehen. »Ihr Vater hätte sicher eine Idee, wie ich jetzt vorgehen sollte.«
»Ich bin meines Vaters Sohn und ich hab auch eine Idee«, sagte Paul kühl. Henry musterte ihn erstaunt und fing dann an zu lachen.
»Ja, tatsächlich. Sie sind der Sohn Ihres Vaters, so hätte der Senior sicher auch reagiert.« Henry entspannte sich und lehnte sich im Sessel zurück. »Sie wissen nicht, wer ich bin, oder?«
»Henry Descartes, sagten Sie.«
»Der Senior und ich haben eng zusammen gearbeitet, als das Landgericht umziehen sollte und ihr Vater im Etablissement Public den Vorsitz hatte.« Paul erinnerte sich dunkel an ein lang vergangenes Debakel: Der Justizpalast war zu klein geworden, das Landgericht sollte auf die Rive Gauche umsiedeln.
Pauls Vater hatte das Projekt geleitet. Er hatte gehofft, dass das Ministerium und die Gerichtstätten weiterhin im Zentrum von Paris zusammen bleiben würden. Aber der Pariser Oberbürgermeister legte ein Veto ein und die Behörden und Verantwortlichen begannen, das Projekt auseinander zu nehmen. Paul senior hatte frustriert den Vorsitz abgegeben. Erst Jahre später war dann endlich ein Entschluss getroffen worden und das Gericht zog nun in den Nordwesten von Paris.
»Ich habe 2005, nach dem Veto, beschlossen, ein paar Jahre ins Übersee-Departement zu wechseln und bin erst vor einigen Monaten aus La Reunion zurückgekommen.« Das erklärte, warum er nichts davon wusste, dass Paul junior die Erbfolge angetreten hatte. »Wenn Sie mir noch einen Cognac anbieten, dann sehe ich allerdings keinen Hinderungsgrund, warum ich nicht auch mit Ihnen vertrauensvoll zusammen arbeiten sollte.«
Das konnte ja heiter werden. Paul war zum Globus gegangen, um Henrys Glas ein zweites Mal zu füllen. Die Verträge, die Henry bereits abgeschlossen hatte, waren alle sauber gewesen und es hatte viel Zeit in Anspruch genommen, ein juristisches Schlupfloch zu finden und Henry aus den Klauen der Immobilienmafia des Montmartre zu befreien. Doch Paul hatte ihm tatsächlich einen Ausweg aufzeigen können und Henry hatte mehrere hunderttausend Euro nicht verloren.
Zum Dank oder vielleicht auch aus alter Freundschaft zu Paul senior hatte Henry den jungen Anwalt zu einem Abendessen nach Hause eingeladen. Marlene, Henrys Frau, hatte zwar eine ähnliche Figur wie ihr Mann, unterschied sich aber ansonsten himmelweit.
Wo Henry laut war, war sie ruhig. Wo Henry schnell war, war sie bedacht. Es hätte kaum ein unterschiedlicheres Paar geben können. Henry war der Draufgänger, Marlene der eher mütterliche Typus. Und sie hatte Paul im Moment seines Ankommens quasi adoptiert. Er hatte den Mantel noch nicht abgelegt, da drückte sie ihn schon an ihren runden Körper, teils aus Dankbarkeit, weil er ihren Mann vor einer Dummheit bewahrt hatte, teils, weil ihr Naturell es ihr gar nicht anders erlaubte. Und Paul, der das ungleiche Paar zunächst mit Distanz beobachtet hatte, konnte nicht anders und hatte die herzliche Umarmung Marlenes erwidert.
Damit war er offiziell zum Teil der Familie geworden und war mindestens einmal im Monat zum sonntäglichen Mittagessen eingeladen worden. Da Paul nach Manus Tod sowieso nichts mit seinen Sonntagen anfangen konnte, hatte er sein Befremden vor der stürmischen Familienaufnahme überwunden und war mit jeder Einladung lieber in das schöne Anwesen im 16. Arrondissement gekommen.
Er hätte ja auch gar nicht anders gekonnt: Wenn er einmal die Einladung absagen musste, weil er andere Verpflichtungen hatte, dann stand Marlene ein paar Tage später in seinem Büro und sah ihn an, als wenn er ihr gesagt hätte, der Coq au Vin wäre ihr nicht gelungen. So war aus der geschäftlichen Beziehung eine Freundschaft und Henry war für Paul eine Art Ersatz für den Vater geworden, den er nur noch selten traf.
»Na, mal sehen, was jetzt wieder anliegt«, dachte Paul und beschleunigte seinen Schritt. Er passierte die Metroschranke und erwischte gerade noch eine Bahn in Richtung La Defense. In diesem modernen Hochhausviertel hatte sein Vater in den frühen Siebzigern ein Grundstück erworben und seine Kanzlei aufgemacht, allen Unkenrufen zum Trotz, die dem Geschäftsviertel keine Zukunft gaben.
Während der Ölkrise war das Projekt La Defense durch den damaligen Premier Valéry Giscard d’Estaing fast gekippt worden. Aber Pauls Vater hatte Recht behalten, das Viertel hatte sich bestens entwickelt. Über 2500 Firmen hatten sich mittlerweile angesiedelt, die gerne auf die Beratungen der alteingesessenen Anwälte zurückgriffen. Die Kanzlei hatte viel Geld in den vergangenen Jahren verdient.
Paul würde für den Rest seines Lebens finanziell abgesichert sein. Aber was nützte all das Geld, wenn er niemanden hatte, mit dem er es teilen konnte. Glück war manchmal eine viel zu flüchtige Bekanntschaft, dachte er und atmete aus.
Er verließ die Metro und eilte zwischen den modernen Gebäudekomplexen entlang zu seiner Firma. Der Wind wehte eisig die breiten Prachtstraßen entlang und rieb sich die Hände warm. La Defense unterschied sich architektonisch gewaltig von den Straßen im Zentrum von Paris. Alles war groß und kühl, nicht nur wegen des Windes. La Defense war unpersönlich und hatte keinen Charme.
Die Menschen hasteten durch die Straßen, blickten auf ihre Telefone oder stur geradeaus, die Menschen waren in schwarze Businessanzüge oder –kostüme gekleidet, alle sahen genau gleich aus. Paul sah an sich hinunter: »Wie ich«, stellte er fest.
Er schlug den Mantelkragen hoch und betrachtete eine Dame, die in viel zu hohen Schuhen über die Straße eilte. Kein Baum säumte die Gehwege, die Grünanlagen waren mit weißem und grauen Schotter gefüllt, vereinzelt gepflanzte Gräser schauten aus den unnatürlichen Beeten. Er dachte an die Kletterpflanze vor dem Eingang seines Hauses.
Er würde morgen Janine fragen, was das für eine Pflanze ist. Sie würde es bestimmt wissen. Die Pflanze hatte gefächerte Blätter und trug im Frühjahr hellviolette Blüten. Sie rankte am Fallrohr bis an die Dachkante empor. Ohne zu wissen, warum, lächelte er bei diesem Gedanken vor sich hin und dachte an die hübsche junge Frau, die ganz offensichtlich zu diesem künstlichen Ort, an dem er jetzt stand, überhaupt nicht gepasst hätte.
Das goldblonde Haar war zu einem wilden Knoten im Nacken geschlungen gewesen, Strähnen hatten sich gelöst und umrahmten das feine Gesicht mit den durchdringenden, fast grünen Augen. Er hatte ihre Hände betrachtet, die ihm die Rose reichten: Sie waren ein rot gefroren, von Erde beschmutzt und von Dornen zerkratzt gewesen, was sie kein bisschen zu stören schien. Und ganz sicher war er, dass sie keine hohen Schuhe getragen hatte.
Nein, an diesen unnatürlichen Ort würde jemand wie Janine nicht passen. Janine strahlte Natürlichkeit, Lebendigkeit aus, dieser Ort war reines Business und Zweckmäßigkeit.
Im Büro angekommen hängte er seinen Mantel an die Garderobe, begrüßte Claudine und ging in die Küche, um sich einen heißen Kaffee zu holen. Claudine folgte ihm.
»Das kann ich doch machen«, sagte sie und nahm ihm das Kaffeepulver aus der Hand.
»Also ehrlich, Claudine, du bist meine Schwägerin und Büroleiterin, nicht meine Sekretärin. Ich mach das selbst, gib her.« Sie gab ihm den Kaffee zurück, sah ihn aufmerksam an, als wenn sie irgendwas in seinem Gesicht lesen wollte, aber er hatte schon sein berufliches Pokerface aufgesetzt. Keine Regung war in seinen Zügen zu erkennen. Zweckmäßig.
»Henry ist schon wieder gegangen«, sagte sie zu Paul. »Ich hatte versucht, ihn telefonisch zu erreichen, bevor er losfuhr, aber Marlene sagte, er sei heute Morgen schon um fünf aufgestanden und losgefahren.«
Er sah sie erstaunt an. »Um fünf? Das hört sich nicht nach Henry an.«
»Hab ich auch gedacht. Aber Marlene wusste nicht, woran er im Moment arbeitet. Ich hab sie gefragt.« Claudine fuhr sich etwas genervt über das Gesicht.
Irgendetwas war mit ihr, dachte Paul und runzelte seine Stirn. »Dachte ich mir.«
»Uh, du bist ja gesprächig heute.«
Paul sah sie weiterhin verwundert an. »Ich bin so wie immer«, antworte er.
»Aber irgendwas ist heute anders. Ich glaube nicht, dass ich schon mal einen Termin verschieben musste, weil du den Kalender spontan geändert hast. Das ist in den fünf Jahren, die ich für dich arbeite, noch nicht vorgekommen.« Claudine trat näher. »Also, was war heute Morgen?«
Er drehte sich weg und füllte die Kaffeemaschine mit den Kaffeebohnen und Wasser. Ihm kam ganz und gar nicht in den Sinn, seiner Schwägerin zu erzählen, was er heute Morgen gemacht hatte. Das ging sie nichts an.
»Er hat nicht gesagt, was er von dir wollte« sprach sie weiter, als sie merkte, dass Paul nicht antworten würde.
»Ich ruf ihn später an«, sagte er und drehte sich zu ihr um, als sie die Küche verließ. Er betrachtete ihre Gestalt. Claudine war eine schöne Frau. Klein und zierlich. Und wie Manu hatte sie langes, schwarzes Haar. Doch ihr fehlte jegliche Ungezwungenheit und Leichtigkeit. Die Haare waren streng zurück gekämmt und in einem engen Knoten gebändigt. Das enge, dunkelblaue Kostüm saß perfekt und betonte ihre schlanke Figur. In der linken Hand hielt sie ihre Brille, eine elegante Schwarze, deren Bügel ein goldenes Chanelzeichen zierte.
Wie sie allerdings die zugigen Straßen von La Defense auf ihren Stöckelschuhen bei Wind und Wetter meisterte, war ihm schleierhaft. Er hatte sie noch nie ohne die hohen Schuhe gesehen. Er nahm an, dass sie ihm ohne Schuhe allerhöchstens bis zur Brust reichen würde.
»Da habe ich wohl etwas verpasst?« fragte sie schnippisch. Sie drehte sich um und erwischte ihn bei seiner Musterung.
Erst jetzt fiel ihm auf, dass er unendlich dämlich aussehen musste, wie er sie ansah und dabei kein Wort sagte. Wieso um alles in der Welt war er so in seine Gedanken vertieft? Das passiert ihm doch sonst nicht. »Nein, Claudine. Alles ist gut.« Langsam drängte er sich an ihr vorbei. Mit Schuhen war ihr Scheitel etwa auf Höhe seines Kinns. 10 Zentimeter größer in 10 Sekunden, dachte er und grinste unwillkürlich. Er ließ sie stehen und ging in sein Büro.
Claudine konnte manchmal wirklich anstrengend sein und ihr schnippischer Kommentar hatte Paul darauf hingewiesen, dass dies einer der anstrengen Momente war. Vermutlich war seine Büroleiterin verärgert, weil sie nicht wusste, wo er den Vormittag verbracht hatte. Sie übernahm gern die Kontrolle und wollte immer alles ganz genau wissen. Claudine machte ihren Job sehr gut.
Er hatte sich zunächst gesträubt, jemanden aus der nahen Verwandtschaft von Manu in die so wichtige Position einzustellen. Aber Manu hatte ihn mit nach allen Regeln der Kunst bearbeitet, mehrere Wochen lang, und am Ende hatte er ihr wie immer nicht widerstehen können.
»Nun gut, Manu, ich probiere es mit deiner Schwester«, hatte er ihr versprochen. »Aber wenn es nicht passt, muss sie sich etwas anderes suchen.« Die ersten Tage liefen nicht gut, aber nach und nach erkannte er ihre Qualitäten als Büroleiterin. Sie war der Drache vor seiner Tür. An ihr kam keiner vorbei, wenn sie es nicht wollte. Und nachdem Manu gestorben war, war ihm das genau recht, auch wenn er wusste, dass manch einer seiner Klienten sich ein wärmeres Willkommen in seiner Kanzlei wünschte.
Claudine war streng, lächelte wenig und verschanzte sich hinter einer höflichen Korrektheit, die manchmal nur haarscharf neben Unhöflichkeit und kalter Distanz lag. Es mangelte ihr gegenüber anderen an Einfühlungsvermögen. Paul glaubte, dass es sich um Selbstschutz handelte, denn ihm gegenüber hatte sie sich seit Manus Tod einigermaßen mitfühlend und zum Teil wirklich besorgt gezeigt. Sie konnte also auch ganz anders, wenn sie wollte. Das einzig schwierige war nur, dass er in ihr einen kleinen Teil von Manuela sah.
Und das Tag für Tag …