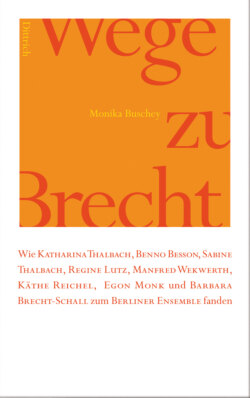Читать книгу Wege zu Brecht - Monika Buschey - Страница 11
ОглавлениеIhr Vater war nicht begeistert, als er die jüngste Tochter zum Theater streben sah. Aber er wusste auch: Wenn er es verbietet, verbietet er ihr das Leben. So reiste die Basler Professorentochter im Schlafwagen nach Berlin, in die Trümmerstadt, und machte dort ihr Glück: Sie gehörte zu denen, die sich am allerbesten darauf verstanden, das zu zeigen, was Brecht wollte – ohne sich deswegen in ihn zu verlieben.
Sie sind jetzt ein Theaterstar, Regine, sagte Brecht, Sie brauchen ein Auto. Schwer zu entscheiden, was er lieber mochte: Frauen oder Autos. Eine Frau mit Auto jedenfalls, das muss für ihn gewesen sein wie zwei Sonnen, die sich gegenseitig bescheinen. Ein Auto würde die junge Schauspielerin noch attraktiver machen. Und weil sie selbst es praktisch fand und angemessen – nicht etwa ihm zuliebe –, machte sie den Führerschein. Himmel hieß der Fahrlehrer. Ein Mann mit viel Humor und geringem Vorrat an Witzen. Ihm, Himmel, käme man in jedem Fall näher, pflegte er zu scherzen, ob man die Gefahren des Autofahrens nun durchstehe oder darin untergehe. Sie stand sie durch. Himmel sei Dank. Und wie so viele Herausforderungen in ihrem Leben empfand sie auch diese als großes Vergnügen. Gleich als sie sich zum ersten Mal hinter das Lenkrad geklemmt hatte, machte sie das Autofahren zu ihrer Sache, wurde sie Himmels gelehrige Schülerin, fand sie sich dem Rhythmus, vor allem dem Tempo des Automobils, wesensverwandt.
Auf den Straßen von Berlin war nicht viel los im Jahr 1951. Der Alexanderplatz: ein Paradies für Anfänger; und diese Schülerin wurde noch im Verlauf ihrer wenigen Fahrstunden von der Anfängerin zur Meisterin. Ihr Triumph, die Fahrprüfung bestanden zu haben, steigerte sich noch durch die Niederlage eines Mitschülers: Fritz Erpenbeck, von Beruf Theaterkritiker, fiel durch.
Ich habe den Führerschein, verkündete sie ihren Kollegen, und Erbsenspeck hat ihn nicht!
Ihr erster Wagen war ein DKW, zu heizen mit einem Katalytofen, gefertigt aus Sperrholz und einer speziellen Lackfolie, die das Dach bildete. Das Auto war ihr bald zur Selbstverständlichkeit geworden, sie benutzte es täglich, sie konnte sich gar nicht mehr vorstellen, jemals ohne gewesen zu sein. Brecht war zufrieden.
Zufrieden in dieser Hinsicht.
Zufrieden nicht so ganz, wenn er bedachte, wie sehr ihre auffällige Eigenständigkeit die junge Schweizerin unabhängig machte von ihm. Wie wenig sie ihm nachgab. Dabei fand er ihr gegenüber den diskretesten, zartesten Ausdruck für sein Begehren. Er öffnete einfach nur die Tür, ließ sie angelehnt, in der Hoffnung, die junge Frau werde eintreten. Werde spüren, dass da kein Riegel wäre, und eintreten. Da es ihm nun allerdings an Frauen nicht fehlte und dies auch nicht zu verbergen war, kam er zu dem Schluss, dass eben deshalb seine gotische Schöne, an der ihm so viel lag, die ihm so wunderbar lebhaft zu widersprechen verstand, distanziert blieb: Bestandteil eines Harems zu sein gefällt nicht einer jeden. Unter den gegebenen Bedingungen allerdings blieb er über Jahre verliebt und vielleicht war das eine wirksamere Inspiration, als es ein Nachgeben oder gar Hingeben ihrerseits gewesen wäre.
Von einem Kuss erzählt sie dennoch, einem einzigen. Und auch den Kuss, sie hätt’ ihn längst vergessen, wenn nicht eine so bestürzende Körperlosigkeit da gewesen wär’. Lockend war das nicht. Er war die Unscheinbarkeit selbst, so hat sie es empfunden, da beißt die Maus kein’ Faden ab, sagt sie, was immer andere Frauen in ihm gesehen haben – mit diesen Händen, diesen Lippen, dieser Haut konnte es nichts zu tun haben. Und um Zigarrengeruch aus jeder Pore anziehend zu finden, musste man doch auf einer Tabakplantage aufgewachsen sein!
Regine Lutz ist in Basel aufgewachsen, Leimenstrasse 19. Familie Lutz bewohnte das ganze Haus, und hinter dem Haus gab es einen Garten, so groß, dass man sich in Ecken und Winkeln verstecken konnte. Vom Haus aus war man dann nicht zu sehen. Ihr Vater war Arzt, Dermatologe, Professor in der nahe gelegenen Klinik. Ihre Mutter war lustig.
Sie beide, die jüngste Tochter und die Mutter, zeichnete diese Lustigkeit aus. Sie äußerte sich in einer Lebensfreude, auf die so schnell kein Schatten zu fallen wagte. Sie beide redeten gerne, miteinander und gegeneinander an, Sprechen und Lachen wurden zu einem Strom: unkontrollierbar, schwer zu steuern, nicht aufzuhalten. Professor Lutz hatte es insgesamt mit vier Frauen zu tun: mit der Mutter seiner Töchter, dann mit Anna, zwölf Jahre älter als Regine, und mit Dorle, sieben Jahre älter. Drei Töchter also, wie der König im Märchen. Und die Jüngste war die Allerschönste. Als sie unterwegs war, 1928, war es fast ein Skandal: ein Überraschungskind. Ihre Mutter war ja schon über vierzig. Da gehörte es sich nicht, schwanger zu sein, das war peinlich, provozierte lange Blicke, von Unbekannten wie Verwandten. Die Geburt dagegen war kein Problem, das Reginle stürzte nur so ins Leben, kaum dass einer mich hat halten können, sagt sie.
Für die Namensfindung hat es dann wieder einige Zeit gebraucht. Zuerst musste noch eine gewisse Enttäuschung überbrückt werden. Einen Jungennamen, den hatte man parat, Andreas. Zu noch einem Mädchen fiel den Eltern nichts ein. Dann den Namen der Mutter, schlug der Vater vor: Hedwig. Im letzten Moment besannen sich die Schwestern Anna und Dorle auf eine Tante im Schwarzwald, die hieß Regine. Sie beide kämpften für Regine. Und weil die älteren Mädchen das Überraschungskind doch möglichst lieben sollten, beschlossen die Eltern, ihre Wünsche recht ernst zu nehmen.
Regine zu heißen stellte sich für die Kleine zunächst als Schwierigkeit heraus, denn erstens betont man in der Schweiz immer die erste Silbe eines Wortes, und das brachte ihren Namen aus dem Gleichgewicht. Zweitens konnte sie als Kind kein R sprechen, was ihr reichlich Auslacher eintrug. Und als sie dann in die Schule kam – drittens –, verstümmelten die barbarischen Mitschüler den wenig vertrauten Namen Regine und nannten sie Rex. Das war nun wieder den Eltern ein Graus: ein männlicher Hundename für ihre Tochter! Später allerdings, am Theater, war sie mit ihrem Namen gut bedient. Regine Lutz, das war doch genau das Richtige für einen Bühnenstar mit eigenem DKW.
Alle Kinder spielen. Wer als Erwachsener nicht damit aufhört, muss an etwas festhalten, dass die anderen für überwunden halten. Muss groß werden und dabei Kind bleiben. Muss einen neuen Zugang finden zu den Quellen, braucht Gleichgesinnte, braucht Bestätigung.
Für Regine Lutz gab es das berühmte Schlüsselerlebnis. Ihr Vater, von ihr heiß geliebt, nahm sie mit zur Weihnachtsfeier in die Klinik. Sie war noch nicht in der Schule, soweit sie sich erinnert, noch ziemlich klein also. Zu Hause wird er schon so manche Probe ihres Könnens zu hören bekommen haben. Jetzt wollte er seine kleine Prinzessin den Kollegen vorstellen.
Das Gedicht vom Nikolaus, nicht wahr, Regine, das kannst du doch auswendig?
Natürlich konnte sie das, sie fing gleich an.
Warte, bis wir angekommen sind, sag es leise für dich auf, Schritt für Schritt, Wort für Wort, gib deine Hand!
Wenn er sie an der Hand hielt, musste sie den Arm recken, denn er war recht groß, der Herr Papa. Bei gerecktem Arm rutschten Kleid und Mäntelchen nach oben und von vorn sah das Reginle aus wie eine Marionette, die nur am linken Faden gehalten wird: schief. Angekommen am Ort des Geschehens ließ sie die Vaterhand gleich los, die Räume waren ihr ja vertraut. Vertraut und doch auch wieder nicht, denn im Kerzenlicht und mit dem vielen Tannengrün sah der kleine Saal dann doch ganz anders aus. Na, und da gab es ja auch eine Bühne, ein Podest. Auf das Podest hob der Vater einen Stuhl, auf den Stuhl stellte er das Töchterchen.
Das genau war der Moment. Immer der, den andere zum Weglaufen finden, zum Aufgeregtsein, so aufgeregt, dass der Atem stockt und die Handflächen feucht werden. Regine fühlte ihr Herz schlagen, fühlte wie ihr heiß wurde und der weiße Kragen ein bisschen eng. Allerdings: Herzfrequenz und Körpertemperatur addierten sich zu einem wohligen Gesamtbefinden. Eine Spannung, in der sie sich gern befand und die sie gern in sich fühlte. Die Blicke der Menschen wanderten in ihre Richtung, zuerst nur ein paar, dann nach und nach alle. Es wurde still, und es war ihr, als ob die entstehende Konzentration ihre Bühne unendlich vergrößerte. Ein weiter Raum lag vor ihr, der darauf wartete, gefüllt zu werden.
Als ihre Darbietung zu Ende war, verbeugte sie sich genauso gekonnt, wie sie gesprochen hatte. Und dann schrumpfte ihre Bühne wieder auf einen Stuhl, auf ein Podest zusammen, ihr Vater kam und half ihr hinunter, nein, er ließ es nicht zu, dass sie auf dem Boden landete, er nahm sie hoch, nahm sie auf den Arm, drückte sie an sich. Dass er nicht sprach, muss mit seiner Rührung in Zusammenhang gestanden haben.
Zu Hause war ihre Schwester Dorle diejenige, die ihren Spieltrieb nährte. Dorle konnte wunderschön malen, Dorle dachte sich kleine Szenen aus, mit Dorle verflog ein Nachmittag wie schöne Träume, und genau so erinnert sie sich daran. Mit Puppen spielten sie nie. Familien-Geschichten dachten sie sich aus, Geschichten mit drei Brüdern: Ruedi, Peter, Hans.
Ich war Ruedi, sagt Regine Lutz.
Mit der Schule kamen weitere Freuden ins Leben. Das Lesen, die Literatur, die deutsche Sprache, die sich doch vom Baseldeutsch – wie sie die Sprache ihrer Kinderzeit nennt – deutlich unterschied. Regine war wie besessen von dieser Sprache. Sie trainierte sich den Dialekt ab, wie ein Sportler ein zu hohes Körpergewicht. Dass es Kätzchen hieß und nicht Kätschen, davon war ihre Zunge nicht so schnell zu überzeugen. Da musste geübt werden und korrigiert und weitergeübt, und das jeden Tag. Jeden Tag las sie außerdem ihrer Mutter vor, eine Stunde, zwei Stunden. Anfangs Kinderbuchklassiker, Heidi, dann Robinson und Andersens Märchen, später Tolstoi und Fontane und französische Bücher, soweit sie zu beschaffen waren, im Original.
Als die Zeit von Gustav Güldenstein anbrach – ein jüdischer Emigrant aus Wien –, hatte Regine schon Begriffe dafür, was sie wollte. War sie schon im Theater gewesen. Ihr erstes Weihnachtsmärchen, »Der Zauberer und das Lachkräutlein«, hatte sie mit kritischen Augen gesehen.
Das Reginle habe gar nicht gelacht, sagte Lisa, die Köchin, die sie begleitet hatte.
Man hätt’ meinen können, sie hat sich gelangweilt.
Betroffen sah die Mutter ihre Tochter an.
Ja, wie war es denn?
Regine empört: Das hätte man anders machen müssen. Ganz anders machen müssen. Das kann ich besser. Da will ich hin!
Gelächter im Esszimmer. Noch ahnte ja keiner, wie stur diese Kleine den einmal eingeschlagenen Weg verfolgen würde. Noch war sie zu drollig, wenn sie sich ihrem Spiel überließ. Und ebendarum ging ihre Mutter mit ihr in die Stunde von Gustav Güldenstein. Die Akademiker-Familien waren aufgefordert, dem Emigranten zu helfen und ihre Kinder in den Genuss seiner pädagogischen Methoden zu bringen. Eine ganze Schar fand sich ein im Gymnastikraum einer Baseler Schule, fast alle Kinder in Begleitung ihrer Mütter, die am Spielfeldrand Platz genommen hatten. Gustav Güldenstein entwickelte das darstellerische Talent seiner Schüler mit kleinen Übungen.
Jetzt gehen wir mal alle quer durch den Raum, nur nicht so, wie ein Mensch gehen würde.
Regine Lutz hat sich damals fürs Froschsein entschieden, um sie herum Enten, Störche, Hasen, Giraffen, Affen, Schlangen und Elefanten. Und viele Nachahmer ihrer Sprünge, ihres Quakens. Wieder fühlte sie sich sehr gut in ihrer Haut. In Gustav Güldenstein war ihr ein Stern aufgegangen. Dass man so liegt, wie man sich bettet, hat sie erst später erfahren. Dass man im Spiel jede Haltung sprengen und im Handumdrehen zu einer neuen finden kann – diese Form der Zauberei ist die Lehre, die sie aus den Nachmittagen im Gymnastiksaal gezogen hat.
In der Schule machte sie sich indessen viele Freunde, weil sie im Unterricht mit Billigung der Lehrer Gedichte vortrug. Da waren schon mal fünf, vielleicht sogar zehn Minuten der ungeliebten Mathematikstunde verstrichen. Merkwürdig nachgiebig seien die Lehrer gegenüber dem unverlangt vorgetragenen Dichterwort gewesen.
Öfter kam jetzt die Frage, was sie denn nach der Schule würde lernen wollen. Und wenn sie zu ihrer immer gleichen Antwort ausholte, warfen sich die Eltern einen Blick zu. Hatten sie etwa Talente gefördert, die besser unerkannt geblieben wären? War ausgerechnet dieses besonders intelligente Kind dabei, ihren Erwartungen zu entfliehen?
Als Erster kapitulierte der Vater: Also gut, Theater, aber vorher die Lateinmatura, bitte schön! Regine versprach es und erbat sich gleich eine weitere Gunst. Aufs Baseler Konservatorium wollte sie gehen, einmal pro Woche, um ihr Hochdeutsch weiterzuschulen. Es gab da entsprechende Kurse für die Sänger, sie hatte sich erkundigt. Auch dazu nickt der Vater, allerdings müsse sie dann mit dem Klavierunterricht aufhören, sonst bliebe zu wenig Zeit für die Schule.
Regine Lutz, als die Matura geschafft war, ging nach Zürich ans Schauspielhaus. Dort wurde sie als Elevin und Kinderdarstellerin engagiert und eines Tages im Mai ins Foyer beordert. Bertolt Brecht wolle sie kennenlernen. Die Kollegen flüsterten den Namen. Nun sei glücklich, sagten sie ihr, er will dich sehen. Er, der Rückkehrer, der große Regisseur, der Dichter.
Brecht? Sie dachte nach. Nein, sie kannte ihn nicht. Der Deutschunterricht hatte bei Arno Holz aufgehört. Auch war die Deutschlehrerin in Kant vernarrt gewesen.
Neugierig ging sie hin. Sie ging nicht als eine, der eine Prüfung bevorstand. Sie ging als Prüfende. Wer mochte dieser Mensch sein? Warum wollte er sie sehen, was machte ihn in den Augen der Kollegen zu einem Wesen, von dem man halblaut sprach, wie sonst nur von Gott?
Die erste Begegnung war eine große Enttäuschung, denn er war klein. Er war schlecht rasiert, das störte sie sehr, grau gekleidet mit blauem Arbeitshemd. Eine komische alte Automütze auf dem Kopf, dicke Brillengläser, klobige Schuhe.
Später habe ich erfahren, dass die Schuhe handgenäht waren. Aber Bally-Schuhe, wie ich sie kannte – sie sagt es mit ausholender Armbewegung –, waren doch weit eleganter.
Nein, kein Sieger trat da auf sie zu. Da hatte sie ganz andere Männer erlebt. Carl Zuckmayer zum Beispiel. Der war ja auch Dichter. Und ein sexy man dazu. Was aber das Kurioseste war am kleinen Brecht in ihren Augen: Aus seinen Hosenbeinen schauten die langen Unterhosen hervor. Weiße Bündchen, nicht zu übersehen. Gerechter Gott, dachte die Lutz, bei der Hitze trägt der Mann lange Unterhosen.
Er begrüßte sie kurz und reichte ihr ein Papier. Durchschlagpapier, wie sie sofort erkannte, manche a’s und o’s der Maschinenschrift herausgeschlagen, Löcher also. Es war schwierig, so ein Blatt zu halten, es hatte die Tendenz, sich wegzubiegen. Gereimtes stand darauf, der Prolog des Kuhmädchens aus »Puntila«, wie sie später erfuhr.
Einen Text vom Blatt zu lesen, das machte ihr keine Probleme. Und als sie fertig war, zwinkerte ihr Kurt Hirschfeld, der Dramaturg, der auch zugegen war, aufmunternd zu. Brecht, wenn er denn in einem Schaukelstuhl gesessen hätte, wie später so oft, hätte sicherlich an dieser Stelle ein paar Mal Wippwipp gemacht. Ohne die Möglichkeit, seine Worte durch das Wippen ein wenig hinauszuzögern, lehnte er sich vielleicht zurück, ruckte an der Mütze, richtete sich dann wieder auf und fragte, ob sie die Verse einmal so lesen könnte, als ob sie noch nie Verse gesehen hätte. Als ob sie nicht wüsste, was das ist, als würde sie vom Reim überrascht.
Eine kurze Pause, dann fing sie an, durch den Text zu stolpern, wie einer, der einen Stoß in den Rücken bekommen hat und auf steiniger, abschüssiger Straße vorwärtstaumelt.
Geehrtes Publikum, der Kampf ist hart
Doch lichtet sich bereits die Gegenwart …
Dass er ein kluges Mädchen vor sich hatte, wird er sofort gewittert haben. Dass sie außerdem schnell und sicher erfassen und umsetzen konnte, was man ihr sagte, hörte er jetzt. Er dachte gleich über das Kuhmädchen hinaus. Eine Bessere könnte es für die Rolle nicht geben, und wie sie da vor ihm stand, Faltenrock und weiße Bluse, ungeschminkt, die Haare hinter dem Kopf zusammengebunden, die Schuhe flach, passte sie ins Bild, konnte er sich sehr wohl vorstellen, weiterhin mit ihr zu arbeiten.
Ich war ja, ohne es zu ahnen, genau so gekleidet, wie man im Berliner Ensemble gekleidet zu sein hatte. Es amüsiert sie noch immer.
Nun hat er sie sicher nicht wegen des Faltenrocks nach Berlin gelockt. Aber er hat sehr genau hingehört und hingesehen und ihr Aussehen wird ihm dabei nicht weniger aufgefallen sein als ihr seines. Nur war die Wirkung eine andere.
Von August 1949 an ist ihr Leben genau protokolliert: von ihr selbst. Zweimal pro Woche, montags und donnerstags, hat sie sich an den Tisch ihres jeweiligen Zimmers gesetzt – sie liebte es, zur Untermiete zu wohnen – und den Eltern geschrieben. Mehrere Seiten meist, es gab viel zu erzählen. Vor allem natürlich vom Theater. Aber auch von den besonderen Gegebenheiten der Stadt, vom täglichen Leben, den politischen Entwicklungen, von ihren Freundschaften, vom Wetter, von ihrer großen Dankbarkeit. Denn dass die Eltern sie hatten ziehen lassen, war keine Selbstverständlichkeit. Was man in Basel von Berlin hörte, hatte mit Ruinen und Schuttbergen zu tun, mit Sektorengrenzen, mit mangelhafter Versorgung, mit Gefahr.
Und wieder war es ihr Vater, der sich gegen die Bedenken der Familie durchsetzte. Schweren Herzens, aber doch. Die Tochter war nach damaligem Recht noch minderjährig, er hätte verbieten können, dass sie das Land verließ.
Aber er spürte, sagt sie, dass er mir damit mein Leben verboten hätte. Und er entschloss sich, Vertrauen zu haben in seine Jüngste – auch diesmal – und in ein Schicksal, das es gut meinte mit ihr.
In ihrer Wohnung hängt ein Foto von ihm als Kind. Er sitzt im Atelier des Fotografen – ein Bein angewinkelt – auf einem Stuhl mit geflochtenem Sitz und dunkler Lehne. Das Foto darunter, aufgenommen ein paar Jahrzehnte später, zeigt die kleine Regine, kindlich-trotzig, schwarzhaarig, auf dem Arm des Vaters.
Der erste Brief, den sie den Eltern schickte, war eine Reisebeschreibung: die Fahrt im Schlafwagen von Basel nach Berlin Friedrichstraße im Spätsommer 1949. Am Ziel angekommen, sah sie mit eigenen Augen, wovon keine vorher gelesene Beschreibung ihr ein Bild hat geben können.
Berlin, 22. August 1949
… rechts und links von der Bahn liegen mannshohe Backsteintrümmerhaufen. Ganze Hausfassaden haben hinten nichts, andere Blöcke sind halb geborsten, der Rest verbrannt … Riesenbunker stehen schräg in der Luft, wie untergehende Schiffe. Eisenbahnschienen und rostige, dicke Betonstangen ragen einfach in den Himmel. In der Spree liegen zwei Hälften einer Eisenbahnbrücke. Ihr macht Euch keine Vorstellungen …
Für sie war das alles kein Grund zu erschrecken. Der Krieg war ja vorbei! Und außerdem gab es Emil. Erich Kästners »Emil und die Detektive« diente ihr als erster Berlin-Führer. Eine Abenteuergeschichte mit präzisen Ortsbeschreibungen. So wohnte etwa Emils Großmutter in der Schumannstraße 13. Schumannstraße 13, das war in der realen Welt die Adresse des Deutschen Theaters.
Woran man doch schon sieht, findet sie, wie treffend und phantasievoll der Kästner die Örtlichkeiten der Stadt beschrieben hat. Als 20-jährige hat sie Berlin ganz so empfunden wie Emil: als ein Abenteuer. Und wie er hat sie sich darin wohl gefühlt von Anfang an. Keine Begegnung, der sie sich nicht mit zutraulicher Neugier genähert hätte, kein Ereignis, das nicht bewertet und genossen worden wäre.
Ich war ja, wo ich sein wollte, sagt sie, ich war ja von einem Wunder überzeugt!
Berlin, 25. August 1949
Meine Lieben, so unwahrscheinlich es für Eure Ohren klingen mag: ich bin sehr, sehr glücklich und schon völlig daheim. Ich konnte Euch nicht eher telegraphieren, weil man das nur vom Westsektor kann … Ich schlief tief und gut im Adria Hotel und wachte erst um elf Uhr auf. Dann ging ich den mir vorgeschriebenen Weg zur Luisenstraße 18 ins Theaterbüro. Natürlich verirrte ich mich, da die Straßennamen an unmöglichen Orten angeschrieben sind und Hausnummerstellen sind noch unmöglicher …
Ich kam endlich an und fand Brecht. Das Wiedersehen war wirklich nett und im ersten Moment komisch, weil die Umgebung so ganz anders war wie die des Abschieds. Brecht nahm mich dann mit auf sein Zimmer und war einfach reizend. Er erklärte mir dies und das, also zuerst »Puntila« und dann »Wassa« (Ludmilla!), daneben könnte ich auch im Kabarett mitmachen, abends hätten sie öfter Theaterdiskussionen, etc. Ich könne da ganz machen, wie ich wollte, ganz nach Lust. Dann zählte er mir Zeitungen auf, die ich lesen solle, »um mein Publikum kennenzulernen«, also Ost- und West-Zeitungen, und gab mir Ratschläge für die Stücke an den anderen Theatern im Westen, die ich sehen sollte.
»Faust II« wird gegeben etc. Ich merkte und merke es täglich, dass ich Anfängerin auf ganzer Linie bin und kann meine Zürcher Lorbeeren ruhig abbauen. Brecht sagte zum Beispiel, dass das schlechteste Theater hier noch nicht so schlecht ist wie die schweizer … Ich glaube, dass ich hier in Berlin ungeheuer viel lernen werde, nicht nur beruflich, meine ich. Die Schweiz hat ja tatsächlich keine blasse Ahnung …
Dann ging ich zum ersten Mal in den Künstlerclub »Die Möwe« essen. Brechts sind so reizend und zahlen mir jetzt noch alles Essen, bis die Lebensmittelkarten etc. in Ordnung sind. Zum Essen gab es eine ausgezeichnete Tomatensuppe, dann ein Filetfleischstück, Kartoffeln und gem. Salat. Zum Dessert Vanilleköpfli mit Schokoladensauce und nachher noch Käsekuchen mit Schlagsahne, aber ich war schon satt. Dieses Essen kostet 7,50 Ostmark, das wäre ca 1,50 Westmark …
Euer Leben kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, das ist ein Märchen. Aber ich sage mir: »Mal ran an die Sache – und folglich jeht es mir jut. Wat anderet kommt eben gar nischt in Fraache. (Die Leute reden hier tatsächlich so – irrsinnig komisch!)
Also tausend tausend Grüße!
Erstaunlich bei aller Begeisterung – ihre Skepsis gegen Brechts Theater. So sehr die Arbeit sie erfüllte: dass der Dichter mit den dicken Brillengläsern und den plumpen Schuhen ein gleichsam ernüchtertes Spiel von seinen Schauspielern verlangte, enttäuschte sie. Sie war doch gewohnt, ihr Familienerbe, ihre Lustigkeit, ins Spiel zu bringen. Theaterspielen als Beweis für Mut und als Ventil für Übermut. Farbig, emotional und natürlich so, dass sie sich als Spielende mit der Rolle identifizierte, das war ihr Verständnis von der darstellenden Kunst. Das war es doch, was daran Spaß machte. Und mit ihm war es, als nähme einem einer das liebste Spielzeug weg. Nähme es weg mit dem Verbot, es jemals wieder zu gebrauchen.
Der Prolog des Kuhmädchens? Bitte so, war sein Gebot, wie ein Reporter eine Reportage verlesen würde. Sie fühlte sich wie die Inhaberin eines Weinlokals mit hundert guten Tropfen im Keller, die plötzlich nur noch Wasser ausschenken darf. Wie langweilig! Eigentlich ist ihr erst nach Brechts Tod so richtig aufgegangen, dass man die Gefühle, die man beim Publikum erwecken will, als Schauspieler nicht aufbrauchen darf.
Mit ihrem Unbehagen war sie nicht allein. Die meisten Kollegen hatten anfangs das Gefühl, es werde ihnen hier die Schau gestohlen. Wollten es nur hinterher nicht mehr wahrhaben. Auch die große Giehse, Regine Lutz erinnert sich genau, murrte und war schwer zu überzeugen. Überhaupt: »Puntila« sei als zu lang empfunden worden, von den Schauspielern wie vom Publikum. In der »Courage« dagegen, auch im »Hofmeister« – eine Brecht-Bearbeitung des Stückes von Jakob Michael Reinhold Lenz – kam das, was er wollte, unmittelbar zur Geltung: ein Appell an das Denken, der das Gefühl nicht überwältigt, sondern mitschwingen lässt. Der Erfolg war durchschlagend. Die Hohe Schule seines Theaters. Nach der Katastrophe des Weltkriegs, sagte Brecht, könne man nicht Theater machen wie zuvor. Und im Gespräch mit ihr allein fügte er hinzu, es werde etwa zehn Jahre dauern, ehe er seine Idee von Theater vollständig entwickelt und durchgesetzt hätte. Er starb 1956.
Regine Lutz lag von der ersten Spielzeit an gut im Rennen. Sie spielte erstes Fach, sie stand in der ersten Reihe. »Spielen, spielen, spielen«, das war es ja, was sie wollte, sie schrieb es ihren Eltern in immer neuen Formulierungen. Das, was sie sich wünschte, und das, was ihr begegnete, ergänzten sich. Wie so oft in ihrem Leben stand sie auf dem Teil der Wiese, wo die Blumen blühten. Sie spielte das Kuhmädchen in »Puntila und sein Knecht Matti«, die Ludmilla in Gorkis »Wassa Schelesnowa«, das Gustchen im »Hofmeister«, die Yvette in der »Courage«, die Virginia in »Leben des Galilei«, die Polly in der »Dreigroschenoper«. Und allmählich löste sich ihr Widerstand auf.
Wenn man Erfolg hat, dann lässt man sich gern breitschlagen. Und es fing an, ihr Freude zu machen, mit ihm um die Wahrheit zu kämpfen. Das reizte sie, forderte sie heraus. Und ihre Irritation war immerhin sehr produktiv: Brecht liebte die Auseinandersetzung, bot sie ihm doch Gelegenheit, sein Prinzip von einer neuen Seite her deutlich zu machen. Und wenn ihm die kleine Schweizerin widersprach, dann merkte man ihm an, wie gern er darauf einging.
Wir hatten ja keinen Respekt, sagt sie. Keine eingeschüchterte Ehrfurcht, meint sie. Wir waren so jung! Und er war ja in ihren Augen nicht das Genie des Jahrhunderts, er war einer, der am Zustandekommen der Aufführung teilhatte, mitarbeitete. An entscheidender Stelle, das gewiss. Jedoch begegnete man einander von gleich zu gleich. Ein Von-oben-nach-unten ließ er niemanden spüren. Dass bei Brecht die Ursache gespielt wurde, nicht die Wirkung, hat sie langfristig überzeugen können. Und heute, wo sie selbst unterrichtet, erklärt sie ihren Schülern den Unterschied, indem sie ihn demonstriert. Zwei Schülerinnen lernen den Text vom Kuhmädchen, die eine spielt nach überkommenem Muster, die andere verschafft sich Distanz zur Rolle und versucht es auf die Brecht’sche Weise.
Und dann sehen wir alle, sagt Regine Lutz, dass die Brecht’sche Art weit eindrücklicher ist und dass man sich viel besser merkt, was man da gesehen und gehört hat. Die Wirkung, gerade dann, wenn der Schauspieler nicht darauf herumreitet, stellt sich umso nachhaltiger ein. So gesehen ist sie noch immer Missionarin seiner Anregungen, seiner Ideen.
Verdient habe sie damals mehr als ein Oberarzt in der Charité, und – verursacht durch so viel geballte Anerkennung – das Näschen, sagt sie, ganz schön hoch getragen.
Im Ensemble der vielen Gleichaltrigen war sie die Ungleiche: was nicht das Alter betraf. Sie war so heil, so unversehrt, so gesund und bodenständig. Aus dem Kriegsgeschehen hervorgegangen, ohne sich auch nur den Kopf gestoßen zu haben. Und es war, als bildete ihre beschützte Kindheit noch immer eine Aura der Unangreifbarkeit um sie. Es wird ihr nicht nur Sympathie eingetragen haben. Und auch sie hatte es mit vielen Kollegen nicht immer leicht.
In meinem Alter, sagt Regine Lutz, braucht man sich keine Zurückhaltung mehr auferlegen. Sie sagt es strahlend und mit der Freundlichkeit einer Veilchenverkäuferin im Frühling. Das Berliner Ensemble sei eine Ansammlung von Charakterschweinen gewesen, besonders die Männer. Auch in diesem Fall beiße die Maus den Faden nicht ab. Und natürlich: Jeder Mensch, jede Gruppe, jede Sache zeige, von verschiedenen Seiten betrachtet, ein anderes Gesicht. Allerdings sei durch die Vielzahl der erotischen Verflechtungen ein Klima entstanden, das einem doch zeitweilig ganz schön auf die Atemwege schlagen konnte. Wenn etwa eine der Kolleginnen – »eine dumme Nocken« nennt sie sie in ihren Briefen an die Eltern – so lange vor dem Brecht’schen Thron gekniet habe, bis der Meister über sie hat stolpern müssen. Die bewegende Frage, wer wann mit wem schlief, könnte einen viele Stunden beschäftigen – wenn man denn den Ehrgeiz hätte, der lange verrauschten Lust dieser Jahre noch einmal nachzugehen.
Brechts Assistenten, die sie alle nicht so recht hat ernst nehmen können – es war ihr einfach nicht möglich – haben sich später an ihr … Nun ja, sagt sie, Rache wäre ein zu starkes Wort. Sie haben später, als viele von ihnen in entsprechenden Positionen waren, keinen Kontakt mehr mit ihr aufgenommen.
Bis 1959 war sie Mitglied des Berliner Ensembles, dann Gast in verschiedenen Theatern Berlins. Ortswechsel und Engagements zwischen München und Wuppertal, Bremen und Kassel. Fernsehrollen und Hörfunk. Ein Wanderleben mit vielen Stationen, eine davon auch die Heimatstadt Basel.
Und dann, sie war fast vierzig, kam die Liebe. Die einzige ihres Lebens, die sie ein paar Schritte weit weggebracht hat von der Schauspielerei. Ihr Mann war Arzt, Allgemeinmediziner in Kassel. In einem Stück, das in einer Arztpraxis spielt, hatte man ihr Briefpapier hingelegt, das aus einer Arztpraxis stammte. Alles sollte möglichst authentisch sein. Der Name fiel ihr auf: Paulus. Wenn schon ein Mann, hatte sie immer gedacht, dann müsste er, wie sie selbst, einen Jungennamen tragen. The importance of being Paulus. Paulus und Lutz, das schien ihr zueinander zu passen. Sie besuchte den Doktor in seiner Praxis.
Wir haben uns sofort ineinander verliebt. Sie flicht den Satz unauffällig zwischen die anderen. Liebe, konzentriert auf die eine und einzige Person, das sei ihre Sache ja nie gewesen. Es steht im Horoskop, und also ist da nichts zu machen: Sie ist nicht begabt für die Ausschließlichkeit. Immerhin hat sie Doktor Paulus und ihrer Gemeinsamkeit zuliebe nur noch ein-, zweimal pro Jahr gespielt und ansonsten den weißen Kittel angezogen und in der Praxis mitgearbeitet. Die Patienten haben sie geliebt. Als gute Schauspielerin war sie die Einfühlsamkeit selbst und zudem die beste Überbringerin schlechter Nachrichten, die man sich nur denken konnte. Und was sie als Schauspielerin gelernt habe im Umgang mit Patienten, das sei gar nicht hoch genug einzuschätzen. Als Beispiel erzählt sie von einer Frau, deren Mann in der Nacht gestorben sei. Doktor Paulus war im Krankenhaus bei ihm, und am nächsten Morgen schickte er seine Frau zur Frau des Verstorbenen.
Wir würden doch im Theater, sagt sie, wenn es um Tod und Verderben ginge, immer glauben, den Schmerz nach außen kehren zu müssen: eine große Geste, ein Schreck, ein Schrei. Die Frau, der sie die Todesnachricht überbrachte, habe nur dagestanden und tonlos geflüstert: Und ich hab’ keine schwarzen Strümpfe im Haus.
Als es Doktor Paulus war, der starb, gelang es Regine Lutz nach zwölf Ehejahren ihre Liebe wieder in die Weite zu schicken und unter ihrer Trauer die Spielfreude hervorzuziehen. Noch einmal ein richtiger Aufbruch. Sie arbeitete mit Zadek, mit Boy Gobert. Und als sie mit 60 Jahren schwer krank wurde, besiegte sie die Krankheit mit dem Vorsatz, ein Buch schreiben zu wollen. Ein Buch über die Schauspielerei, ein Lehrbuch. Sie ist darüber wieder gesund geworden. Seither ist sie eine gefragte Lehrerin: Sie unterrichtet an Schauspielschulen in Berlin, Leipzig, Bochum, Essen, München. Der Faden reißt nicht ab. Manchmal folgt sie Einladungen ins Ausland. Demnächst fliegt sie nach Korea.
Vom regelmäßigen Üben der Fünf Tibeter – einer Form des Yoga – darf der Mensch sich lebenslange Elastizität der Glieder und des Geistes erwarten. Seit 20 Jahren hat Regine Lutz sich den Fünf Tibetern verschrieben. Sie darf als der munterste Beweis der These gelten, wonach es jung erhält, die Disziplin in den richtigen Dienst zu stellen. Brecht hatte recht, einmal mehr. Denn er hat der Zwanzigjährigen vorausgesagt, dass ihre beste Zeit erst im Alter anbräche, jenseits der 60. In ansteigender Linie verläuft ihr Leben. Wer sie besucht, möge ganz Schwamm sein, denn sie ist Wasser. Wenn niemand da ist, der ihr zuhört, schreibt sie Briefe.
Verortet hat sie sich – seit es keine festen beruflichen oder privaten Engagements mehr gibt, die sie an andere Städte bänden – in München. Man fährt in den sechsten Stock und läuft noch eine Treppe höher, in den siebten. Es kann ein Luxus sein, alles zur Hand, alles in der Nähe zu haben. Insofern ist eine kleine Wohnung ein großer Luxus. Diese Wohnung ist es umso mehr, als sie auf der einen Seite ins Treppenhaus, auf der anderen Seite jedoch direkt in den Himmel führt, in den siebten. Würde man das Fenster öffnen, man könnte vom Teppich aus gleich zu den Wolken hinübergehen. Kein Nachbarhaus im Blickfeld, das die Aussicht versperrte.
Bei klarem Wetter, sagt die Bewohnerin, kann ich die Berge sehen. Dieser Himmel lädt zum Sichhineinträumen ein: Wolkenballett, dramatische Umstürze, ruhiges Dahinziehen. Und an diesem Nachmittag im Oktober 2006: Rembrandtlicht.
Nachts kommt es vor, dass sie am Fenster steht und den Mond befragt.
Eigentlich bin ich gar nicht sympathisch, sagt Regine Lutz, strahlend wie gewohnt.
Ich bin egoistisch!