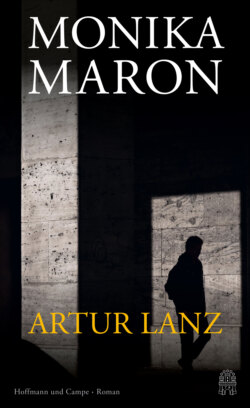Читать книгу Artur Lanz - Monika Maron - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIch las und las, Artus, Ginevra, Merlin, Gawan, Lancelot, und je mehr ich las, umso widerstandsloser versank ich im Reich des Zaubers und der Geheimnisse, der Ritterehre, unerschrockener Helden und der schicksalhaften Liebe. Ein Märchen, an dem Kelten, Franzosen, Engländer, Deutsche Jahrhunderte gedichtet hatten, in dem die Heldentaten mit jeder neuen Erzählung vermutlich größer wurden als die überlieferten und ihre Vollbringer edler, schöner und todesmutiger, als je ein Mensch sein könnte. Aber es lag ja eine Wahrheit unter der vielstimmigen Erzählung, Ereignisse, die der Dichtung über sie vorausgegangen waren. Und auch wenn die Heldentaten geringer waren, der König weniger großmütig und weise, die Liebe irdischer, so lebte in dem endlosen Epos über die versunkene Zeit doch die Sehnsucht, es möge so gewesen sein, die Helden so ehrenhaft, ihre Taten so großartig, ihre Liebe so rein. So ähnlich erging es mir. Natürlich wusste ich, dass ich in einer zivilisierteren, ungleich komfortableren Zeit lebte, und trotzdem trauerte ich etwas Verlorenem nach, wenn ich eine oft beschriebene Szene zwischen zwei Rittern las, deren Wege sich zufällig gekreuzt hatten, die darum im Kampf ihre Kräfte messen mussten, und der Sieger dem Besiegten beschied, er selbst müsse jetzt zwar weiterreiten, aber er, der Unterlegene, solle sich auf den Weg nach Camelot machen und sich der Gnade der Königin, deren Ritter der Sieger sei, unterwerfen, was dieser bei seiner Ritterehre versprach und auch tat. Wo ließ sich ein solches Verständnis von Ehre heute noch finden? Nicht einmal im Sport. Eine Fußballmannschaft, der unrechtmäßig ein Elfmeter zugesprochen wurde, würde ihn bedenkenlos in ein Tor verwandeln und den unverdienten Sieg reuelos bejubeln. In amerikanischen Filmen versicherten Menschen einander oft, dass es ihnen eine Ehre gewesen sei, miteinander gearbeitet oder auch nur gesprochen zu haben, was vielleicht nur eine Floskel war, die in mir aber jedes Mal, wenn ich sie hörte, als ein zartes Echo nachhallte.
Es werden weniger die blutigen Heldentaten gewesen sein, die in der Mutter von Artur Lanz die Begeisterung für König Artus und seine Ritterrunde entzündet haben, sondern die Ritterlichkeit, die Hohe Minne, die Bewunderung der Männer für die Frauen, wenn auch vorwiegend nur für deren Schönheit, und die Bewunderung der Frauen für die heldenhaften, ritterlichen Männer.
Ich stellte mir vor, wie vor fünfzig oder sechzig Jahren ein junges Mädchen in einer kleinen süddeutschen Stadt, das durch Zufall an ein Buch über die Artusrunde geraten war, sich in diese Welt von Treue, Ehre und Heldentum, die nicht besudelt war von der deutschen Schuld, hineinträumte. Und vielleicht war es ihre eigene Tapferkeit, dass sie es wagte, einen dahergelaufenen Flüchtlingssohn zu heiraten, weil sie ihn liebte oder weil ihr romantisches Gemüt gerade ihm, dem gedemütigten Außenseiter, beistehen wollte, ihm die Kraft einhauchen, die er brauchte, um ein starker, wehrhafter Mann wie aus ihren Büchern zu werden. Aber dann wurde das Leben mit ihm vielleicht zur Enttäuschung, der Mann blieb scheu und wortkarg, wenn auch nicht lieblos. Aber sie träumte von einem wilderen Leben, in dem es auf mehr ankam als auf Rechtschaffenheit. Wahrscheinlich waren Artur Lanz’ Mutter und ich in ähnlichem Alter, nur wuchs ich nicht in der süddeutschen Provinz auf, sondern im gottlosen Osten Berlins und war das Kind großzügiger, aufgeklärter Eltern, die die vitale Experimentierfreude ihrer Tochter zwar manchmal mit Sorge beobachteten, aber nie behinderten. Welche Sehnsüchte und Phantasien in der provinziellen Enge blühen, wusste ich nur aus Erzählungen und Büchern. Die Mutter von Artur Lanz jedenfalls, stellte ich mir vor, hatte es in die Welt der Ritter verführt und ihrem Sohn diesen verheißungsvollen Namen beschert.
Zwei Wochen nach unserer letzten Begegnung rief Artur Lanz mich an. Ob er mich vielleicht auf ein Glas Wein oder ein Abendessen einladen dürfe, ihm gingen so viele Dinge durch den Kopf, Erinnerungen, die er verloren geglaubt hatte. Er hoffe, ich empfände ihn nicht als zudringlich, aber unser Gespräch sei ihm in so schöner Erinnerung, dass er dringend wünsche, es fortzusetzen.
Wir trafen uns im »Platzhirsch«, einem Restaurant am Rande des Platzes, auf dem wir uns zum ersten Mal begegnet waren. Es dauerte ein Weile, ehe wir unsere Befangenheit verloren. Wir blätterten in der Speisekarte, die, wie schon der Name des Restaurants verhieß, vorwiegend Wildgerichte anbot.
Herr Lanz entschied sich für Hirschgulasch, ich nahm den Rehrücken, beides mit Rotkohl und Klößen, dazu eine Flasche Merlot.
Artur Lanz berichtete von seinem letzten Arztbesuch, die letzten Befunde seien gut, um sein Herz stehe es bestens, jedenfalls was den medizinischen Aspekt betreffe.
Und sonst, fragte ich.
Ja, und sonst, sagte er und zuckte mit den Schultern. Irgendwie sei alles ins Wanken geraten, wahrscheinlich denke er zu viel nach. Seine Arbeit, er sei Physiker, die ihm bis vor kurzem wichtig und sinnvoll erschienen sei, bereite ihm kaum noch Freude. Auch das Leben als Single sei ungewohnt, obgleich er sich ein Leben zu zweit im Augenblick gar nicht vorstellen könne.
Und alles hat mit dem Hund im Rapsfeld angefangen, sagte er, dann der Herzinfarkt, danach die Scheidung, und plötzlich fragt man sich, wo man eigentlich falsch abgebogen ist. Aber lassen wir das. Haben Sie sich inzwischen mit unseren Helden Artus und Lancelot befassen können?
Ich erzählte ihm, wie es mir dabei ergangen war, dass ich die Geschichten gelesen hätte wie als Kind die Märchen von Prinzen und Prinzessinnen und dass ich glaubte zu verstehen, was seine Mutter daran bezaubert hatte.
Während des Essens widmete sich unser Gespräch vorwiegend den Speisen, was mir Zeit ließ, darüber nachzudenken, warum die Träume seiner Mutter so lange gebraucht hatten, um in der Erinnerung ihres Sohnes Artur wieder aufzutauchen. Nach dem zweiten oder dritten Glas Wein zog Herr Lanz einen Briefumschlag mit Fotos aus der Tasche. Vielleicht interessiert es Sie, sagte er und breitete die kleinen quadratischen Schwarzweißbilder wie ein Kartenspiel vor mir aus. Das ist meine Mutter, sie hieß Maria, ich glaube, die Hälfte aller Frauen bei uns hieß Maria.
Auf den ersten Blick fand ich in dem Bild von Maria Lanz wenig von dem, was ich mir unter ihr vorgestellt hatte. Ein junges, hübsches Gesicht unter den toupierten, turmähnlich aufgesteckten Haaren, mit einem Lächeln, dem man ansah, dass es nur der Kamera galt, nicht dem Fotografen. Auf einem anderen Bild steht sie an einen Baum gelehnt, ein Bein angewinkelt und den Fuß gegen den Stamm gestemmt, das Haar offen, vom Wind gezaust, der Blick herausfordernd. Wären die übermäßig breiten Schulterpolster ihrer Lederjacke nicht gewesen, hätte sie nichts von heutigen jungen Frauen unterschieden.
Und hier bin ich beim Abiball, sagte Herr Lanz, tippte auf ein Foto in der hinteren Reihe und lachte verlegen, als wäre ihm dieses Zeugnis seiner jugendlichen Erscheinung peinlich. Ein hübscher, noch wenig männlicher Jüngling mit einem auffallend dünnen Hals in einem dunklen Anzug, der, obwohl er ihm passte, trotzdem zu weit oder zu lang, jedenfalls unpassend wirkte. Er sah aus, als bemühte er sich um einen ernsten, dem Anlass gemäßen Gesichtsausdruck, müsste sich aber anstrengen, um ein Lächeln zu unterdrücken. Alles an ihm schien unentschieden, das Gesicht, die Haltung, die ratlos herabhängenden Arme.
Der geborene Held waren Sie wirklich nicht, sagte ich.
Ich hatte es schon immer als ungerecht empfunden, dass Männer mit zunehmendem Alter oft an Attraktivität gewannen, dass Falten und angegrautes Haar bei ihnen das signalisierten, was sie für Frauen anziehend machte, während die gleichen Alterssymptome bei Frauen in Männern das Gegenteil bewirkten. Artur Lanz gehörte zu den Männern, denen der Verlust der Jugend nicht geschadet hatte, wenn man von seinem kranken Herzen absah und anderen körperlichen Malaisen, von denen ich nichts wusste.
Sag ich ja, der Kämpfertyp war ich nicht, sagte Herr Lanz, aber damals, er zeigte noch einmal auf sein Jugendfoto, damals war ich wahnsinnig verliebt in die Freundin meines besten Freundes. Die Geschichte fiel mir wieder ein, als ich jetzt noch einmal das ganze Drama zwischen Artus, Ginevra und Lancelot gelesen habe. Sie hieß Hanna, ich glaube, sie war nicht einmal besonders hübsch, aber sie hatte wie Ginevra wunderschönes blondes Haar. Für meinen Freund schwärmten viele Mädchen, er war der beste Sportler der Schule und spielte außerdem in einer Band. Warum er sich ausgerechnet für Hanna entschieden hatte, kann ich nicht sagen, vielleicht weil ihr Vater Chefarzt in unserem Krankenhaus war, vielleicht war er wirklich in sie verliebt, jedenfalls behandelte er sie nicht besonders gut, was mir darum viel Platz an ihrer Seite einräumte. Ich reparierte ihr Fahrrad, machte ihre Mathe-Hausaufgaben, hörte zu, wenn sie mir von ihrem Kummer mit meinem Freund erzählte, suchte stundenlang mit ihr nach ihrer Katze, wenn die wieder mal nicht nach Hause kam, aber nie, nie unternahm ich nur den geringsten Versuch, sie zu umarmen oder gar zu küssen. Inzwischen kann ich mir vorstellen, dass ich mich nur in sie verliebt habe, weil sie die Freundin meines besten Freundes war. Ich glaube, ich gefiel mir in meinem entsagenden Edelmut. Wenn ich schon kein Kämpfer war, wollte ich wenigstens ein Ritter sein, Hannas Ritter. Lancelot zwischen Artus und Ginevra, obwohl das ja nicht ganz so edelmütig endete.
Ich sagte, dass seine Mutter sich ja vielleicht gerade das von ihm erhofft hatte, was Herr Lanz bezweifelte. Seine Mutter hätte noch von jemandem sagen können, der sei ein richtiger Mann oder ein gestandenes Mannsbild. Sie hätte wohl doch etwas Heroisches im Sinn gehabt.
Ich war ungefähr so alt wie Maria Lanz, aber was ihr Sohn mir über sie erzählte, erinnerte mich eher an meine Mutter als an mich selbst. Obwohl wir im Osten, also dem sozialistischen Teil Deutschlands, lebten, wo fast alle Frauen berufstätig waren, hatte meine Mutter, als wäre es etwas Besonderes, immer betont, dass sie schließlich »ihr eigenes Geld« verdiene, war aber trotzdem davon überzeugt, dass Frauen einen Mann brauchten, zu dem sie aufschauen könnten. Ihr eigener Mann, mein Vater, war Lehrer für Mathematik und Sport, meine Mutter arbeitete als Sprechstundenhilfe in der Tierarztpraxis nebenan und reichte meinem Vater gerade bis zur Schulter. Ich glaube, dass meine Eltern in ihrer Ehe nicht unzufrieden waren. Aber schon bald nach dem Tod meines Vaters, er starb mit siebenundsechzig Jahren, schienen in meiner Mutter Erinnerungen an ihre Jugend zu erwachen. Zuerst veränderten sich ihre Lebensgewohnheiten, sie schlief länger und ging später zu Bett, sie kochte nur noch selten, belebte alte Freundschaften, sie suchte sogar nach ehemaligen Mitschülern und meldete sich, wie die Mutter von Artur Lanz, in einem Malzirkel an. Es kam mir damals vor, als bewegte sie sich sogar anders, als wäre eine Last von den Schultern genommen.
Die Maxime meiner Mutter, eine Frau müsse zu ihrem Mann aufschauen können, fand ich natürlich lächerlich. Andererseits hätte ich einen Mann, den ich für dümmer hielt als mich selbst, nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Im Gegenteil, ich verliebte mich fast immer in Männer, die ich für klüger hielt als mich selbst. Eigentlich hatte ich den belächelten Satz meiner Mutter nur in meine eigenen Bedürfnisse transferiert, allerdings mit geringerem Erfolg. Meine Ehen hielten nicht, bis dass der Tod uns schied.
Herr Lanz schob die Fotos übereinander und steckte sie wieder in das Kuvert.
Wenn man damals gewusst hätte, wo man mal landet, hätte man vielleicht manches anders entschieden, sagte er, ein anderes Studium, einen anderen Beruf … eine andere Frau. Er schüttelte kurz den Kopf, als wollte er die letzten beiden Worte wieder löschen.
Ach, sagte ich, oft weiß man gar nicht so genau, was man will, oder das, was man über das eigene Wollen sagen würde, stimmt mit dem, was man insgeheim sucht, nicht überein. Man wünscht nur, eine Person zu sein, die das, was man selbst für erstrebenswert hält, auch will, und dann stellen wir fest, dass wir diese Person nicht sind, dass sich in uns ganz andere Sehnsüchte verstecken.
Herr Lanz hob die Weinflasche an und hielt sie gegen das Licht. Sie war leer. Wir bestellten noch zwei Gläser.
Sie meinen also, dass wir uns selbst erst kennenlernen, wenn es zu spät ist?
Ich meine, sagte ich, dass sich in uns vielleicht ein Lebensentwurf mit einem anderen streitet und dass der, für den wir uns entscheiden, uns zwar verlockender erscheint, aber unserem Temperament nicht entspricht. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe zweimal geheiratet, ich wünschte mir wie die meisten Menschen einen verlässlichen Gefährten im Leben. Dabei war ich unfähig, mein Leben mit einem anderen Leben zu synchronisieren, ich war mehr als alles andere autonomiesüchtig. Das musste ich erst lernen.
Herr Lanz sah mich lange an, als suchte er in meinem Gesicht nach Zeichen meiner Autonomiesucht. Er wisse gar nicht, sagte er nach einer Weile, ob er wirklich einen Plan für sein Leben gehabt hätte. Eine Weile hätte er von einem künstlerischen Beruf geträumt, Theater, vielleicht auch Journalist, hätte es sich dann aber doch nicht zugetraut und sich darum für ein handfestes Studium wie Physik entschieden. Tatsache sei aber, dass nun in ihm etwas erwacht sei, dass schon vorher in ihm geschlummert haben musste.
Dieses Gefühl, sagte er, das Glück, das ich empfunden habe, als ich atemlos und erschöpft neben dem Hund am Feldrain saß …
Er wusste offenbar nicht, wie er den Satz beenden sollte, hob die Hände zu einer hilflosen Geste und ließ sie kraftlos wieder fallen.
Ich versuchte mir vorzustellen, wer Artur Lanz gewesen war, ehe ihn Hunderettung, Herzinfarkt und Scheidung in die Lebenskrise geworfen hatten, in der er nun steckte. Ein pflichtbewusster, gutaussehender, höflicher Mann mit ausreichendem Einkommen, verheiratet, zwei Kinder. Er hat geraucht, trank gern Wein, sonst keine auffälligen Leidenschaften. Wäre er mein Nachbar gewesen, hätte ich ihn sicher als angenehm empfunden.
In diesem Jahr hätten wir unsere Silberhochzeit feiern können, wir hatten schon eine Reise nach Lissabon geplant. Kennengelernt hätten sie sich noch während der Studienzeit, auf einer Geburtstagsparty bei Freunden.
Gleich nach seinem Examen haben sie geheiratet, zwei Jahre später kam das erste Kind, noch zwei Jahre später das zweite. Kathrin, seine Frau, war Lehrerin, Englisch und Deutsch, auf einer halben Stelle.
Es war alles ganz normal, sagte er, absolut normal.
Wie er so dasaß, immer noch verwundert über das Nichts, in das er gefallen oder gesprungen war, erinnerte er mich an einen Nachbarn aus meinem vorigen Leben, als ich noch in Pankow wohnte und Pankow durch eine Mauer vom Wedding und dem ganzen Rest der Welt getrennt war. Damals wohnte über mir eine liebenswürdige Familie mit zwei Kindern. Herr Barthel arbeitete als Gesangslehrer an der Schauspielschule, seine Frau war Übersetzerin. Ab und zu trafen wir uns auf ein Glas Wein. Eines Abends standen beide vor meiner Tür, sie mit rotgeränderten Augen, er mit gesenktem Blick. Sie müssten dringend mit jemandem sprechen, flüsterte sie.
Nachdem ich Wein und Gläser auf den Tisch gestellt und Herr Barthel sich mit dem ersten Glas aus seiner Sprachlosigkeit befreit hatte, erfuhr ich, dass an der Schauspielschule wie auch an anderen Hochschulen und Universitäten eine Resolution unterschrieben werden sollte, in der sich die Unterzeichner mit den juristischen Maßnahmen der Regierung gegen antisozialistische Umtriebe einiger bekannter Künstler solidarisch erklärten, was Herr Barthel aber vor seinem Gewissen nicht verantworten konnte.
Während ihr Mann immer wieder nur verzweifelt den Kopf schüttelte, wiederholte Frau Barthel alle paar Minuten denselben Satz: Friedhelm, denk an die Familie. Ich konnte ihnen nicht raten. Sie hatten beide recht. Man durfte so etwas eigentlich nicht unterschreiben. Eigentlich. Aber wenn er an seine Familie und sein sicheres Einkommen dachte, würde er unterschreiben müssen. Er hat unterschrieben und sich noch Jahre später, vielleicht für den Rest seines Lebens, dafür geschämt. Ich dachte an Eva und ihre Vorliebe für amerikanische Filme, in denen Männer aus Liebe zu ihrer Familie zu Helden wurden. Friedhelm Barthel musste, um seine Familie zu schützen, ein Feigling sein.
Aber jetzt, sagte Herr Lanz, der sich aus den Reminiszenzen an seine absolut normale und dann doch verunglückte Ehe wieder gelöst hatte, aber jetzt, sagte er mit überraschender Entschlossenheit in der Stimme, hätte er sich bei einem Selbstverteidigungstraining angemeldet. Er hätte darüber nachgedacht, wie er sich wohl verhalten würde, falls er erleben müsste, dass eine Frau oder überhaupt ein wehrloser Mensch angegriffen wird. Es sei ja sinnlos, die Polizei zu rufen, inzwischen könne ein Mensch zu Tode gekommen sein oder eine Frau längst vergewaltigt.
Man liest doch immer wieder in der Zeitung, sagte er, dass Menschen tatenlos zusehen, wie andere zusammengeschlagen werden, weil sie wehrlos sind, weil sie es mit solchen Typen gar nicht aufnehmen können. Ich will für so einen Fall in Zukunft gewappnet sein. Bisher habe ich jeden Mittwoch Tennis gespielt, jetzt gehe ich zum Krav Maga.
Was ist Krav Maga?
Eine israelische Kampfsportart, sogar für das Militär, aber auch für Zivilisten. Wehrhaftigkeit kann man nur bei den Israelis lernen. Ich habe mich über alle möglichen Methoden informiert, Taekwondo, Karate, Qwan Ki Do, Anti Terror Combat, Aikido, aber Krav Maga gefiel mir am besten.
Und dann wollen Sie wie Lancelot auf der Suche nach Aventures durch Berlin ziehen?
Er antwortete mit einem Lachen, das mich, wäre ich seine Mutter gewesen, beunruhigt hätte.