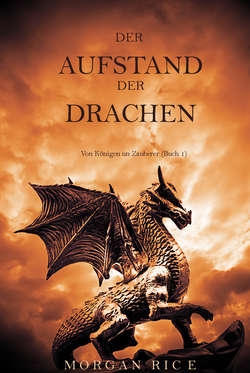Читать книгу Der Aufstand Der Drachen - Морган Райс, Morgan Rice - Страница 14
KAPITEL VIER
ОглавлениеMerk wanderte langsam den Pfad hinunter durch Whitewood, und dachte dabei über sein Leben nach. Seine vierzig Jahre waren keine leichten gewesen; er hatte sich nie zuvor die Zeit genommen, durch den Wald zu wandern und die Schönheit um ihn herum zu bewundern. Er sah auf die weißen Blätter hinab, die unter seinen Füssen raschelten, begleitet vom leisen Geräusch seines Stabs auf dem weichen Waldboden; im Gehen blickte er auf und nahm die Schönheit der Aesopbäume mit ihren glänzenden weißen Blättern an den leuchtend roten Ästen, die in der Morgensonne glänzten in sich auf. Die Blätter fielen wie Schnee auf ihn herab, und zum ersten Mal in seinem Leben verspürte er ein Gefühl des Friedens.
Von durchschnittlicher Größe und Statur mit schwarzen Haaren und einem immer unrasiert wirkenden Gesicht mit breitem Kiefer und markanten Wangenknochen und schwarzen Augen mit dunklen Ringen darunter, wirkte Merk immer, als hätte er tagelang nicht geschlafen. Und so fühlte er sich meistens auch. Doch nicht jetzt. Jetzt fühlte er sich endlich ausgeruht. Hier, in Ur, im Nordwesten von Escalon, gab es keinen Schnee. Die angenehme Brise vom Meer her, das nur einen Tagesritt gen Westen entfernt lag, sorgte für ein wärmeres Klima und erlaubte Blättern jeder Farbe zu gedeihen. Es erlaubte Merk auch, nur mit einem dünnen Umhang zu reisen, anstatt sich vor den eisigen Winden schützen zu müssen. Er musste sich immer noch daran gewöhnen, dass er einen Mantel anstelle eines Harnischs trug, einen Stab anstelle eines Schwertes, und dass er mit seinen Stab in Blätter stach und nicht mit einem Dolch in Feinde. All das war neu für ihn. Er wollte lernen, wie es war, dieser neue Mensch zu werden, der er so gerne sein wollte. Es war friedlich – und doch unbehaglich. Als ob er vorgab jemand zu sein, der er nicht war.
Denn Merk war kein Reisender, kein Mönch – und schon gar kein friedlicher Mann. Der Krieger lag ihm immer noch im Blut. Er war auch nicht irgendein Krieger; er war ein Mann, der nach seinen eigenen Regeln kämpfte, und er hatte nie auch nur eine Schlacht verloren. Er war ein Mann, der sich nicht vor einem Kampf fürchtete, egal ob es auf einer Tournierbahn war oder in einer der Tavernen in den Seitenstraßen, die er so gerne besuchte. Manche Leute bezeichneten ihn als Söldner. Als Assassinen. Als gekauftes Schwert. Es gab viele Bezeichnungen für das, was er tat, manche davon noch viel weniger schmeichelhaft, doch Merk machte sich nichts aus Titeln und Bezeichnungen, oder daraus, was andere Leute dachten. Alles was ihm wichtig war, war dass er einer der Besten war.
Um die Rolle zu erfüllen hatte Merk schon auf viele Namen gehört, und wechselte sie nach Lust und Laune. Den Namen, den sein Vater ihm gegeben hatte, mochte er nicht – genau genommen mochte er seinen Vater ebenso wenig – und er hatte nicht vor mit dem Stempel eines Namens durchs Leben zu gehen, den ihm jemand anderes aufgedrückt hatte. Merk war der letzte in einer ganzen Reihe von Namen, und für den Augenblick gefiel er ihm. Es war ihm egal, wie die anderen ihn nannten. Ihn interessierten nur zwei Dinge im Leben: den perfekten Eintrittspunkt für die Spitze seines Dolches zu finden, und dass seine Auftraggeber ihn in frisch gemünztem Gold bezahlten – einer Menge Gold.
In jungen Jahren hatte Merk entdeckt, dass er ein natürliches Talent besaß, und, in dem, was er tat, besser war als alle anderen.
Seine Brüder, genau wie sein Vater und alle seine berühmten Vorfahren, waren stolze und edle Ritter in den besten Rüstungen, mit den besten Waffen, die auf ihren edlen Pferden umherritten und ihre Banner und Haare im Wind wehen ließen, während die Damen ihnen Blumen vor die Füße warfen. Sie hätten nicht stolzer auf sich selbst sein können.
Doch Merk verabscheute den Prunk und die Aufmerksamkeit. Diese Ritter erschienen ihm schwerfällig beim Töten, unglaublich uneffektiv, und Merk hatte keinen Respekt für sie übrig. Er brauchte all die Anerkennung auch nicht, die Insignien oder Banner oder Wappen, die die Ritter so heiß begehrten. Das war für Leute, denen es an der Sache fehlte, die am wichtigsten war: der Fähigkeit, einem Mann leise, schnell und effizient das Leben zu nehmen. Alles andere stand für ihn nicht zur Debatte.
Als er jung war, und auf seinen Freunden, die zu klein waren, um sich selbst zu verteidigen, herumgehackt worden war. Waren sie zu ihm gekommen, da er schon damals als außergewöhnlich guter Schwertkämpfer bekannt gewesen war – und er hatte ihre Bezahlung angenommen. Die, die sie gequält hatten, taten es nie wieder, sie anzufassen, da Merk immer einen Schritt weiterging. Seine Fähigkeiten waren bald weitbekannt, und als Merk mehr und mehr Aufträge annahm, wuchsen auch seine Fähigkeiten, was das Töten anging.
Merk hätte ein Ritter werden können, ein gefeierter Krieger wie seine Brüder. Doch er hatte sich stattdessen dafür entscheiden, im Schatten zu wirken. Als er das erlangte, was ihn interessierte, nämlich tödliche Effizienz, erkannte er schnell, dass Ritter mit all ihren schönen Waffen und schwerfälligen Rüstungen nicht so schnell und effizient töten konnten wie er, ein einzelnen Mann mit Lederharnisch und einem scharfen Dolch.
Während seiner Wanderung spießte er mit seinem Stab die Blätter auf und erinnerte sich an eine Nacht in der Taverne mit seinen Brüdern, als feindliche Ritter ihre Schwerter gezogen hatten. Seine Brüder waren umzingelt gewesen, in der Unterzahl; doch während all die schicken Ritter herumstanden, hatte Merk nicht gezögert. Er war mit seinem Dolch durch ihre Reihen gehuscht und hatte ihnen die Hälse aufgeschlitzt, bevor sie auch nur ihre Schwerter heben konnten.
Seine Brüder hätten ihm danken sollen, doch stattdessen distanzierten sie sich von ihm. Sie fürchteten ihn, und sie blickten auf ihn herab. Das war die Dankbarkeit, die er erhielt, und ihr Verrat verletzte Merk tiefer, als er zugeben wollte. Er vertiefte den Bruch zwischen ihnen, mit all ihrer edlen Ritterlichkeit. In seinen Augen war alles nur eigennützige Heuchelei. Sollte sie doch in ihren glänzenden Rüstungen herumlaufen und auf ihn herabblicken, doch wenn er mit seinem Dolch nicht gewesen wäre, wären sie alle tot.
Merk wanderte immer weiter und versuchte seufzend, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Während er nachdachte, erkannte er, dass er die Quelle seines Talents nicht ganz verstand. Vielleicht war es, weil er so schnell und geschickt war; vielleicht war es weil er schnelle Hände hatte; vielleicht, weil er in besonderes Talent dafür hatte, lebenswichtige Punkte zu finden; vielleicht war es auch, weil er nie davor zurückschreckte, den einen Schritt weiterzugehen, den letzten Stoß zu vollziehen, vor dem sich andere Männer fürchteten; vielleicht war es auch, weil er niemals zweimal zuschlagen musste – oder es war, weil er improvisieren konnten und mit jedem Werkzeug töten konnte, das ihm zur Verfügung stand – einem Federkiel, einem Hammer, eine Holzscheit. Er war gerissener als andere, anpassungsfähiger und schneller auf den Beinen – eine tödliche Kombination.
Als er heranwuchs, hatten all diese stolzen Ritter sich von ihm distanziert und sich im Stillen sogar über ihn lustig gemacht (denn niemand wagte es, es ihm direkt ins Gesicht zu sagen). Doch jetzt, wo sie alle älter waren, und ihre Fähigkeiten schwanden, während sein Ruhm sich verbreitete, war er derjenige, an den sich Könige wandten, während sie alle in Vergessenheit gerieten. Denn was seine Brüder nie verstanden hatten war die Tatsache, dass Ritterlichkeit nicht das war, was einen König ausmachte. Es war die hässliche, brutale Gewalt, die Angst, die Vernichtung der Feinde – einer nach dem anderen, das grausame Töten, das niemand sonst tun wollte, das Könige zu dem machte, was sie waren. Und er war es, an den sie sich wandten, wenn sie wollten dass jemand die wirkliche Arbeit für sie erledigte.
Mit jedem Schritt und jeder Berührung seines Stabes dachte er an seines Opfer. Er hatte die schlimmsten Feinde des Königs getötet – nicht mit Gift – dafür kauften sie niedere Meuchelmörder, Giftmischer und Verführerinnen. Die schlimmsten Feinde jedoch wollten sie oft mit einem Paukenschlag beseitigen, und dafür brauchten sie ihn. Für etwas Grausiges, etwas Öffentliches: einen Dolch im Auge, einen Leichnam, der auf einem öffentlichen Platz lag, oder aus einem Fenster hing, damit alle beim nächsten Sonnenaufgang den sehen konnten, der es gewagt hatte, sich dem König zu widersetzen.
Als der alte König Tarnis das Königreich aufgegeben hatte, hatte er Pandesia die Tore geöffnet, und Merk war sich zum ersten Mal in seinem Leben leer und nutzlos vorgekommen. Ohne einen König, dem er dienen könnte, hatte er das Gefühl gehabt, herrenlos zu sen. Etwas, das lange Zeit in ihm vor sich hin geköchelt hatte, war zum Vorschein gekommen, und aus irgendeinem Grund, den er nicht verstehen konnte, begann er, über das Leben nachzudenken. Sein ganzes Leben lang war er vom Tod besessen gewesen, vom Töten, davon, Leben zu nehmen. Es war ihm leicht gefallen – zu leicht. Doch jetzt schien sich etwas in ihm zu verändern; es war, als ob er kaum den Boden unter den Füssen spürte. Er hatte immer aus erster Hand gewusst, wie zerbrechlich das Leben war, und wie leicht es einem genommen werden konnte, doch jetzt begann er darüber nachzudenken, wie man es schützen konnte. Leben war so zerbrechlich, so vergänglich. War es zu schützen nicht die schwerere Aufgabe?
Und ohne es zu wollen, begann er sich zu fragen: was war das, was er anderen nahm?
Merk wusste nicht, was diese Reflexion ausgelöst hatte, doch er fühlte sich zutiefst unwohl dabei. Etwas war in ihm aufgetaucht, eine große Übelkeit, und er war des Tötens müde geworden – er hatte eine Abneigung dafür entwickelt die so groß war wie der Spaß, den er einst daran gefunden hatte. Er wünschte sich, dass es eine Sache gäbe, auf die er alles zurückführen konnte – den Mord an einer bestimmten Person vielleicht – doch die gab es nicht. Es hatte sich vollkommen grundlos angeschlichen. Und das war das, was ihn am meisten irritierte.
Anders als andere Söldner, hatte Merk nur Aufträge angenommen, die er für gerechtfertigt hielt. Erst später im Leben, als er zu gut in dem geworden war, was er tat, als die Bezahlung zu groß geworden war, die Leute, die seine Dienste in Anspruch nahmen zu wichtig, hatte er angefangen, die Grenzen zu überschreiten, und Leute gegen Bezahlung umgebracht, die nicht unbedingt schuldig waren – nein, Schuld war kein Grund mehr gewesen. Und das war es, was ihn störte.
Merk hatte eine mindestens genauso große Leidenschaft dafür entwickelt, das wiedergutzumachen, was er getan hatte, um anderen zu beweisen, dass er sich ändern konnte. Er wollte seine Vergangenheit auslöschen, alles, was er getan hatte rückgängig machen, er wollte Buße tun. Er hatte den stillen Eid geschworen, nie wieder zu töten; niemals wieder einen Finger gegen andere zu heben, und den Rest seiner Tage damit zu verbringen, Gott um Vergebung zu bitten, sich selbst der Hilfe für andere zu widmen, und ein besserer Mensch zu werden. Und das war es, was ihn auf diesen Waldweg geführt hatte.
Merk sah den Waldweg vor sich ansteigen und dann wieder abfallen, leuchtend von den weißen Blättern. Immer wieder wanderte sein Blick auf der Suche nach dem Turm von Ur gen Horizont, doch er war immer noch nicht zu sehen. Er wusste, dass dieser Pfad in irgendwann dorthin führen musste, denn er hatte schon seit Monaten den Ruf dieser Pilgerfahrt gehört. Er war seit seiner Kindheit fasziniert gewesen von den Geschichten der Wächter, einem geheimen Orden von Ritter-Mönchen, halb Mann, halb etwas anderes, deren Aufgabe es war, in den beiden Türmen zu wohnen – dem Turm von Ur im Nordwesten und dem von Kos im Südosten – und über das wertvollste Relikt des Königreichs zu wachen: das Schwert des Feuers.
Die Legende besagte, dass es das Schwert des Feuers war, das die Flammen am Leben hielt. Niemand wusste sicher, in welchem Turm es sich befand. Es war ein Geheimnis, dessen Antwort außer den ältesten Wächtern niemand kannte. Wenn es je bewegt oder gestohlen wurde, würden die Flammen auf ewig verlöschen – und Escalon wäre schutzlos einem Angriff ausgeliefert.
Man sagte, dass das Wachen über den Turm eine hohe Berufung war, eine heilige Pflicht, und ehrenhafte Aufgabe – wenn die Wächter einen als einen der ihren aufnahmen. Merk hatte als Junge immer von den Wächtern geträumt und war jede Nacht mit der Frage schlafen gegangen, wie es wohl wäre, einer von ihnen zu sein. Er wollte sich selbst in der Einsamkeit verlieren, im Dienst, in Selbstreflexion, und er wusste, dass es keinen besseren Weg gab, als ein Wächter zu werden. Merk fühlte sich bereit. Er hatte seinen Kettenpanzer gegen Leder getauscht, sein Schwert gegen einen Stab und zum ersten Mal in seinem Leben hatte er einen ganzen Mond lang niemanden getötet oder verletzt. Er fing an, sich gut damit zu fühlen.
Als Merk einen kleinen Hügel erklomm, sah er sich hoffnungsvoll um, so wie er es schon seit Tagen tat. Er betete, dass der Gipfel ihm den Blick auf den Turm von Ur irgendwo am Horizont freigeben würde. Doch da war nichts – nichts außer noch mehr Wald, soweit das Auge reichte. Doch er wusste, dass er näher kam – nach so vielen Tagen des Wanderns konnte der Turm nicht mehr weit sein.
Merk folgte weiter dem Pfad. Das Dickicht wurde immer dicker, bis im Tal ein großer umgestürzter Baum den Weg blockierte. Er blieb stehen und sah ihn an, bestaunte seine Größe und fragte sich, wie er ihn überwinden konnte.
„Ich würde sagen, das ist wie genug“, hörte er eine unheilverkündende Stimme sagen.
Merk spürte sofort die finstere Absicht in der Stimme, darin war er mit den Jahren ein Experte geworden. Er musste sich nicht einmal umdrehen um zu wissen, was als nächstes kommen würde. Überall um sich herum hörte er Blätter rascheln und aus dem Wald kamen Gesichter hervor, die zu der Stimme passten: Halsabschneider von denen einer gefährlicher als der andere aussah. Das waren die Gesichter von Männern, die grundlos töteten. Die Gesichter gemeiner Diebe und Mörder, die den Schwachen mit willkürlicher und sinnloser Gewalt auflauerten. In Merks Augen waren sie der niederste Abschaum.
Merk sah, dass er umzingelt war und er wusste, dass er in eine Falle gelaufen war. Er sah sich unbemerkt um, und seine Instinkte erwachten. Er zählte acht Männer. Sie alle waren mit Dolchen bewaffnet und trugen zerschlissene Kleider. Ihre Gesichter, Hände und Fingernägel waren schmutzig. Die Männer waren unrasiert. Sie sahen aus, als hätten sie viel zu lange nichts gegessen und wären zu allem bereit. Und offensichtlich waren sie gelangweilt.
Merk verkrampfte, als der Anführer der Männer näher kam, doch nicht, weil er ihn fürchtete; Merk konnte ihn töten – er konnte sie alle töten – ohne mit der Wimper zu zucken, wenn er es wollte. Was ihn jedoch verkrampfen ließ war die Möglichkeit, zu Gewalt gezwungen zu werden. Er war entschlossen, sich an seinen Eid zu halten, koste es, was es wolle.
„Was haben wir denn da?“, fragte einer von ihnen, der um Merk herumging.
„Sieht aus wie ein Mönch“, sagte ein anderer mit höhnischer Stimme. „Nur die Stiefel passen nicht ins Bild.“
„Vielleicht ist er ein Mönch, der sich für einen Krieger hält“, lachte ein anderer.
Sie brachen in Gelächter aus und einer von ihnen, ein Ochse von einem Mann Mitte 40, dem ein Schneidezahn fehlte, beugte sich vor und stieß Merk an der Schulter an. Der alte Merk hätte jeden getötet, der es gewagt hätte, ihm zu nahe zu kommen.
Doch der neue Merk war entschlossen, ein besserer Mann zu werden, sich über die Gewalt zu erheben –selbst wenn die Gewalt ihn zu suchen schien. Er schloss die Augen, holte tief Luft, und zwang sich, ruhig zu bleiben.
Flüchte dich nicht in die Gewalt, redete er sich immer wieder zu.
„Was tut der Mönch da?“, fragte einer von ihnen. „Betet er etwa?“
Daraufhin brachen alle wieder in Gelächter aus.
„Dein Gott wird dich nicht retten, mein Freund!“, rief ein anderer.
Merk öffnete die Augen und sah den Idioten an.
„Ich möchte euch kein Leid zufügen“, sagte er ruhig.
Die Männer lachten, lauter als zuvor, und Merk erkannte, dass ruhig zu bleiben und nicht mit Gewalt zu reagieren, die schwerste Prüfung für ihn war.
„Welch ein Glück für uns“, antwortete einer.
Sie lachten wieder; dann verstummten sie, als ihr Anführer vortrat und Merk ansprach.
„Doch vielleicht“, sagte er mit ernster Stimme, und kam dabei so nah, dass Merk seinen schlechten Atem riechen konnte, „wollen wir dir Leid zufügen.“
Ein Mann schlang Merk von hinten seinen dicken Arm um den Hals und begann, ihn zu würgen. Merk keuchte. Der Griff des Mannes war stark genug, ihm Schmerzen zuzufügen, reichte jedoch nicht, ihm die Luft abzuschnüren. Sein Instinkt riet ihm, den Mann zu packen und zu töten. Es wäre leicht; er kannte den Druckpunkt am Arm, der ihn zwingen würde, ihn loszulassen. Doch er zwang sich, nichts zu tun.
Lass sie gehen, sagte er zu sich selbst. Der Weg zur Demut muss irgendwo beginnen.
„Nehmt alles was ihr wollt“, sagte Merk keuchend. „Nehmt es und verschwindet.“
„Und was, wenn wir es uns nehmen und leiben?“, antwortete ihr Anführer.
„Niemand hat dich gefragt, was wir nehmen dürfen, Junge“, sagte ein anderer.
Einer von ihnen trat an ihn heran und durchsuchte Merk. Mit gierigen Händen durchwühlte er die wenigen Habseligkeiten, die Merk bei sich trug. Merk zwang sich, ruhig zu bleiben. Schließlich zog der Mann seinen silbernen Dolch, seine Lieblingswaffe hervor, und so schmerzlich es auch war, reagierte Merk nicht.
Lass es gehen, redete er sich zu.
„Was ist das denn?“, fragte einer. „Ein Dolch?“
Er sah Merk böse an.
„Was für ein Mönch trägt denn einen Dolch bei sich?“, fragte ein anderer.
„Was tust du damit, Junge? Schnitzen?“, fragte ein Dritter.
Alle lachten. Merk biss die Zähne zusammen und fragte sich, wie viel mehr er ertragen konnte.
Der Mann der den Dolch genommen hatte hielt inne, warf einen Blick auf Merks Handgelenk und riss seinen Ärmel zurück. Merk wappnete sich – sie hatten es gefunden.
„Was ist das?“, fragte er Dieb, der sein Handgelenk gepackt hatte, es hochhielt und eingehend betrachtete.
„Sieht aus wie ein Fuchs“, sagte ein anderer.
„Was tut ein Mönch mit einer Tätowierung eines Fuchses?“, fragte ein weiterer.
Ein anderer der Männer trat vor, ein großer, schlanker Man mit roten Haaren, packte das Handgelenk und untersuchte es eingehend. Er ließ es los und sah Merk argwöhnisch an.
„Das ist kein Fuchs, du Idiot“, sagte er zu den Männern. „Das ist ein Wolf. Das ist ein Wolf. Das ist das Zeichen eines Mannes des Königs. Er ist ein Söldner!“
Merks errötete, als er sah, dass alle seine Tätowierung anstarrten. Er wollte nicht entdeckt werden.
Die Diebe starrten es schweigend an, und zum ersten Mal spürte Merk ein Zögern.
„Das sind Killer“, sagte einer und sah ihn an. „Woher hast du das, Junge?“
„Hat er wahrscheinlich selbst gemacht“, antwortete ein anderer. „Macht die Straßen sicherer.“
Der Anführer nickte dem Mann zu, der Merk von hinten festhielt, und er ließ seinen Hals los. Merk atmete erleichtert auf.
Doch dann hielt der Anführer ein Messer an Merks Hals und er fragte sich, ob er heute hier an diesem Ort sterben würde. Er fragte sich, ob das die Strafe für all das Töten war. Doch war er bereit zu sterben?
„Antworte ihm?“, fragte der Anführer. „Hast du das selbst gemacht, Junge? Man sagt, dass man hundert Männer töten muss, bevor man diese Tätowierung bekommt.“
Merk atmete tief durch, und in der langen Stille die folgte, überlegte er, was er sagen sollte. Schließlich seufzte er.
„Tausend“, sagte er.
Der Anführer blinzelte irritiert.
„Was?“, fragte er.
„Tausend Männer, erklärte Merk. „Nicht weniger. Das bringt einem die Tätowierung ein. Und König Tarnis selbst, hat sie mir verliehen.“
Sie starrten ihn schockiert an und die Männer schwiegen. Es war so still, das Merk die Insekten zirpen hören konnte. Er fragte sich, was als nächstes passieren würde.
Einer von ihnen brach in hysterisches Gelächter aus – und die anderen stimmten ein. Sie lachten und brüllten und starrten Merk an – sie mussten es für besonders witzig halten.
„Der war gut, Junge“, sagte einer. „Du bist ein ebenso guter Lügner wie du ein Mönch bist.“
Der Anführer drückte den Dolch gegen seinen Hals, fest genug, um in die Haut einzuschneiden.
„Ich sagte antworte mir!“, wiederholte der Anführer. „Eine richtige Antwort. Oder willst du sterben?“
Merk stand da, spürte den Schmerz und dachte über die Frage nach – er dachte ernsthaft nach. Wollte er sterben. Das war eine gute Frage, und eine tiefergehende Frage, als der Dieb dachte. Und als er darüber nachdachte, erkannte er, dass ein Teil von ihm sterben wollte. Er war müde vom Leben, hundemüde.
Doch je mehr er darüber nachdachte, erkannte Merk schließlich, dass er nicht sterben wollte. Nicht jetzt. Nicht heute. Nicht, wo er sich gerade dazu entschlossen hatte, neu anzufangen. Nicht, wo er gerade anfing, das Leben zu genießen. Er wollte eine Chance auf Veränderung. Er wollte die Chance im Turm zu dienen, ein Wächter zu werden.
„Nein, das will ich nicht“, antwortete Merk.
Schließlich blickte er dem Dieb direkt in die Augen, und seine Entschlossenheit wuchs.
„Und darum“, fuhr er fort, „Gebe ich dir eine Chance, mich gehen zu lassen, bevor ich euch alle töte.“
Sie sahen ihn in stillem Schock an, bevor der Anführer eine Grimasse zog und handelte.
Merk spürte den Druck der Klinge, mit der der Mann ihm den Hals aufschneiden wollte, und etwas in ihm übernahm die Kontrolle. Es war der Krieger in ihm, der Mann, der sein Leben lang trainiert hatte, der es nicht länger ertragen konnte. Er würde seinen Eid brechen – doch es störte ihn nicht mehr.
Der alte Merk kam so schnell zurück, als wäre er nie fort gewesen – und im nächsten Augenblick war er wieder der eiskalte Killer.
Merk konzentrierte sich und sah die Bewegungen seiner Gegner, jedes Zucken, jeden Druckpunkt, jede Verletzlichkeit. Der Drang zu töten überwältigte ihn, wie ein alter Freund, und Merk ließ es zu.
In einer blitzschnellen Bewegung packte Merk das Handgelenk des Anführers, grub seine Finger in einen Druckpunkt, und drehte es bis es brach; dann fing er den fallenden Dolch auf und schlitzte dem Mann den Hals von Ohr zu Ohr auf.
Der Anführer starrte ihn mit einem erstaunten Ausdruck auf dem Gesicht an, bevor er tot zu Boden fiel.
Merk wandte sich den anderen zu, und sie starrten ihn sprachlos mit offenen Mündern an.
Nun war es an Merk zu lächeln, als er sie ansah und sich auf das freute, was gleich kommen würde.
„Manchmal Jungs“, sagte er, „legt man sich einfach mit dem Falschen an.“