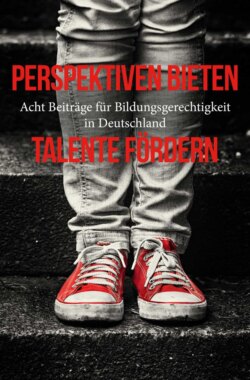Читать книгу Perspektiven bieten - Talente fördern - Moritz Kilger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеThea Link
Alice im Einwanderungsland
Zum ersten Mal gesehen habe ich Alice ganz am Anfang meines Fellow-Einsatzes bei der Fünftklässler-Begrüßungsfeier meiner Hauptschule. Sie sprang mir gleich ins Auge, denn sie trug fast als einziges der Kinder ein Kopftuch, verziert mit kleinen funkelnden Strasssteinen, und ein farbenfrohes, traditionell-pakistanisches Gewand. Auch ich war neu an dieser Schule, die zusammen mit einer angegliederten Grundschule in einem der sozial schwächsten Viertel Mannheims liegt.
Alice war erst seit zwei Jahren in Deutschland. Ihre Familie, aus Pakistan geflohen, lebte in einem Asylbewerberheim. Alice‘ gesprochenes Deutsch war dementsprechend unsicher, und vor allem im Schreiben lag noch einiges vor ihr. Das hielt sie jedoch von nichts ab, ganz im Gegenteil: Alice war ein ausgesprochen aufgewecktes, fröhliches Persönchen mit einem ausgeprägten Mitteilungsdrang, auch wenn sie anfangs mehr mit Händen und Füßen sowie ihrem Lächeln kommunizierte. Doch ihre Deutschkenntnisse nahmen schnell zu.
Sie hatte eine enorme Antriebskraft und einen noch größeren Ehrgeiz: Gab es irgendetwas zu präsentieren oder vorzulesen? Alice war vorne mit dabei. Gab es irgendeine Frage, auf die keiner eine Antwort hatte? Alice meldete sich mit flehendem Blick, piekste dabei mit dem Zeigefinger mehrfach in die Luft und hatte sichtlich Schwierigkeiten, auf ihrem Stuhl sitzen zu bleiben. Eine „Streberin“ war sie dennoch nicht. Dafür quasselte sie viel zu viel und tobte hin und wieder im Schulhaus herum, wenn es ihr zu langweilig wurde. „Oooch Frau Link, ich muss so viel lachen. Meine Augen schwitzen schon“, war einer von Alice’ Kommentaren, bei dem auch ich nicht ernst bleiben konnte.
Ich habe auch noch ihr entsetztes Gesicht vor Augen, als sie keinen Elternbrief für besonders gutes Verhalten erhielt, den ich an Schüler austeilte, die eine bestimmte Anzahl an Sternchen in meinem Unterricht gesammelt hatten. Wie gerne hätte sie ihrer Familie so einen Brief gezeigt.
Alice langweilte sich viel im Unterricht. Nur in Deutsch hatte sie einiges aufzuholen, in allen anderen Fächern lernte sie schnell und mit so viel Biss, dass sie dem Rest der Klasse bald weit voraus war. Insbesondere in Englisch, das sie in ihrem Leben schon öfter gebraucht hatte, war sie maßlos unterfordert. Umso gelegener kam mir die Anfrage einer deutschen Stiftung, ob ich nicht einen talentierten Schüler für ein Stipendium vorschlagen könnte; eine hervorragende Chance für Alice, über den Unterricht hinaus gefördert und gefordert zu werden. Mit der unermüdlichen Unterstützung ihrer Eltern und mit viel Elan und Anstrengung füllte sie seitenweise Antragsformulare aus, legte ihre komplette Einkommens- und Lebenssituation offen, schrieb einen Essay und bat ihre Lehrer um Empfehlungsschreiben. Nicht ohne Hoffnung warf sie den dicken Briefumschlag mit ihren Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten.
Aus dem Stipendium wurde leider nichts – auch aufgrund der unsicheren persönlichen Situation von Alice. Wie erklärt man einer Zwölfjährigen so etwas?
Zum Glück kam mir für Alice noch die Möglichkeit in den Sinn, einen Wechsel auf Mannheims einzige Gesamtschule anzustoßen. Diese Schule ermöglicht es ihren Schülern, je nach Fach unterschiedliche Niveaustufen zu belegen. Für Alice die perfekte Lösung, da sie insgesamt auf einem höheren Niveau lernen könnte, in Deutsch aber ein bisschen mehr Zeit zum Aufholen hätte. Alice war begeistert von dieser Idee. Das Problem war allerdings, dass die Bewerbungsfrist für diese Schule längst abgelaufen war und es zudem eine immens lange Warteliste gab. Die Situation schien aussichtslos und wäre es auch sicherlich gewesen, hätte Alice nicht das große Glück gehabt, einen unermüdlichen Schulleiter zu haben, der sein Herz am rechten Fleck hat. Wie immer, wenn ich ihn ernsthaft um etwas bat, schrieb er sich einen Klebezettel und ich konnte mich darauf verlassen, dass er alles ihm Mögliche dafür tun würde, meinen Fellow-Wünschen nachzukommen.
Kurze Zeit später, es waren mittlerweile schon Sommerferien, hatte Alice das erste Bewerbungsgespräch ihres Lebens: Der Schuleiter der Gesamtschule hatte sich auf persönliches Drängen unseres Schulleiters erweichen lassen, Alice die Chance zu geben, ihren Wunsch persönlich vorzutragen.
„Alice, warum sollte ich gerade dich in unsere Schule aufnehmen?“, fragte ich sie eine Stunde vor ihrem „großen Auftritt“ in gespielt sonorer Schulleiterstimme. Zusammen mit ihrem Vater saßen wir im Foyer der Schule und versuchten sie auf mögliche Fragen vorzubereiten. Mit leicht panischen Augen und sich fest an ihr Einserzeugnis und den Preis der Klassenbesten klammernd, betrat sie daraufhin das Schulleiterbüro. Fast eine Stunde später verabschiedete uns der Schulleiter mit den Worten: „Tja, bei so viel Motivation, so guten Noten und Lehrern, die so fest an dich glauben, kann ich ja gar nicht Nein sagen.“ Ein stolzer Papa, eine erleichterte Fellow und eine glückliche Alice verließen mit einem Handschlag ihre neue Schule.
Seitdem geht Alice auf die Gesamtschule. In allen Fächern besucht sie die A-Kurse, nur in Deutsch ist sie noch im B-Kurs. Gleichzeitig hat sie angefangen, als fünfte Sprache in ihrem Leben – neben Urdu, Hindi, Englisch und Deutsch – Französisch zu lernen, und ist damit auf dem besten Weg, in einigen Jahren das deutsche Abitur abzulegen.
Besonders wichtig für Alice ist, dass sie jetzt auch am Nachmittag in der Schule bleiben kann, da sie nun nicht nur auf eine Gesamt-, sondern auch auf eine Ganztagsschule geht. Für Alice bedeutet diese Möglichkeit, dass sie sich nachmittags nicht mehr im Asylbewerberheim langweilen muss und somit wesentlich mehr Zeit in einer deutschsprachigen Umgebung verbringt.
Als ich sie das letzte Mal besucht habe, hat mir ihre Familie kichernd Fotos von Alice im Skianzug, mit Skibrille, Skihelm und Kopftuch gezeigt, die bei ihrer ersten Klassenfahrt entstanden sind. Kurz vor Ende ihres ersten Jahres auf der Gesamtschule rief sie mich an, um mir stolz zu verkünden, dass sie die beste Deutschnote der gesamten Klasse geschrieben hatte: eine Eins bis Zwei. Ich bin mir nicht sicher, wer sich in diesem Moment mehr gefreut hat.
*
Ende gut, alles gut? In Alice’ Fall sieht es ganz danach aus, vorausgesetzt das Damoklesschwert der Abschiebung saust nicht doch noch auf sie herab, und sie wird nicht in ein pakistanisches Dorf zurück katapultiert. Das wäre eine Katastrophe für sie und ihre Familie. Ärztin möchte Alice werden. Eine, die hier in Deutschland arbeitet und gleichzeitig in Pakistan Krankenhäuser aufbaut. Bis es so weit ist, wird noch viel Wasser den Neckar hinunterlaufen, und vielleicht hat sie bis dahin auch ganz andere Pläne. Aber ich bin mir sicher: Alice wird ihren Weg gehen.
Dennoch bin ich beunruhigt. „Alice im Einwanderungsland“ wäre eine sehr schöne Geschichte, wenn ihr Erfolg nicht von viel zu vielen positiven Zufällen abhängig gewesen wäre. Was, wenn sie nicht an einer der wenigen Schulen mit Teach First Deutschland Fellow geländet wäre? Ohne im Eigenlob schwelgen zu wollen, mein Beitrag zu Alice’ Fortkommen ist eine typische Fellow-Aktion. Wir Fellows haben die Zeit für genau solche Dinge. Wir können dort nachhaken und hartnäckig bleiben, wofür selbst exzellenten Lehrern oft schlichtweg die Zeit fehlt. Was wäre außerdem gewesen, wenn nicht beide involvierten Schulleiter bereit gewesen wären, mehr als nur das Nötige zu tun? Ich bin fest davon überzeugt, dass es sehr auf die Lehrer und die Schulleiter ankommt.
Allerdings nicht nur: Für Alice war es eine wunderbare Lösung, dass es eine Gesamtschule in Mannheim gibt. In dieser Schule werden Kinder wegen der Schwäche in einem Fach nicht gleich komplett in die „unterste Schublade“ gesteckt, denn so wird die Hauptschule von vielen Kindern empfunden. Was, wenn es gar keine Gesamtschule vor Ort gäbe? Und wie wäre diese Geschichte verlaufen, wenn Alice’ Eltern nicht so deutlich bewusst wäre, dass Bildung der Schlüssel zum Aufstieg sein kann? Ein wichtiger Faktor für Alice’ Erfolg ist ihre Familie, die voll und ganz hinter ihrem akademischen Fortkommen steht.
Während meiner zwei Jahre als Fellow habe ich keine Eltern kennengelernt, die nicht das Beste für ihre Kinder wollten. Aber ich hatte Schüler, deren Eltern mehrere Jobs gleichzeitig hatten, um für ihre Familie zu sorgen. Viele Mütter, aber auch Väter, meiner Schüler waren alleinerziehend. Einige waren psychisch krank. Manche wussten nicht, wie sie ihre Kinder fördern können oder welche wichtige Rolle eine gute Bildung spielt. Einigen fehlten schlicht die sprachlichen Fähigkeiten, um sich für das Fortkommen ihrer Kinder einzusetzen. Doch alle diese Eltern haben Kinder, in denen so viel Potenzial steckt, wie in allen anderen Kindern auch.1
Was also können wir tun, wenn wir Bildungserfolge nicht so sehr wie in Alice’ Fall dem Zufall überlassen wollen? Die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken, ist eine Möglichkeit, für die es eine Reihe von Ansätzen gibt. Ich selbst habe dies als Fellow zusammen mit einem internationalen Organisationsteam intensiv versucht. Gemeinsam haben wir ein interkulturelles Elterncafé zu unterschiedlichen Bildungs- und Erziehungsthemen organisiert; semi-erfolgreich würde ich sagen. Elternarbeit ist unglaublich schwer, war meine Erfahrung dabei. Nichtsdestotrotz ist sie ein unverzichtbarer Baustein.
Gleichzeitig sollte man das Schulsystem insgesamt elternunabhängiger gestalten. Schon öfter habe ich den Satz gehört: „Wir sind nun einmal eine Leistungsgesellschaft.“ Mit dieser Aussage kann ich leben, wenn dann konsequenterweise auch wirklich die Leistung der Kinder zählt und nicht die der Eltern zu Hause. Erfolg in der Schule muss möglich sein, auch wenn die Eltern am Abend nicht die Hausaufgaben kontrollieren oder das Plakat für die Präsentation am nächsten Tag kleben. Würden von solch einem elternunabhängigeren Schulsystem nicht auch jene Eltern profitieren, die zwar die Kompetenzen haben, aber Vollzeit berufstätig sein wollen? Ich denke, dass man einiges in diese Richtung erreichen könnte, ohne dass das komplette Schulsystem reformiert werden muss.
Für unabdingbar halte ich jedoch Ganztagsschulen, welche die Kinder nicht nur verwahren, sondern ganzheitlich fördern. Ich kann nicht begreifen, warum meine Einsatzschule trotz eines sehr schwierigen Umfelds und trotz mehrfacher Ganztagesbeantragung bis heute ihre Schülerschaft in der Regel um 13:10 Uhr ihrem Schicksal überlassen muss.
Um sich auf Bildungserfolge, speziell auch von neu eingewanderten Kindern, zu fokussieren, bedarf es insbesondere im Bereich der Sprachförderung einer deutlichen Verbesserung. Spätestens seit den fünfziger Jahren kann man Deutschland als Einwandererland bezeichnen. Mittlerweile ist das auch auf der politischen Agenda angekommen. Dennoch gibt es gerade bei der Sprachförderung große konzeptuelle Lücken. In vielen Bundesländern werden zumindest im Kindergarten Sprachstandserhebungen durchgeführt. Wie sollen allerdings Teenager, die neu nach Deutschland kommen, möglichst schnell Deutsch lernen? Hierfür habe ich keinerlei Strategie in meinem schulischen Umfeld entdecken können. Dabei wurde fast wöchentlich ein neuer Schüler an unserer Schule angemeldet, der kein Wort Deutsch sprechen konnte. Zwar gab es ab meinem zweiten Einsatzjahr an der Schule sogenannte Vorbereitungsklassen für Schüler ohne jegliche Sprachkenntnisse. Allerdings waren die hierfür „abkommandierten“ Lehrer überhaupt nicht für diese Herausforderung qualifiziert und zumeist maßlos überfordert. In diesen Klassen saßen Schüler, mit denen ich mich zwar nicht auf Deutsch, dafür aber in geschliffenem Englisch unterhalten konnte. Und es gab Schüler, die wahrscheinlich noch nie richtig zur Schule gegangen sind und mich an Wildkatzen erinnerten, die man in viel zu enge Stadtwohnungen sperrte. Hier wäre es sehr sinnvoll, wenn auch weiterführende Schulen besser unterstützt würden, um dieser immensen Herausforderung zu begegnen. Es gibt viele weitere Maßnahmen, die dazu beitragen können, Bildungserfolge weniger dem Zufall zu überlassen. Bei Kindern, die ganz neu nach Deutschland kommen, sehe ich den dringendsten Handlungsbedarf.
Manchmal, wenn mir in der Schule die vielen Bildungsbaustellen über den Kopf zu wachsen drohten, versuchte ich meine Schule mit Alice’ Augen zu sehen. So sehr Alice oft unterfordert war, so sehr hat sie diese Schule geliebt und war begeistert von ihrer Klassenlehrerin und von den Schulausflügen, die wir hin und wieder unternahmen. Sie musste nicht wie in Pakistan mit fünfzig anderen Kindern auf dem Boden sitzen und wurde auch nicht geschlagen, wenn sie das Schulgeld nicht mitbringen konnte. Ja, das deutsche Bildungssystem ist gut. Vieles funktioniert wunderbar und ich möchte die Situation nicht überdramatisieren. Doch ich weiß: Wir können das noch viel besser! Zwischen Alice’ früherer Schule in Pakistan und ihrer Schule in Mannheim liegen Welten. Aber zwischen den Chancen, die Schüler meiner Einsatzschule haben und den Chancen, die sich zum Beispiel mir boten, liegen ebenfalls Welten. Es ist für niemanden gut, wenn die Welten zwischen den Menschen unserer Gesellschaft zu weit auseinander liegen und nur der Zufall entscheidet, wo sie landen. Hoffentlich werden sich in Zukunft noch viel mehr Menschen dafür einsetzen, dass auch andere Kinder Alice’ Traum teilen können, im Einwanderungsland Deutschland zu arbeiten und zum Beispiel in Bulgarien oder in Syrien Schulen oder Krankenhäuser zu bauen.
Wenn es die Eltern nicht können, dann sollten die Schulen in der Lage sein, ihnen zu helfen, diesen oder andere Träume zu entwickeln. Dann sollten die Schulen ihnen ehrliche Chancen bieten können, ihre Träume auch Wirklichkeit werden zu lassen. Mit ehrlichen Chancen meine ich, dass tatsächlich die individuelle Leistung zählt und jedes Kind, unabhängig vom Elternhaus, die Unterstützung bekommt, die es braucht, um erfolgreich zu sein. Das Potenzial ist da, und jeden Tag kommt weiteres dazu. Lasst es uns nicht dem Zufall überlassen, was aus diesem Potenzial zukünftig wird.
1 Wechselten laut Mannheimer Bildungsbericht 2011 insgesamt 41,9 Prozent aller Mannheimer Grundschüler auf ein Gymnasium, so waren es an der Grundschule, die meiner Schule angegliedert ist, lediglich 5,6 Prozent. Gleichzeitig ergab eine Studie der Universität Mannheim, dass die Verteilung der kognitiven Leistungsfähigkeit aller Erstklässler dieser Schule einer Normalverteilung entspricht. Die hohe Übergangsquote auf die Hauptschule, so wird im Bildungsbericht geschlussfolgert, muss also überwiegend andere Ursachen haben.