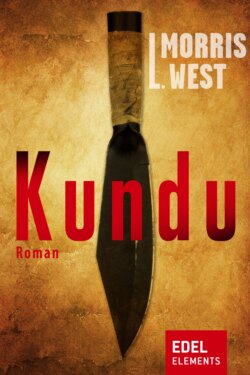Читать книгу Kundu - Morris L. West - Страница 3
Kapitel 1
ОглавлениеEs war vier Uhr nachmittags. Die Sonne versank über dem grünen Tal gen Westen, und erste Wolkenstreifen zogen über die nördliche Gebirgskette, deren Gipfel sich kobaltblau vom pfirsichfarbenen Hintergrund des Himmels abhoben.
Es war Spätsommer in Capricorn. Unten an der Küste, in Lae, Madang und Wewak, verwünschten die Menschen die Schwüle und sehnten die kühlen Nachtwinde herbei, doch hier oben in den Tälern des Hochlandes, fünftausend Fuß über dem Meeresspiegel, war die Zeit der größten Hitze vorbei. Nach Einbruch der Dunkelheit spürte man den Temperaturrückgang mit aller Deutlichkeit. Kurt Sonderfeld stand auf der breiten Veranda seines mit Palmenblättern gedeckten und von Bambusstauden umrahmten Bungalows und blickte über das Tal, wo unter Reihen schattenspendender Bäume der junge Kaffee wuchs; er schaute hinüber zu den Hütten des Chimbu-Dorfes und zur Prozessionsstraße, die zum Tanzplatz führte.
Obgleich man es ihm kaum angesehen hätte, war er ruhelos. Die Fähigkeit, sich innerlich zu sammeln, dazu die lang und mühsam eingeübte Selbstkontrolle boten Schutz vor Hinterhalt und menschlicher Enttäuschung.
Doch selbst wenn man diese Ruhelosigkeit vermutet hätte, so wäre es doch schwergefallen, den Grund dafür zu nennen. Er war mit einer Frau verheiratet, deren slawische Schönheit von Madang bis Mount Hagen schon Legende war; seine Kaffeepflanzung war in gutem Zustand, seine Vergangenheit war sorgfältig begraben, und selbst mit den Behörden stand er auf gutem Fuß. Er herrschte in diesem Tal wie ein kleiner Landesfürst – fünfzig Meilen entfernt vom Sitz und Zugriff des Distriktverwalters in Goroka.
Und dennoch war er ruhelos, selbst seine sonst so ausgezeichnete Zigarre schmeckte bitter. Auch fand er diesmal keine Freude am Anblick grüner Wiesen vor dem Bungalow, am weiten Panorama bis zum Fuß der lilaroten Berge, deren Menschen ihm, wie kaum einem Weißen, in ehrfurchtsvoller Dienstbarkeit ergeben waren. Gerade heute abend brauchte er dringend Ruhe; gerade heute aber würde man sie ihm verwehren. Schon für die nächste Stunde waren Gäste angesagt; sie würden hier vor seinem Hause sitzen, seinen Whisky trinken und seine Speisen zu sich nehmen und dann mit jenem Temperament und Redefluß bis in die tiefe Nacht Gespräche führen, wie es für einsame Menschen typisch ist; und währenddessen würden Kundu-Trommeln dröhnen, und der Singsang aus dem Dorf würde mit dem Wind herübertreiben.
Zum Teufel, sollen sie doch kommen!
Er schnippte die Zigarre weg und sah zu, wie sie auf der dunklen Erde langsam weiterglühte.
Er war groß, kompakt und breitschultrig und hielt sich gerade wie ein Baum. Die hohe Stirn wölbte sich gleich einer Kuppel bis zum rötlichen, kurz gestutzten Haaransatz. Vom Ohr bis an die Kerbe seines grob geformten Kinnes lief am Kiefer entlang die braune Linie einer Narbe. Die Lippen seines Mundes erinnerten an eine zugeschnappte Mausefalle.
Eine ganze Weile stand er so, während seine Hand über das glänzende Bambusgeländer strich, als wollte er sein aufgewühltes Inneres besänftigen. Mit einem Mal entspannte sich der Mund. Er verließ die Veranda und ging über einen Kiesweg auf eine kleine Bambushütte zu, die direkt am Rand der Pflanzung lag.
Es war sein Laboratorium – kompakt und rationell, genau wie er selbst. Hier war er nicht länger Kurt Sonderfeld, ein Emigrant aus Not, ein Arzt durch Gunst und Gnade, ein Pächter unter der hiesigen Treuhandverwaltung, sondern der alte Kurt Sonderfeld, Doktor der Medizin, Freiburg/Bonn, Berater der Malariakontrollkommission, Mitarbeiter verschiedener Fachorgane und Mitglied wissenschaftlicher Gremien in Europa und den Vereinigten Staaten. Er grinste verbissen, als vertraute Erinnerungen in ihm aufstiegen. Für viele seiner Kollegen war ihre Vergangenheit ein Handicap gewesen – nicht für ihn. Er hatte es verstanden, die eigene zwielichtige Geschichte zu seinem Vorteil zu nutzen.
Er stieß die Tür zur Hütte auf und trat ein.
An einer langen Arbeitsfläche unter dem Fenster saß ein Mädchen über ein Mikroskop gebeugt, mit einem Stapel Notizen daneben. Als sie Sonderfeld gewahr wurde, blickte sie auf und verzog den Mund zu einem breiten Lächeln.
Sie hatte die breite Nase und die vollen, aufgeworfenen Lippen der Bergstämme. Ihre Haut war braun wie Waldhonig, und das Haar umschloß ihren Schädel in einer dichten Krause. Trotz allem war sie schön – schön in ihrer Jugend und Gesundheit. Die Haut besaß einen eigentümlich warmen Glanz, und unter dem knallrosa bedruckten Kleid zeichneten sich ihre runden, festen Brüste ab. Sonderfeld beugte sich über sie und grinste anerkennend.
»Wie steht’s? Was hast du gefunden, N’Daria?«
Seine Stimme hatte einen tiefen, sonoren Klang, und nur bei genauerem Hinhören konnte man den typischen Zungenschlag des Kontinentaleuropäers erkennen.
Sie antwortete in einem rauhen, aber korrekten Missionsenglisch. »Das sind die Eier aus dem unteren Tümpel.«
»Und?«
»Anopheles.«
Sonderfeld nickte.
»Wie ich vermutet habe.«
»Dann haben wir also jetzt das Fieber hier im Tal?«
»Noch nicht. Aber wenn die Jungs von der Küste wiederkommen, werden sie es einschleppen. Diese Burschen…« – Er klopfte an das Mikroskop – »… diese Burschen hier werden den gesamten Stamm anstecken.«
Das Mädchen schwieg und schaute ihn mit großen Augen an. Dabei hielt sie den Mund leicht geöffnet und den Kopf zurückgebeugt, so daß die Mulde ihres Halsansatzes sowie die sanfte Wölbung ihrer Brust in sein Blickfeld traten.
Sonderfeld musterte sie mit einer Mischung aus Befriedigung und Heiterkeit. Dieses Mädchen war seine eigene Schöpfung. Geduldig und Schritt für Schritt hatte er sie zu dem gemacht, was sie war, vergleichbar einem Instrument, wo jeder Ablauf, jede einzelne Funktion genauestens kalkuliert und so präzise auf die übrigen abgestimmt war, daß man mit mathematischer Schlüssigkeit sagen konnte: »Das stammt von mir; benutze es so und so… und es wird so und so reagieren.«
Sie war als Haushaltshilfe für Gerda aus der Missionsschule von Pater Louis gekommen, doch die dortige Erziehung glich bei N’Daria eher einem dünnen Anstrich, der abblätterte, noch bevor er gänzlich trocknen konnte. Darunter kam das ursprüngliche Eingeborenenwesen mit seinen uralten Ängsten, seinem Aberglauben und mit seinen zügellosen Leidenschaften zum Vorschein. Er aber hatte sie gezähmt – mit Strenge, Raffinesse und ungewöhnlichem Feingefühl; und während dieser Zeit gelang es ihm, sie so weit auszubilden, daß sie schließlich ebenso gewissenhaft und exakt arbeiten konnte wie er selber.
Nun war dieses sein Geschöpf vollendet, doch lagen ganze Zeitalter zwischen ihrer jetzigen Labortätigkeit und jener Aufgabe, die er ihr zugedacht hatte.
Noch immer grinsend, legte er seine Fingerkuppe an ihren Hals und drückte leicht in die Mulde hinter dem Ohr. Sie erbebte unter seiner Berührung, zuckte aber nicht zurück. Langsam und bedächtig glitt der Finger herunter über ihre Kehle und hinterließ eine feine weiße Nagelspur auf dunkler Haut. Sie zitterte erregt; Speichel bildete sich an ihren Mundwinkeln und teilte sich auf den dunklen Lippen; in ihren Augen tanzten Farbtupfer und spiegelten plötzlich hochkommende Begierde.
»Macht es dir was aus?« fragte Sonderfeld mit weicher Stimme. »Macht es dir was aus, wenn das ganze Dorf am Fieber stirbt?« Ihre Antwort war ein kehlig-heiseres Flüstern.
»Nein.«
»Macht es dir was aus, wenn Kumo stirbt?«
»Nein.«
»Sehr gut.«
Er zog die Hand zurück und beugte sich nach vorn, als wollte er die anfängliche Berührung wiederholen. Ihr ganzer Leib war Zeichen ungehemmter Leidenschaft.
Sonderfeld grinste und schüttelte den Kopf.
»Nicht jetzt, N’Daria.«
»Morgen?«
»Vielleicht…, wenn du heute abend deine Sache gut machst. Zieh dich jetzt um; dann komm und zeig dich mir!«
Folgsam, aber deutlich unbefriedigt, stand sie auf und ging zur Tür am Ende der Hütte. Sonderfeld verfolgte sie mit seinem Blick, und als sich hinter ihr die Türe schloß, lachte er in sich hinein und beugte sich über das Mikroskop.
Die winzigen Moskitolarven wirkten riesig groß. Ja, N’Daria hatte recht, es waren Anopheles, Überträger der Malaria. Jetzt, wo das Tal für den Verkehr aus Goroka und von der Küste zugänglich war, würde die Krankheit auch hier in Kürze Fuß fassen – eingeschleppt von Trägern, die die Berge überquerten, jungen Polizeihilfskräften und Patrouillenoffizieren, aber auch von Fachleuten aus dem Landwirtschaftsministerium. Die Malaria würde Einzug halten in den Dörfern dieser Berge und den Kindern Krankheit und Tod bringen. Jenen aber, die überlebten, würde ihre Milz zur Größe einer Ananas anschwellen, genau wie bei den erbärmlichen Vogelscheuchen am Sepik-Delta – falls Sonderfeld nichts unternähme.
Er aber war dazu entschlossen; schon deshalb, weil sein Naturell und auch sein Plan auf Ordnung ausgerichtet waren. Krankheit aber bedeutete Unordnung, die seinem ganzen Wesen widersprach, und die er – morgen schon – auszutilgen gedachte.
Heute abend gab es anderes zu tun; heute würden die Kundu-Trommeln – falls N’Daria ihre Rolle richtig spielte – das »Lied des Siegers« künden und der Singsang würde als Triumphgeschrei gen Himmel steigen. Geraume Zeit saß er so in Gedanken versunken, als plötzlich die Tür knarrte und er sich ruckartig umdrehte. N’Daria stand vor ihm.
Ein Tierfell schlang sich um die Hüften, und ein Lendenschurz aus Grasgeflecht bedeckte ihre Scham. Vom Nabel bis zum Zwerchfell reichte ein Gürtel aus geflochtenen Rohrfasern. Zwischen ihren unbedeckten Brüsten hingen rote und blaue Perlenschnüre. In der Scheidewand ihrer Nase steckte ein geschwungener Perlmuttsplitter, und eine Kappe aus schillernden Käferflügeln bedeckte die wilde Haarpracht, gekrönt von den tiefroten Federn des Paradiesvogels. Palmenöl ließ die nackte Haut verführerisch glänzen…
Sonderfeld betrachtete sie mit sichtlichem Wohlgefallen und spürte dabei ein vertrautes, gefährliches Stechen in der Lendengegend. Voll Zorn kämpfte er dagegen an. Er konnte sie nehmen, wann immer er wollte – aber nicht heute abend! Er sah ihr wissendes Lächeln und schalt sich einen verdammten Narren.
»Komm her, N’Daria!«
Mit schwingenden Hüften trat sie näher. Den Kopf demütig gesenkt, verharrte sie schweigend, während Geruch und Hitze ihres gespannten Leibes seine Nasenflügel erzittern ließen.
Vielleicht nahm der Boß sie gleich hier und jetzt – doch abermals wurde sie enttäuscht.
Flehend hob sie den Blick, er aber lachte und genoß die Zeichen unerfüllten Verlangens.
»Morgen, N’Daria, morgen. Nun zeig es mir!«
Ihre Finger glitten unter den breiten Gürtel und zogen einen kleinen Baumwollbausch hervor.
»Sehr gut. Steck’s wieder weg!«
Sie tat, was er forderte, und erwartete unterwürfig seine nächsten Befehle.
»Erzähl mir, was du tun sollst!«
»Heute nacht werde ich dir diesen…«
»Nein, von Anfang an!«
Sie holte tief Luft und begann von neuem, wobei ihre heisere Stimme die Anweisungen Stück für Stück in der fremden Sprache auftischte.
»Heute nacht machen die Unvermählten des Dorfes Kunande. Wir sitzen zusammen, singen und reiben die Gesichter aneinander. Auch Kumo wird da sein, und wir werden gemeinsam Kunande machen. Dann werden wir zur Hütte meiner Schwester gehen. Wir werden essen und trinken, und schließlich werden wir uns zurückziehen. Er wird mit mir spielen und ich mit ihm. Wenn er dann voller Begierde ist, werden wir in den Busch gehen, und er wird mich nehmen.«
»Bist du ganz sicher, daß es klappen wird?«
Voller Stolz hob sie ihr gefiedertes Haupt.
»Ich bin ganz sicher. Kumo begehrt mich. Ich habe ihm schon immer gefallen.«
»Achte darauf, daß er heute nacht Gefallen an dir findet. Was geschieht dann?«
»Wenn er mich nimmt…«, fuhr N’Daria geradezu genußreich fort, »… wenn er mich nimmt, bleibt sein Speichel auf meinem Mund; auch werde ich ihm Blut aus Brust und Schulter nehmen… Anschließend wird er mich verlassen.«
»Und wenn er dich verläßt? Was dann?«
»Ich werde zu dir zurückkommen und Kumos Speichel, Blut und Samen bei mir tragen – und du wirst sein Leben in deiner Hand haben.«
»So ist es!« sagte er mit einem langen Seufzer der Entspannung. Seine Unruhe schwand, und ein Gefühl wachsender Macht schwoll wellenartig in ihm an. Er legte seine Hand auf ihre braune Schulter und streichelte sie zärtlich.
»Was du heute nacht für mich tust, N’Daria, das tust du auch für dich. Vergiß das nie!«
»Ich werde es nicht vergessen. Und morgen…?«
Er lächelte und strich mit seinen Fingerspitzen über ihre Brust. »Erst morgen, N’Daria – wie versprochen. Jetzt geh!«
Sie war schon auf halbem Weg zur Tür, als er sie zurückrief. »Wenn du heute nacht zurückkehrst, werde ich mit einigen Gästen im Haus sein. Mach die Laterne an und häng sie ans Fenster! Wenn es klappt, werde ich noch zu dir kommen.«
Er begleitete sie zur Tür und beobachtete, wie sie den Weg zum Dorf hinabschritt. Sie gleicht einem Vogel, dachte er, einem kleinen bunten Vogel, der mit rotem Gefieder unter dicht belaubten Bäumen flattert.
Er schloß die Tür des Laboratoriums und ging zielstrebig zum Haus zurück.
Auf der Veranda waren die Klappstühle bereitgestellt, und Gläser, Eiskübel und Krüge mit gekühltem Regenwasser standen auf dem Rohrtisch. Wee Georgie war gerade damit beschäftigt, umsichtig eine neue Flasche Scotch zu öffnen.
Er hob den Blick, als Sonderfeld die Stufen heraufkam. Sein aufgeschwemmtes Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen und ließ zwei Reihen schlechter Zähne mit mehreren häßlichen Lücken sichtbar werden. Seine Stimme war ein piepsiges Cockney und stand in deutlichem Mißverhältnis zu seiner Körperfülle.
»Halbe Minute, Boß, und alles ist fertig für die Party. Wollen Sie ’nen Schluck für den Anfang?«
»Gleich.«
Sonderfeld musterte ihn voller Überdruß und Ekel. Wee Georgie gehörte zu seinen weniger gelungenen Projekten. Er war einen Kopf kürzer als Sonderfeld, doch sein gedrungener Körper wirkte monströs. Sein arg zerzauster Kopf saß auf einem wulstigen Doppelkinn, die Brust hing wie bei einer Frau herunter, und den tonnengleichen Bauch konnte selbst sein weites Hemd kaum bedecken. Unten um den Bauch rutschte ihm der Hosenbund herum wie eine Schnur um einen Gummiball. Die krummen Beine waren übersät mit blauen Venenknoten und häßlich verfärbten Narben. Die unförmigen Füße steckten in einfachen Leinenschuhen, die zwecks größerer Bequemlichkeit seitlich aufgeschnitten waren. Wenn er lachte, was nicht selten vorkam, wabbelte er wie Gelee, und seine Augen verschwanden hinter den dicken Falten seines stark geröteten Gesichts. Wenn er sich bewegte, was so selten wie möglich vorkam, keuchte er wie eine alte Dampfmaschine.
»Zum Teufel, Mann, wieso hast du deine Haare nicht in Ordnung gebracht?« stieß Sonderfeld hervor.
»Hab’s versucht, Boß. Sie können mich totschlagen, aber ich hab’s versucht. Meine Kleine hat’s auch versucht, aber es bleibt nicht. Nur wenn ich’s mit Öl einreibe. Aber Sie hassen es ja, wenn ich beim Servieren wie ein Schwein stinke – oder? Das Hemd is’ sauber, auch die Hosen – nich’?«
»Ich meine, wir sollten für das wenige schon dankbar sein. Mach mir einen Drink – aber einen starken!«
Er setzte sich in den nächsten Stuhl und beobachtete Wee Georgie mit zynischem Vergnügen. Beide Hände des Burschen zitterten, und Speichel trat auf seine Lippen, als der Schnapsgeruch in seine Nase stieg. Es gehörte zu Sonderfelds kleinen Freuden, sich auszurechnen, wie lang es wohl dauern würde, bis Georgie ihn um einen Drink anbettelte.
Wee Georgie war ein Überbleibsel aus der Vorgeschichte des Landes, und seine Herkunft lag im Dunkel der Legende. Er hatte sich als Matrose auf Kopf-Schiffen, als Anwerber für Soldaten, als Goldschürfer, Zuhälter und in allerlei anderen Metiers versucht, bis dann die Japaner zum Glück alle Unterlagen vernichteten. Sonderfeld hatte ihn am Strand von Lae aufgegabelt, seinen Tripper kuriert, ihn von Nierensteinen und einer Reihe kleinerer Leiden befreit, und brachte ihn dann als Vorarbeiter und Kontaktmann zu den Eingeborenen ins Tal. Wee Georgie hatte sich daraufhin zwei Dorfschönheiten zugelegt und sich häuslich eingerichtet, während Sonderfeld ziemlich sicher war, daß er innerhalb von zwölf Monaten an Leberzirrhose sterben würde.
Doch wie durch ein Wunder überlebte er und hatte Sonderfeld inzwischen manch wertvollen Dienst erwiesen. Er war ein von Grund auf liederlicher Bursche, der sich als Kanake fühlte und keinerlei Skrupel besaß. Bei entsprechender Anleitung und einer angemessenen Ration Schnaps war er ein durchaus brauchbares Werkzeug für die Ziele und Pläne seines Meisters.
»Ihr Drink, Boß.«
»Danke.«
»Mh… äh… wie steht’s mit einem kleinen meinerseits… he…, Boß?«
Sonderfeld grinste und schaute auf seine Uhr.
»Dreißig Sekunden! Nicht schlecht, Freundchen. Du kannst dir einen nehmen.«
»Danke, Boß… Danke!«
Er schnaufte, gluckste und schlurfte zum Tisch, um sich einen steifen Longdrink zu mixen.
»Auf daß Sie reich und glücklich werden, Boß!«
»Prost!« erwiderte Sonderfeld geistesabwesend. Wee Georgie kippte sein Getränk in einem Zug hinunter. Sein Meister hingegen trank langsam und genüßlich und fühlte, wie sich die Wärme gleich warmen Kohlen im Leib sammelte. Trinken war für Sonderfeld ein fürstlicher Genuß, den er ganz bewußt und kontrolliert zu zelebrieren verstand.
»Lansing is’ schon da, Boß.«
»Für dich noch immer ›Mr. Lansing‹, Georgie!«
»Dann eben Mr. Lansing. Er kam vor ungefähr einer halben Stunde.«
»Wo ist er jetzt?«
Sein Tonfall zeigte einstudierte Gleichgültigkeit, doch in Georgies Äuglein glitzerte boshafte Schadenfreude.
»Irgendwo dahinten. Schaut sich mit Mrs. Sonderfeld die Blumen an.«
»Der arme Kerl hat kaum ein Vergnügen«, bemerkte Sonderfeld mit sanfter Stimme. »Da sollte man ihm ruhig dieses eine gönnen – oder nicht?«
Wee Georgie spuckte verächtlich über das Geländer.
»Kaum Vergnügen, stimmt genau! Was tut er bloß da im Dorf? Lebt wie ein Kanake; ißt ihre Nahrung; sitzt an ihren Feuerstellen; rührt nicht mal die Mädchen an. Wozu das alles?«
»Er ist Anthropologe.«
»Weiß ich doch. Aber was tut er bloß?«
Sonderfeld starrte unbeweglich in sein Glas und erklärte mit samtener Stimme: »Er studiert, Georgie. Er studiert die Sprache, die Religion, die Sitten und Gebräuche, und nicht zuletzt die Heiratsriten der Eingeborenen. Er wird von einer amerikanischen Stiftung bezahlt, die derartige Forschungsprojekte finanziert.«
»Bezahlt? Für was, zum Teufel? Ich könnte denen doppelt soviel erzählen wie Lansing – und zum halben Preis!«
»Ich weiß, ich weiß«, entgegnete Sonderfeld sanft, »aber Lansing bedient sich dabei keiner Schimpfworte.«
»Sie sind ziemlich sauer auf Lansing, stimmt’s, Boß?« Der Whisky traf ihn voll ins Gesicht. Er keuchte, winselte und rieb sich verdutzt die Augen. Sonderfeld riß ihn an den Haaren hoch und schlug ihn direkt auf den Mund. Dann schalt er ihn wie ein unartiges Kind, sanft und ohne Zorn.
»Vergiß nicht, Georgie, daß du ein Diener in meinem Haus bist. Du wirst meine Gäste zuvorkommend behandeln und dich ansonsten um deine eigenen Angelegenheiten scheren. Denk immer daran, daß du nichts als ein Stück Dreck bist und allein dank meiner Gunst und meines Könnens lebst. Du wirst heute abend keinen Drink mehr bekommen. Mach dich sauber und gieß mir einen neuen Whisky ein! Pater Louis kann jeden Moment kommen.« Georgie verzog sich wie ein geschlagenes Tier. Sonderfeld hingegen wischte sich die Hände an einem seidenen Taschentuch ab und wartete ruhig auf die Ankunft seines zweiten Gastes. Der kleine Priester kam mit rudernden Armen und wippendem Bart den Weg herauf. Über der Schulter hing eine kleine Segeltuchtasche, die rhythmisch gegen seinen Körper schlug, während Ströme von Schweiß über sein runzeliges Walnußgesicht rannen. Er gleicht einer Ziege, dachte Sonderfeld, einer weisen, uralten Ziege mit grauem Bart und klugen Augen. Und doch brachte Sonderfeld unter all den Menschen, die zu ihm kamen, dem Pater am meisten Respekt entgegen. Er mußte schon weit über sechzig sein, besaß aber die knorrige Zähigkeit eines alten Baumes. Mehr als dreißig Jahre seines Lebens hatte er in den Bergen von Papua und Neuguinea verbracht. Er lebte schon hier, bevor die ersten Geologen das südliche Tal betraten, um nach Bodenschätzen zu suchen; und als man im Hochland frische Arbeitskräfte rekrutieren wollte, war er es, der acht gab, daß die Eingeborenenmädchen unbehelligt blieben.
Die langen Jahre hatten nicht vermocht, seinen spröden Bauernhumor zu brechen, und trotz lebenslanger Isolation machte er auf Sonderfeld den Eindruck eines in jeder Hinsicht fortschrittlich denkenden Europäers. Als sie zum ersten Mal aufeinandertrafen, unterhielten sie sich anfangs auf französisch, dann auf deutsch. Sie sprachen über Medizin, Politik, Philosophie und Moral, und als sie sich schließlich trennten, hatte Sonderfeld das unbehagliche Gefühl, als habe ihn der kleine Mann von allen Seiten abgeklopft wie ein Böttcher ein hohles Faß.
Wenn er überhaupt einen Menschen fürchtete – auch wenn er dies nicht einmal sich selbst eingestanden hätte – so war es dieser kleine Priester. Deshalb behandelte er ihn auch mit wacher Vorsicht und freundlicher Zuvorkommenheit, ganz als Kollegen im Exil der Wildnis.
»Bitte setzen Sie sich, Pater, und ruhen Sie sich aus! Georgie wird Ihnen einen Drink machen. Meine Frau muß auch gleich hier sein. Sie zeigt unserem Freund Lansing gerade den Garten.«
»Ist die Dame des Hauses wohlauf?«
»Ja danke, es geht ihr ausgezeichnet. Das Klima hier oben ist angenehmer für Frauen als das an der Küste.«
»Ist sie noch immer glücklich und zufrieden in unserem Tal?« Sonderfeld warf ihm einen kurzen Blick zu, konnte aber in seinen klaren Augen nichts Verdächtiges entdecken. Er lächelte und zuckte die Achseln.
»Falls sie unglücklich ist, so hat sie es mir bisher nicht gesagt.«
»Gut, gut. Ich habe ihr eine Orchidee mitgebracht – eine von den großen goldfarbenen. Meine Jungs fanden sie heute nachmittag in der Schlucht.«
Er griff in seine Tasche, zog die Pflanze hervor und legte sie behutsam auf den Tisch. Der lange, dicke Stengel trug mehrere Knospen und eine voll aufgegangene Blüte; die Wurzeln steckten voller Klumpen schwarzer Erde in einem weichen Stück Rinde. Sonderfeld lächelte anerkennend.
»Vielen Dank. Gerda wird sich freuen. Sie wünscht sich schon lange so ein Exemplar.«
»Hier is’ Ihr Drink, Pater.« Georgie schlurfte heran und stellte das Glas auf den Tisch. Seine Hand zitterte, so daß einige Tropfen auf die Tischplatte spritzten. Sonderfeld runzelte die Stirn, schwieg aber. Pater Louis schaute auf und lächelte verständnisvoll.
»Du hast wieder deinen Tatterich, Georgie.«
Ein verdrießliches Schnaufen war die Antwort.
»Passiert mir immer, wenn ich auf dem Trockenen sitze, Pater. Is’ doch einleuchtend, oder nich’? Bin schließlich nur ein Mensch aus Fleisch und Blut.«
»Probier mal dies hier, Georgie! Ist verträglicher für die Leber als das einheimische Gebräu.«
Die Augen des fetten Burschen leuchteten, als ihm der kleine Priester eine Flasche Meßwein reichte. Hastig griff er danach und stopfte sie mit einem triumphierenden Seitenblick auf Sonderfeld in seine zerschlissene Hosentasche.
»Das nenn’ ich echt christliche Nächstenliebe, Pater. Wenn’s jemand gäbe, der mich in meinem Alter noch dazu bringen könnte, Kirchenlieder zu singen – und so jemand gibt’s nich’ – aber wenn, dann wären Sie’s!«
Pater Louis kicherte leise und verscheuchte ihn mit einer kurzen Handbewegung; dann hob er sein Glas.
»Santé, mon ami!«
»À la vôtre, mon père!«
Genüßlich leerten sie ihre Gläser: zwei Emigranten, zwölftausend Meilen von der Heimat entfernt. Sonderfeld bot ihm eine Zigarre an. Der kleine Priester lehnte dankend ab und zog grinsend eine kurze Pfeife mit einem Beutel gewöhnlichen Tabak hervor.
»Ihre Zigarre wäre reine Verschwendung. Schon zu lange rauche ich dieses einfache Kraut hier, um einen guten Tabak überhaupt schmecken zu können.«
Nachdem er seine Pfeife entzündet hatte, sog er heftig, damit das süßliche Kraut nicht ausging. Als sich schließlich die nötige Glut entwickelt hatte, sagte er beiläufig: »Die Stämme wandern noch immer ins Lahgi-Tal.«
»Ich weiß«, entgegnete Sonderfeld mit gleichgültiger Stimme, hinter der sich sein drängendes Interesse zu verbergen suchte. »Das Übliche. Sie treffen sich zum Schweinefest.«
Das Lahgi-Tal war eigentlich ein großer bewaldeter Krater im nördlichen Gebirgszug. Dort lag das Hauptdorf, von dem aus einzelne Eingeborenengruppen aufgebrochen waren, um neue Anbauflächen in den umliegenden Bergen zu suchen und neue Siedlungen zu gründen. Alle drei Jahre kehrten sie in ihr altes Heimatdorf zurück, um gemeinsam das große Schweinefest zu feiern. Ihr Aufbruch glich einer Art Völkerwanderung, die sich über Wochen erstrecken konnte. Nach Beendigung des Festes kehrten sie stets in ihre Dörfer zu ihrem Alltag zurück. Sonderfelds eigene Leute hatten sich jedoch noch nicht gerührt. Bevor es soweit kam, mußte er alle Vorbereitungen für seinen Plan getroffen haben, oder sein Projekt würde ihm platzen. Pater Louis kaute an seiner Pfeife und fuhr fort:
»Ja, das Übliche, wie Sie schon sagten. Nur ist es diesmal anders – unruhiger als sonst.«
Jetzt, dachte Sonderfeld, jetzt gleich wird er auf den eigentlichen Kern der Sache zu sprechen kommen! Höflich und vorsichtig tastete er sich vor; die Dringlichkeit seiner Anteilnahme verbarg er hinter einem toleranten Philosophenlächeln.
»Es steckt noch immer die alte Unruhe in den Eingeborenenstämmen. Sie gleichen rastlosen Kindern. In alten Zeiten tobte sich diese Unruhe in Beutezügen und Kriegen mit den Nachbarstämmen aus, heute aber unterliegen sie einer strengen Kontrolle. Die Verwaltung mißbilligt jede Art ritueller Tötung.« Ironisch zuckte er die Achseln. »Machen Sie sich keine Sorgen, Pater. Sie werden sich auf dem Fest schon gehörig abreagieren. Sie werden wie die Wilden tanzen, singen und trinken und schließlich in aller Ruhe nach Hause zurückkehren, um ihren Kater auszukurieren.«
»Nein«, widersprach der kleine Priester kopfschüttelnd. »Nein, mein Freund. So einfach ist die Sache nicht. Sie kennen diese Menschen nicht so gut wie ich. Das sind keine Kinder. Sie sind ein altes Volk – älter noch als Griechen, Römer oder Babylonier, so alt wie jene frühen Menschen, die ihre Bilder an die Höhlenwände der Pyrenäen malten. Das Böse steckt tief in ihnen; es ist uralt, bedrohlich und dunkel. Und jetzt regt es sich wieder. Ich weiß es, auch wenn ich’s schlecht beschreiben kann.«
»Aber es muß doch irgendwelche Anzeichen geben – offene Unruhe zum Beispiel…«
»Ja, es gibt solche Anzeichen.« Er runzelte die Stirn. Sein volles Gesicht erschien plötzlich schlaff und eingesunken. »Meine Schützlinge erzählten mir, daß die Stammesältesten behaupten, der Rote Geist würde leibhaftig auf dem Fest erscheinen. Er soll angeblich in menschlicher Gestalt auftreten und sein Volk zu unermeßlicher Macht und Reichtum führen.«
Sonderfeld schmunzelte nachsichtig.
»Die ewig alten Wunscherfüllungs-Riten, die in tausendfacher Form unter den Primitiven auftauchen – und immer bei Stammesfeiern oder -fehden. Die verschwinden wieder, sobald der große Katzenjammer kommt. Wenn Sie mal genauer hinsehen, werden Sie feststellen, daß die ganze Unruhe meist von einem Medizinmann ausgelöst wird, der sich vor versammeltem Volk einen Namen machen möchte – und Profit dazu.«
»Den Mann kenn’ ich bereits«, sagte Pater Louis barsch. »Er heißt Kumo, Er haust in Ihrem Dorf.«
»Kumo, ja?« Jetzt durfte sich sein Interesse schon deutlicher zeigen.
»Hab’ natürlich von ihm gehört – das Übliche, was so über die verschiedenen Charaktere des Stammes im Umlauf ist. Hab’ dem nie Bedeutung beigemessen. Ein Scharlatan, der etwas mehr Köpfchen hat als die übrigen Leute hier. Wieso sollte gerade er besonders wichtig sein?«
»Kumo…«, entgegnete der Priester zögernd, »Kumo war einer von meinen Missionsschülern. Seine Intelligenz lag weit überm Durchschnitt. Ich hatte gehofft, er würde Religionslehrer und eines Tages vielleicht sogar Priester werden – womöglich der erste aus diesen Bergen. Aber dann…«, er zögerte und suchte krampfhaft nach Worten, »… kam es zum Gewissenskonflikt. Ich kann Ihnen nicht sagen, was es war, da es unter das Beichtgeheimnis fällt. Auf jeden Fall hab’ ich ihm deutlich gemacht, was er zu tun hätte. Er aber weigerte sich und lehnte die Sakramente ab. Dann verließ er mich, kehrte der Missionsschule für immer den Rücken und ging hinauf in die Berge zu den Lehrern der alten dunklen Geheimriten. Er wurde Zauberer.« Erneut unterbrach er sich, als widerstrebte es ihm, seine tiefsten Gedanken in Worte zu fassen. »Ich… ich habe hinreichende Gründe zu glauben, daß er seine Seele dem Teufel verschrieben hat.«
Sonderfeld brach in schallendes Gelächter aus.
»Nein, nein, nein, mein lieber Pater! Sie doch nicht! Für so was sind Sie doch zu intelligent! Werwölfe in Carinthia – mit einem Dorfpriester, der genauso abergläubisch ist wie seine verängstigte Gemeinde? Ein armseliger Kaplan auf Sizilien mit seiner weinenden Madonna! Aber Sie doch nicht! Dafür sind Sie zu gebildet; zu alt für solche… solche Kinderspiele. Hören Sie, wir können offen miteinander reden. Schließlich…«
»Muttergottes!« platzte Pater Louis in hellem Zorn dazwischen. »Was für ein Narr kann doch ein erwachsener Mensch sein! Da sitzen Sie und lachen – und worüber? Ich will es Ihnen sagen: über das gigantische Böse aus zehntausend Jahren.«
Sonderfeld schaltete sofort auf reumütige Einsicht. Er hatte einen Fehler gemacht. Das Vergnügen, zu lachen, konnte er sich später leisten.
»Vergeben Sie mir, mein Freund. Es war taktlos. Ich wollte damit keineswegs sagen…«
Pater Louis schüttelte den Kopf. Sein Ärger erstarb so schnell, wie er gekommen war. Seine Stimme klang nüchtern und bekümmert. »Ich weiß sehr gut, was Sie meinen: Das Böse ist ein Mißgeschick der Schöpfung und das Universum ein unvollkommenes Produkt der Evolution, die im Urchaos begann. Gott ist ein substanzloser Name und Satan ein mittelalterlicher Mythos – Pah!« Er nahm die Pfeife aus dem Mund und legte sie zurück auf den Tisch. Handbewegung, Blick und Tonfall ergänzten sinnvoll seine engagierte Haltung. »Schauen Sie, Kurt, Sie sollten versuchen zu verstehen – schon um Ihrer selbst willen. Es geht nicht um mich; ich bin schon zu alt, als daß mich ein Lachen verunsichern könnte. Nein, meine Sorge gilt Ihnen. Man kann nicht das Geheimnis der Schöpfung mit einem Achselzucken und einer Phrase abtun. Kein Mensch ist dafür groß genug!«
»Sie werden mir hoffentlich verzeihen, wenn ich Ihre Erklärung zu dieser Frage in Zweifel ziehe.«
»Wenn’s sein muß, so zweifeln Sie ruhig, aber tun Sie’s nicht einfach ab. Hören Sie gut zu!« Seine Stimme bekam einen beschwörenden Klang. »Sie wissen genau, wie ich hier lebe, und Sie wissen auch, wie lange schon. Ich besitze keine Pflanzung wie Sie, hab’ auch keine Frau wie Sie. Aber Sie wissen auch, daß ich beides hätte haben können. Warum wohl habe ich darauf verzichtet? Ich will es Ihnen sagen: Weil ich an Gott glaube, und an den Teufel. Ich weiß, daß es sie gibt – tatsächlich, leibhaftig und als aktive Wesen. Darin liegt der ganze Sinn eines Priesterlebens: Gott zu dienen und den Teufel zu bekämpfen; und die Herde der Gläubigen zu stärken für eben diesen Dienst und Kampf.«
»Ein achtenswerter Glaube, Pater, aber auch sehr schroff. Vielleicht ist es schade, daß ich ihn nicht akzeptieren kann. Ich habe Gott nie gesehen, und den Teufel auch nicht. Falls irgendwann…« Er zuckte bedeutsam die Achseln.
»Gottes Handschrift ist in jedem Hektar dieses Tales sichtbar. Sein Werk liegt hier auf Ihrem Tisch.« Er nahm die goldgelbe Orchideenblüte und hielt sie Sonderfeld unter die Nase. Dieser winkte unwillig ab.
»Und der Teufel, Pater? Wo sehen Sie den Teufel?«
Etwas wie Mitleid war plötzlich in den klugen, hellen Augen zu lesen.
»Und wenn ich Ihnen erzählen würde, mein Freund, daß ich Frauen gesehen habe, die die Schädel ihrer Erstgeborenen zerschmetterten und anschließend seelenruhig ein Schwein säugten; daß es in den Bergen Zauberer gibt – und Kumo ist einer von ihnen – die sich in Straußenvögel verwandeln und von Dorf zu Dorf eilen – schneller als ein Mensch je laufen könnte; daß ich ein Mädchen schwebend in der Luft gesehen habe, das sechs starke Männer nicht zu Boden ziehen konnten, und die dabei die wildesten Verwünschungen im Latein des heiligen Hieronymus ausstieß, während ich den Exorzismus sprach; bedenken Sie, ein Mädchen aus den Bergen, das nicht mal drei Worte Englisch konnte! Was würden Sie da sagen?«
»Dann, mein lieber Pater«, erwiderte Sonderfeld schmeichelnd, »dann würde ich sagen, daß Sie schon weitaus länger – und sicher weniger angenehm als ich – hier oben leben. Jetzt aber bitte ich Sie, mich zu entschuldigen, da ich meine Frau holen möchte.« Sonderfeld wollte sich erheben, doch mit einer Handbewegung hielt der Pater ihn zurück.
»Moment noch, bitte!«
»Ja?«
»Sie haben auch damit zu tun.«
»Ich? Damit zu tun? Inwiefern?« Seine Stimme klang spröde, aber fest.
»Als ich den Pfad heraufkam, traf ich N’Daria. Sie war für den nächtlichen Singsang im Dorf herausgeputzt.«
»Und was soll das mit mir zu tun haben? Sie ist ein Kind dieser Gegend. Ist doch natürlich, daß sie an den Freuden ihres Volkes teilnimmt. Selbst wenn ich wollte, könnte ich es nicht verhindern.«
»Es geht nicht ums Verhindern«, widersprach der alte Priester müde. »Es ist nur so, daß N’Daria zur Liebespartnerin für Kumo auserkoren wurde. Ich dachte, Sie sollten das wissen.«
»Danke, Pater«, sagte Sonderfeld mit kalter Stimme. »Jetzt, wo ich es weiß, finde ich es völlig bedeutungslos. Georgie! Einen Drink für Pater Louis! Entschuldigen Sie mich für einige Augenblicke!«
Er drehte sich auf dem Absatz um und trat in den kühlen Halbschatten des Hauses. Wee Georgie füllte sich das Glas mit Whisky und kippte es in einem Zug.
Pater Louis saß zusammengesunken auf seinem Stuhl und starrte hinaus aufs Tal mit den länger werdenden Schatten der Berge.