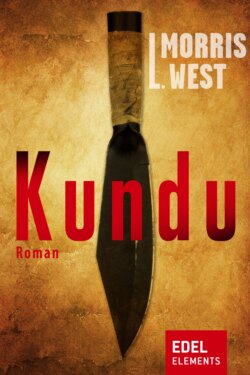Читать книгу Kundu - Morris L. West - Страница 4
Kapitel 2
ОглавлениеGerda Sonderfelds Garten war ein Wunderland an Farbenpracht und schwelgender Lebensfülle.
Der Wechsel von Sommerregen, tropischer Hitze und kühlen Winden, dazu die Hilfe zweier Burschen und Gerdas pflegende Hand hatten ein Viertel Hektar schwarzer Vulkanerde in einen blühenden Paradiesgarten verwandelt.
Hier oben in den Hochtälern wußte man nichts vom Wechsel der Zeiten, die symbolisch für Kindheit, Jugend, Reife und Alter stehen. Hier gab es lediglich die große und die kleine Regenzeit: Sonne im Krebs und Sonne im Steinbock. Hier konnte man pflanzen, was und wann man wollte, und wie im Treibhaus sproß es auf zu wachsendem Leben, Knospe und Blüte.
In ihrem Garten wuchsen Lupinen, deren Blütenstauden rot wie Kohlen glühten, und Gladiolen, die mit ihren riesigen Lanzen und Samtblüten über den Neid jedes normalen Gärtners erhaben waren. Da waren Dahlien und Rittersporn, Astern, schlanker Mohn und weiße Glockenblumen; riesenhafte Kohlgewächse, reich an ausgefransten Blättern, wilde Lilien und Kroton neben Orchideen und hängendem Farn, und eine Passionsblume rankte sich über das Sommerhaus aus Bambusrohr. Dazwischen standen Kasuarinenbäume und Bambusstauden und Büsche mit roten, lila und strahlend orangefarbenen Beeren. Neben Pflanzen, die jedem englischen Garten zur Zierde gereicht hätten, gab es wild-exotische Gewächse, wie sie nur im Dschungel und in Regenwäldern anzutreffen waren. Die Luft stand still, wie berauscht vom Duft der Pflanzen.
Das Ganze war ein Meisterwerk und widersprüchlich wie die Frau, die es geschaffen hatte.
Sie befand sich gerade mit Max Lansing in der Sommerhütte.
Sie strich ihren hellen Baumwollkittel glatt, in einer formenden Bewegung über die vollen Brüste bis hinunter an die aufreizende Rundung ihrer Hüften. Dann besserte sie das Rot der Lippen auf und band ihr dichtes schwarzes Haar zu einem schlichten Nackenknoten. Lansing musterte sie irritiert und voller Ungeduld.
Noch kurz zuvor hatte sie in seinen Armen gelegen, ihren Mund leidenschaftlich an den seinen gepreßt und mit der drängenden Nähe ihres geschmeidig-festen Körpers ihn fast zur Höhe der Erregung angestachelt. Dann, unvermittelt, hatte sie ihn ohne Worte der Erklärung oder des Bedauerns weggestoßen und mit jenem minuziösen Ritual kosmetischer Toilette angefangen.
Das Feuer ihrer Leidenschaft war so schnell erloschen wie ein Licht, das man ausknipst. Ebenfalls erloschen war der warme Glanz ihrer Haut, die wieder glatt wie altes, edles Elfenbein aussah. Ihre kleinen Hände zeigten keinerlei Unruhe beim Ordnen ihres Äußeren, und ihre dunklen Augen blickten derart rätselhaft, daß Lansing unfähig war zu sagen, ob sie ihn mit Ironie oder liebevoller Zärtlichkeit bedachten. Die leicht geöffneten Lippen wirkten kühl und trocken. Dennoch war sie weder kapriziös noch kokett. Ihre Leidenschaft wirkte eher direkt, von einer sanften Selbstverständlichkeit, die ihn anfangs überraschte, seinen Trieb dann aber um so stärker reizte. Einzig das Abrupte ihres Stimmungswechsels verletzte seine Eitelkeit, Während seine eigene Begierde bis aufs Äußerste gereizt war, gab sie sich ruhig und gelassen wie eine Katze vor dem Kamin. Abermals versuchte er, sie an sich zu ziehen, doch sie wich ihm aus, und fuhr fort, ihre Haare hochzustecken.
»Nein, Max, nicht jetzt! Kurt kann jede Minute hier sein. Es wäre peinlich für uns alle.«
»Peinlich!« Das Wort schien ihm im Halse steckenzubleiben, und seine Stimme mit dem breiten Tonfall des Mittelwestens klang gereizt und voller Empörung. »Zur Hölle, Gerda! Was glaubst du, wen du vor dir hast? Ich liebe dich – kannst du das nicht begreifen?«
»Sprich leiser, Max«, entgegnete sie ruhig. »Ich kann dich auch so verstehen; es ist völlig unnötig, mich anzuschreien.«
»Ich schreie nicht. Ich versuche lediglich, dir klarzumachen…«
»Aber Liebling, die Sache ist mir vollkommen klar.«
Sie ordnete die letzten Haarsträhnen und legte dann ihre kühle Hand auf seine Wange. Die mütterliche Geste irritierte ihn, so daß er unvermittelt zurückzuckte.
»Okay! Es ist dir also alles klar; du weißt, was los ist. Begreifst du dann auch, wie sehr ich dich liebe? Ist dir eigentlich bewußt, was es bedeutet, in meiner Hütte zu liegen und Nacht für Nacht diesen gottverdammten Trommeln zuhören zu müssen, während du hier oben mit ihm zusammen bist? Wenn ich bloß einpacken und dich mitnehmen könnte, weg von hier…«
Sie lächelte ihn an – auf jene mitleidig-überlegene Art, wie sie ein Erwachsener einem aufbrausenden Kind gegenüber zeigt.
»Aber das geht doch nicht, Max. Du mußt hierbleiben, bis deine Zeit rum ist, sonst verlierst du dein Stipendium. Und selbst wenn – wohin würdest du denn mit mir gehen?«
»Nach Hause, in die Staaten.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Etwa in eine winzige Großstadtwohnung? In eine kleine Bruchbude in Uni-Nähe? Ich würde dort verkümmern. Ganz abgesehen davon, daß ich Schwierigkeiten hätte, überhaupt das entsprechende Visum zu bekommen. Versteh doch, Darling! Laß uns lieber das genießen, was wir haben. Heut nacht, wenn Kurt ins Dorf geht, kannst du zu mir kommen..«
»Zum Teufel, Gerda!«
Sein Ärger war wie weggeblasen. Verzweifelt und mit schlaffen Schultern stand er vor ihr. Sie mußte daran denken, wie krank und kraftlos er doch war: Sein Gesicht war gelb und gezeichnet von latent drohender Malaria, die dürren langen Finger waren vom vielen Rauchen verfärbt; die Kleider hingen ihm lose um die groben Glieder. Seine Augen blickten glühend aus tiefen Höhlen. Bald, dachte sie, würde er alt sein und betrogen um die Erfüllung all seiner Träume. Sie sah ihn vor sich, wie er eines Tages mit der Tasche voller Notizen und dem ungestillten Hunger seines Herzens heimkehren würde, um einen Forschungsbericht zu schreiben und eine Reihe bescheidener Vorträge zu halten, die nicht einmal ein Kräuseln auf der Wasserfläche bewirkten. Max Lansing würde stets der falsche Mann am falschen Platze sein – zu spät dran, oder zu früh; seine Pläne nicht ganz angemessen, seine Arbeit nicht richtig abgestimmt, sein Leben einsam und im Abseits.
Von Mitleid überwältigt, ergriff sie seine Hand und führte sie an ihre Lippen. Über sie gebeugt, erreichte ihn der Duft der dunklen Haare.
»Hör mir zu, Max!« sagte sie mit sanfter Stimme, deren gutturaler Klang den fremden Zungenschlag verriet. »Ich habe es schon mal gesagt und wiederhole es: Du bist für dieses Leben nicht geschaffen. Du gehörst nicht zu den Männern, die alleine leben können. Gib es auf und fahr zurück! Such dir ein nettes amerikanisches Mädchen, das dein Haus in Ordnung hält und Kinder in die Welt setzt…«
»Ich kann nicht zurück!« Es klang wie ein Aufschrei. »Dies hier ist meine große Chance. Verstehst du das nicht? Dies hier ist einer der wenigen Plätze auf der Welt, wo ein Forscher zu bahnbrechenden Erkenntnissen gelangen kann. Wenn ich’s schaffe, mache ich mir einen Namen und bekomme einen Lehrstuhl an einer der großen Universitäten…«
»Na schön, Max, sei es drum.« Sie brachte es nicht fertig, ihm die letzte Illusion zu rauben. »Wenn du schon hierbleiben mußt, so nimm es, wie es ist, und mach’s dir nicht schwerer als nötig. Leg dir ein Dorfmädchen zu, das sich um dich kümmert.« Sie hob den Kopf und lächelte ihn an. »Du würdest von ihr in einer einzigen Woche mehr lernen als allein in einem ganzen Jahr.«
Er stieß sie unwirsch zurück.
»Um hinterher zu dir zu kommen? Dich in meinen Armen zu halten? Dich zu lieben?«
Sie zuckte die Achseln und machte eine entwaffnende Handbewegung.
»Warum nicht? Es würde mir nichts ausmachen. Ich wäre froh, dich glücklich zu wissen.«
»Und du behauptest, du liebst mich!«
Er wandte sich ab und griff niedergeschlagen nach einer Zigarette. »Ich habe nie gesagt, daß ich dich liebe, Max«, erwiderte sie ruhig. Er drehte sich bestürzt nach ihr um.
»Was dann? In Gottes Namen, Gerda, was für eine Frau bist du eigentlich?«
Sie lächelte auch jetzt. Nie und nimmer würde sie nachgeben oder ihrerseits ein ebensolches Verlangen durchblicken lassen.
»Mein Mann nennt mich eine Hure«, sagte sie gelassen. »Ich selber sehe mich ganz anders. Ich brauche Zärtlichkeit so dringend wie das täglich Brot oder wie die Blumen meines Gartens. Kurt gibt mir keine, also hole ich sie mir, wo ich sie kriegen kann.«
»Von mir oder vom Nächstbesten!«
»Richtig, Max. Von dir oder vom Nächstbesten. Gib wenigstens zu, daß ich in diesem Punkt vollkommen ehrlich bin!«
»Ja sicher, ehrlich bist du!«
Während sein Atem stoßweise die Lungen verließ, fuhren seine Finger voller Unruhe durchs gewellte Haar.
»Na schön… Danke für die Mitteilung. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich dran bin. Ist wohl besser, ich haue ab.«
»Mein lieber Freund«, sagte Kurt Sonderfeld von der Tür her, »Sie können uns jetzt nicht verlassen; Sie sind unser Gast; Ihr Zimmer ist inzwischen vorbereitet, und auch die anderen erwarten Sie. Sollten wir nicht besser reingehen, Gerda?«
Zwei Neuankömmlinge saßen auf den Gartenstühlen und tranken Wee Georgies eisgekühlten Whisky: ein blonder junger Mann in fleckigem Khaki und ein dicker, rotgesichtiger Bursche mit gestärktem Hemd und Tropenshorts. Sie kamen vom Kiap-Haus, einer großen strohgedeckten Hütte am Dorfrand, die von den Eingeborenen als Unterkunft für die Regierungsbeamten errichtet worden war.
Der junge Blonde hieß Lee Curtis, Offizierskadett unter dem Kommando des Distriktkommissars von Goroka. Seine Position war die eines Polizisten, Richters, Steuerbeamten und halbmilitärischen Verwalters für ein dreitausend Quadratmeilen großes Gebiet mit rund fünfzigtausend Einwohnern. Er hatte blaue Augen, einen Kindermund und schwitzte vor Verlegenheit in Gesellschaft solch polyglotter Gäste. Seine offenkundige Bewunderung für Gerda lieferte dem Hausherrn einen steten Grund zur Heiterkeit.
Sein Begleiter war Brite, Vertreter eines internationalen Kaffeekonzerns, der mit Genehmigung des Landwirtschaftsministeriums unerschlossene Gebiete im Hochland erkundete. Er zeigte die gelassene Gewandtheit des weitgereisten Mannes mit Erfahrung, der seinen regen Geist und wachen Blick hinter einem steten Lächeln und den dicken Rändern einer Hornbrille zu verbergen suchte. Er hörte auf den ungewöhnlichen Namen Theodore Nelson und war Experte im Taxieren der Ernte und für Schädlinge und Krankheiten der Kaffeepflanze. Seine Auftraggeber schätzten jedoch vor allem seine hervorragende Menschenkenntnis, die eine bedeutende Rolle spielte bei der Gewährung größerer Darlehen, wenn etwa Schädlinge ganze Ernten vernichteten oder die Kosten für eine Rodung unverhältnismäßig hoch ausfielen.
Als Gerda die Veranda betrat, standen beide höflich lächelnd auf und bemühten sich um eine günstige Position, während Kurt Sonderfeld seine Frau mit bewährtem Charme zu den Gästen führte. Beide wollten neben Gerda sitzen, und als sie dies ignorierte und sich neben Pater Louis niederließ, um voll Bewunderung die Orchidee in Augenschein zu nehmen, empfand Sonderfeld eine Art Galgenhumor. Selbst dann noch konnten sie den Blick nicht von ihr wenden, und wie der Wind, der ein Weizenfeld aufstört, wie Kundu-Trommeln, die das tiefe Schweigen der Hochländer brechen, erfaßte drängende Unruhe die Männer.
Seltsam, dachte Sonderfeld bitter, daß eine Frau, die ihrem Ehemann nichts als eisige Kälte entgegenbringt, andere Männer derart aus dem Gleichgewicht zu bringen vermag.
Der Gedanke machte ihn nervös, doch wischte er ihn selbstbeherrscht beiseite und widmete sich voll und ganz der Unterhaltung seiner Gäste.
»Sie haben meinen Kaffee gesehen, Mr. Nelson. Was halten Sie davon?«
Der Engländer wurde enthusiastisch.
»Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! Ich kann mit voller Überzeugung sagen, daß es die beste Pflanzung ist, die ich im Hochland gesehen habe. Der Boden ist gut und hervorragend bearbeitet; Sie haben genau die richtigen Schattenbäume gewählt. Hab’ auch Ihre Jungs beim Sprühen beobachtet – sind ausgezeichnet eingearbeitet.« Sonderfeld nickte zufrieden über das Expertenlob. »Bevor ich das Land hier erschloß, habe ich mich eingehend mit den möglichen Problemen und Schwierigkeiten beschäftigt. Der Boden ist reich und das Klima optimal. Bei durchschnittlicher Pflege sehe ich keinen Grund, warum wir hier nicht den besten Kaffee der Welt produzieren sollten.«
»Da ist nur ein einziger Punkt, der mich bedenklich stimmt«, bemerkte Nelson vorsichtig. »Zumindest meine Gesellschaft wird sich daran stoßen, falls wir miteinander ins Geschäft kommen sollten.«
»Was meinen Sie?«
»Es gibt keine Straße. Goroka ist fünfzig Meilen entfernt. Wie wollen Sie die Ernte auf den Markt bringen?«
Nun ergriff Lee Curtis das Wort, wobei er in seinem Eifer, an der Diskussion teilzunehmen, etwas ins Stottern geriet.
»Da… das ist es genau, was jeder hier im Hochland zu gerne wissen würde. Sei… seit Sonderfeld hier raufkam, macht man sich darüber lustig. Alle anderen Siedler entschieden sich für Land entlang der Straße. Es reicht dreihundert Meilen weit von Lae nach Mount Hagen. Selbst die alten Füchse in diesem Bezirk würden sich niemals so weit ins Innere wagen.«
Sonderfeld lächelte nachsichtig. Das angeschnittene Problem war ihm seit langem vertraut und hatte inzwischen jede Gefährlichkeit verloren.
»Die Antwort auf Ihre Frage, Mr. Nelson, zumindest teilweise, ist dies: Das Land hier ist jung, das jüngste der Welt – zumindest was seine Nutzung betrifft. Anfangs gehörte es zu Deutschland, das sich jedoch seines Besitzes nicht so recht erfreuen konnte, zumal es im Krieg all seine Kolonien verlor. Der Völkerbund übergab es als Mandat an Australien. Dann kamen die Japaner und besetzten die Nordküste und einen Teil des Hinterlandes fast während des ganzen Pazifikkrieges. Nachdem sie besiegt waren, erhielt Australien von den Vereinten Nationen aufs neue ein Mandat.«
Nelson schaute leicht irritiert.
»Ich verstehe nicht ganz, was das mit dem heutigen Kaffeegeschäft zu tun hat.«
Sonderfeld lächelte nachsichtig.
»Sie werden staunen, mein lieber Freund, wie wichtig das ist. Die Regierung in ihrer jetzigen Form ist eine Treuhandverwaltung und keine souveräne Staatsführung auf Dauer. Als solche besteht ihre erste Pflicht in der Wohlfahrt der einheimischen Bevölkerung. Das Mandat der Vereinten Nationen verpflichtet dazu, den Grund und Boden für die Eingeborenen zu erhalten und einer Veräußerung an Privatpersonen entgegenzuwirken. Nur solches Land, das für die Stämme nutzlos ist, kann von der Regierung übernommen und auf neunundneunzig Jahre verpachtet werden. Ich selber gehöre zu den Spätsiedlern. Damals, als ich soweit war, einen Pachtvertrag abschließen zu können, hatte man das beste Land beidseitig der Hochlandstraße schon vergeben. Folglich war ich gezwungen, tiefer ins Inland auszuweichen. Wie Sie sehen, habe ich es nicht schlecht getroffen.«
»In der Tat«, erwiderte Nelson zweifelnd. »Dennoch bleibt das Transportproblem. Sind die Frachtkosten zu hoch, können Sie mit den Marktpreisen nicht konkurrieren.«
Sonderfeld schüttelte den Kopf.
»Glauben Sie mir, so kurzsichtig bin ich nun auch wieder nicht. Wenn die Zeit der Ernte kommt, wird es diese Straße geben – meine eigene Straße!«
»Sie wollen sie selber bauen?«
»Meine Leute werden es für mich tun«, entgegnete Sonderfeld. Pater Louis warf ihm einen scharfen Blick zu, und Max Lansing fuhr hoch, als wäre er Zeuge einer ganz unglaublichen Enthüllung. Lediglich Nelson und der junge Patrouillenoffizier schienen an der schlichten und selbstsicheren Feststellung ihres Gastgebers nichts Ungewöhnliches zu finden.
Nelson blickte fragend zu Curtis; der nickte zustimmend.
»Es wäre zu schaffen – vorausgesetzt natürlich, die Stämme zeigen sich kooperativ. Zur Zeit machen sie jedenfalls den Eindruck.« Er lachte laut wie ein verlegener Schuljunge. »Hoffen wir, daß es so bleibt; das erleichtert mir auch meinen Job.«
Sonderfeld verbeugte sich als Zeichen ironischer Anerkennung. »Ein wahres Kompliment von offizieller Stelle. Ich danke Ihnen, mein Freund. Es scheint leider, als sei Pater Louis anderer Meinung.«
»Oh? Wieso das?« Curtis ging trotzig auf die Herausforderung ein. Die Missionare waren seit alters her die störenden Flecken auf der sonst so sauberen Weste der weltlichen Regierung. Ihre These von der Sündhaftigkeit der Seele und der eingeborenen Unmoral bedeutete für die Kolonialbeamten mehr als nur ein theologisches Problem.
Pater Louis kaute heftig an seiner Pfeife. Sein Blick wirkte ausdruckslos, und der Mund blieb hinter seinem Trotzki-Bart geheimnisvoll verschlossen.
Theodore Nelson musterte ihn mit gedämpfter Mißbilligung. Er hatte jene typisch englische Abneigung gegenüber Klerikern, die die Grenzen kirchlicher Machtbefugnisse überschritten. Für alles gab es den richtigen Ort und Zeitpunkt, und das Evangelium des heiligen Johannes bedurfte nun einmal der Orgelklänge und des Halbdunkels gotischer Kathedralen, um halbwegs erträglich zu sein. Unter Steinzeitmenschen bedeutete seine Verkündigung nichts als typisch französische Schwatzhaftigkeit.
Pater Louis hob den Kopf. Seine Antwort klang mild und ohne jeden Nachdruck.
»Ich habe unserem Freund hier schon erklärt, daß die Stämme unruhig sind. Wie Sie wissen, steht das Schweinefest vor der Tür. Die Medizinmänner verbreiten das Gerücht, der Rote Geist werde leibhaftig beim großen Opfer erscheinen.«
»Also das ist es!« Lansing wäre fast vom Stuhl aufgesprungen; seine Stimme barst wie trockenes Holz. Die anderen schauten ihn verwundert an. Nur Sonderfeld zeigte sich wenig beeindruckt. Mit beißender Ironie fragte er ihn:
»Nun kommen Sie schon, mein Bester, erzählen Sie mir nicht, Sie seien überrascht. Schließlich leben Sie doch unter diesen Menschen – oder? Es gehört zu Ihrem Beruf, die sozialen Strukturen primitiver Völker zu erforschen. Sie müßten doch genauso wie Pater Louis diese Gerüchte kennen?«
»Sicher, sicher hab’ ich davon gehört.«
»Pater Louis hat gemeint, dieses Gerücht werde von Kumo, einem Medizinmann meines eigenen Dorfes, in die Welt gesetzt.«
»Da bin ich anderer Meinung!«
Lansing machte den Eindruck einer gespannten Geigensaite; sein Kinn reckte sich nervös-herausfordernd nach vorn; seine ganze Haltung wirkte wie bei einem tänzelnden Boxer vor dem ersten Schlag. Sonderfeld lächelte noch immer, doch eine gesteigerte Wachsamkeit lag in seinem Blick.
»Ich bin sicher, Pater Louis würde sich freuen, Ihre Meinung dazu zu hören.«
Lansing grinste.
»Die Regierung ist sicher auch daran interessiert.«
Der Patrouillenoffizier hob den Blick, wobei sein jungenhaftes Gesicht einen Ausdruck komischer Würde annahm.
»Wir sind stets an der Meinung der Einheimischen interessiert. Sie hilft uns, die Situation richtig einzuschätzen.«
Lansing spreizte seine langen knochigen Hände und legte nach Art vieler Akademiker mit Bedacht die Fingerspitzen aneinander. Die anderen schauten ihm schweigend zu. Nur Gerdas Augen wirkten bekümmert. Dann begann er langsam und präzise zu sprechen. »Ich bin zu der Überzeugung gekommen, daß das diesjährige Schweinefest das auslösende Moment ist für einen beginnenden Cargo-Kult in dieser Region.«
Seine Worte fielen ins allgemeine Schweigen wie Kieselsteine ins stille Wasser: Wellen des Interesses liefen durch die kleine Gesellschaft. Als erster ergriff Theodore Nelson das Wort.
»Cargo-Kult? Hab’ ich noch nie gehört.«
Lee Curtis brannte darauf, eine entsprechende Erklärung liefern zu dürfen.
»Cargo-Kult bedeutet…«
Lansing überging die störende Unterbrechung und fuhr unbeeindruckt fort:
»Der sogenannte Cargo-Kult hat vielfältige Erscheinungsformen; in seinem Kern aber ist er ausgesprochen einfach und nichts weiter als das Ergebnis moderner Zivilisationseinflüsse auf die Kultur primitiver Völker. Das Auftauchen des weißen Mannes bedeutet für die Eingeborenenstämme die Offenbarung einer neuen Idealwelt und eines Lebensstils, der ihnen verwehrt bleibt. Es gab Zeiten, wo man den Reichtum eines Mannes an der Menge seiner Schweine oder seines Vorrats an Muscheln maß. Kriegerische Tüchtigkeit und die Anzahl getöteter Feinde bescheinigten seine Männlichkeit. Heute ist das Töten von Stammesfeinden ein Verbrechen. Die jungen Männer, die nach Ablauf ihrer Arbeitsverträge von der Küste heimkehren, sind unzufrieden. Sie haben Fahrräder, Autos, Kühlschränke und Kinofilme gesehen. Schweine und Muscheln genügen ihnen nicht mehr; auf Federschmuck und traditionelle Festbekleidung schauen sie insgeheim verächtlich herab. Erkenntnis und Wissen sind in den Garten Eden eingedrungen, und Adam schämt sich seiner Nacktheit.«
Er hielt inne, um das Interesse seiner Zuhörer auszuloten und den versteckten Unwillen Sonderfelds zu genießen. Dann fuhr er fort: »Das also ist der Beginn des Kultes – das neue Verlangen, das neue Paradies jenseits der Reichweite dunkler Finger. Als nächstes erscheint ein neuer Prophet mit neuen Versprechungen; doch er benutzt die alten Symbole – Schweinegott und Roter Geist. Er bedient sich alter Zaubermittel und traditioneller Opfer- und Sühnerituale. Nur was er verspricht, die Güter, sie sind neu. ›Hört auf mich und ich gebe euch die Reichtümer des weißen Mannes; folgt mir und ich lasse euch teilhaben an seiner Macht. Die großen dröhnenden Vögel werden auf meinen Befehl hin losfliegen und mit Schätzen wiederkehren, die euch reich und mächtig machen. ‹ Fragt die Veteranen! Sie werden euch vom Schwarzen Heiland, vom Schwarzen König berichten; davon, daß amerikanische Negersoldaten als Befreier begrüßt wurden. Oder fragt den Patrouillenoffizier Curtis hier, und er wird von Funkhäusern mit Ranken als Antennen erzählen, und von kleinen Armeen, die hölzerne Pistolen schnitzen – ähnlich denen, die die einheimischen Polizisten tragen.«
Ein wenig atemlos vom hitzigen Monolog unterbrach er sich, um dann ein nüchternes Fazit zu ziehen:
»So interpretiere ich die Gerüchte vom Roten Geist und seiner angeblichen Offenbarung am Großen Schweinefest. Bis hierher, glaube ich, wird Pater Louis mir zustimmen.«
Der kleine Priester nickte, während er noch immer wortlos an der Pfeife kaute.
»Doch in einem Punkt bin ich anderer Meinung als er. Der neue Prophet heißt nicht Kumo. Er ist ein Strohmann, das Sprachrohr eines anderen.«
»Eines anderen?« fragte Pater Louis verdächtig zurückhaltend. Lansing wandte sich ihm zu und richtete demonstrativ seinen Zeigefinger auf ihn.
»Sie leben in dieser Gegend schon weitaus länger als irgendeiner von uns, Pater. Sie wissen, daß Stammeszwistigkeiten mehr als einmal durch den Eigennutz von Weißen angezettelt wurden; vor allem von Goldsuchern, Ausbeutern und verrückten Weltverbesserern, die glauben, ein Gebirge könne den Vormarsch von Aufklärung und Zivilisation stoppen.«
»Ja, ich weiß«, erwiderte Pater Louis ruhig. »Und ich weiß auch, daß ihre Macht stets kurz und ihr Ende stets gewaltsam ist. Wollen Sie sagen, daß der Mann hinter Kumo ein Weißer ist?«
»In der Tat«, erwiderte Lansing barsch.
Die Dunkelheit war unbemerkt hereingebrochen, und die ersten Sterne funkelten niedrig und hell am violetten Himmel. Wie um den Vortrag Lansings dramatisch abzurunden, fielen jetzt die Trommelrhythmen dumpf ins Tal. Im Bann dieses geheimnisvollen Augenblicks wagte niemand, sich zu äußern.
Erst als das Abendessen angekündigt wurde, war der Zauber gebrochen.
»Von hier bis zum Lahgi-Tal und fünfzig Meilen nach Norden hin gibt es nur fünf Weiße: Pater Louis, Mr. Lansing, mich selbst, Mrs. Sonderfeld und…«
»Mich!« bemerkte Kurt Sonderfeld trocken. Dann lachte er mit tiefem Dröhnen, das den Klang der Kundu-Trommeln herauszufordern schien.
Er lachte noch, als er den Entschluß faßte, Max Lansing zu töten.
Sie speisten bei Kerzenlicht im großen Wohnraum mit Blick aufs Tal, die Berge und den prächtigen Himmel.
Auf einer Tischdecke aus feinstem Leinen waren kostbares Silber und dekorative Blumen aus Gerdas Garten arrangiert. Jeden Platz schmückte eine dunkelrote Hibiskusblüte, die harmonisch zu dem Rot des Weines paßte, der in kunstvoll geschliffenen Kristallgläsern serviert wurde.
Die Diener waren große Burschen aus den Bergen mit gestärkten Lendentüchern, die knisterten, während sie leise und barfuß hin und her gingen. Die Kerzenflammen spiegelten sich schimmernd auf braun gewölbter Brust und ausgeprägten Schultermuskeln.
Die Spannung, die zwischen Sonderfeld und seinen Gästen aufgekommen war, löste sich durch die sanfte Wirkung vorzüglicher Bewirtung und einer anregenden Konversation, bei der es um die alten Heimatländer jenseits von Berg und Meeren ging. Das Dröhnen der Trommeln aus dem Dorf hielt noch an; doch jetzt klang es gedämpft und fern, ein monotones Rauschen wie der Schlag der Meeresbrandung auf einen geschützten Strand.
Hier im schattigen Raum des schilfgedeckten Hauses war Europa gegenwärtig – jenes Land alter, vergänglicher Schönheit, mit seinen Grenzen im Schachbrettmuster, mit seinen untergegangenen Reichen, das Europa der Verfeinerung von Jahrhunderten. In diesem Raum, im milden Licht der Kerzen saß eine Frau auf ihrem Thron – erwärmt vom Wein, mit einem Lächeln auf den Lippen, das sie huldvoll ihrem kleinen Hofstaat spendete: dem Kleriker, Gelehrten, Kaufmann und Beamten; bedient von dunklen, stummen Sklaven aus den Grenzgebieten.
Kurt Sonderfeld beobachtete die rege Anteilnahme, mit der man Scherze seiner Frau bedachte, und die eitle Selbstgefälligkeit als Reaktion auf ihren spielerischen Charme. Theodore Nelson vergaß alle Zurückhaltung und erzählte von seinen Reisen in Brasilien, Afrika und Ceylon. Pater Louis seinerseits gab Anekdoten aus seiner Missionstätigkeit zum besten, während Lee Curtis auf seine Art sein Glück versuchte, Gerda mit allerlei Kleinigkeiten auf sich aufmerksam zu machen. Nur Lansing verweigerte seine Teilnahme. Schweigend und verstimmt saß er mitten in der angeregten Unterhaltung da, lediglich beobachtet von Sonderfeld, der nachdenklich an seinem Weinglas nippte und sich überlegte, wie weit ihm dieser unglückliche Mensch wohl schaden könnte.
Gerda war wie ausgewechselt. Ihre sonst so typische Verschlossenheit war wie ein Umhang abgefallen, so daß sich Wärme und Lebensfreude frei entfalten konnten. Ihre Augen sprühten, und ihre Gesten waren angeregt und ausdrucksvoll. In der Hitze der Erregung vergriff sie sich hier und da in Formulierungen und Tonfall, wodurch ihre Sprache an Zauber und Reiz gewann. Der Kerzenschein belebte ihre Elfenbeinhaut und warf tiefe Schatten auf ihre geschwungene Kehle und in die Mulde zwischen ihren Brüsten. Kein Wunder, dachte Sonderfeld, daß andere Männer sie begehrten – zumal er selbst noch ein vergebliches Verlangen spürte.
Nach dem Essen tanzte Gerda zur Musik im Radio mit Curtis, Nelson und Lansing, während Sonderfeld und Pater Louis bei Kaffee und Brandy am großen Verandafenster Platz nahmen. Sie lauschten der plätschernden Musik, hörten das Schaben der Tänzer und gelegentlich das helle Lachen Gerdas; doch im Hintergrund dröhnte der Kundu-Rhythmus jetzt wieder lauter und schneller, als die Trommler die schwarze Schlangenhaut bearbeiteten.
Sonderfeld griff nach einer Zigarre, streifte die Bauchbinde ab und beschnitt die Spitze mit übertriebener Sorgfalt. Die fernen Trommelklänge ließen seine Nerven neuerdings erzittern und raubten ihm die innerliche Ruhe. Der Vorfall auf der Hausveranda nagte an ihm als Warnung vor kommender Gefahr. Er brauchte Zeit und Ruhe, um sich zu sammeln und seine Pläne zu klären. Statt dessen war er nun gezwungen, diese kleine Komödie gesellschaftlichen Vergnügens weiter durchzuziehen.
Zusammengesunken in seinem viel zu großen Sessel paffte Pater Louis zufrieden seine Pfeife und musterte seinen Gastgeber aufmerksam durch einen Schleier aufsteigender Rauchschwaden. Lange schon hatte er sich Sorgen um diesen großgewachsenen Mann gemacht. Nach außen wirkte er glatt und hart wie poliertes Teakholz, doch an seinem Innern fraßen Würmer. Der Pater kümmerte sich auch um Menschen, die seinen Glauben ablehnten. Daß Sonderfeld zu seiner Frau keine eigentliche Beziehung mehr hatte, war offenkundig, auch wenn er keine Eifersucht zeigte. Doch eine unerfüllte Ehe reichte nicht, um den kalten Stolz und unnachgiebigen Ehrgeiz dieses Mannes zu erklären. Behutsam wie ein Schachspieler stellte Pater Louis die Eröffnungsfrage.
»Sie wissen, Kurt, daß ich Ihnen für diese Abende in Ihrem Haus äußerst dankbar bin.«
»Freut mich zu hören, Pater«, erwiderte Sonderfeld gelassen.
»Nach so vielen Jahren könnte man meinen, daß das Bedürfnis abnimmt. Doch ganz im Gegenteil.«
»Welches Bedürfnis, Pater?« Sonderfeld war froh über diese ziellos lockere Plauderei. Sie zwang ihn, ruhiger zu werden, und gab ihm Zeit, die eigenen Gedanken zu ordnen.
Pater Louis zuckte die Achseln.
»Annehmlichkeit. Die Annehmlichkeit, die kultiviertes Essen, guter Wein und Musik bieten. Geselligkeit. Das Gespräch mit vertrauten Menschen. Ja, auch der Anblick einer schönen Frau, der Klang ihrer Stimme, ihr unbeschwertes Lachen.«
Sonderfeld grinste.
»Ich dachte immer, daß Sie all diesen Dingen entsagt hätten, als Sie Ihr Gelübde ablegten.«
Der Priester machte eine abwehrende Handbewegung. »Entsagen ist eine Sache. Aber das Bedürfnis selbst erfolgreich zu unterdrücken, eine ganz andere. Ich glaube, daß es vielleicht nie ganz vergeht, bis der Körper selbst abstirbt. Sie sollten wirklich dankbar sein für das, was Sie hier haben: eine schöne Frau, ein komfortables Haus, ein angenehmes Leben.«
»Dankbar?« Zornige Verachtung schwang in seinem Protest. »Dankbar? Wem gegenüber? Etwa mir selbst – für das, was ich mit Verstand, Geduld und Mut erreicht habe? Meiner Frau gegenüber, die sich in meinem eigenen Haus zur Hure macht? Vielleicht denen da gegenüber, die an meinem Tisch essen, meinen Brandy trinken und meine Frau begehren? Oder den Eingeborenenstämmen, die die letzte Schaufel aus meinem Lager stehlen würden, wenn sie mich nicht fürchten würden? Oder dem Land gegenüber, das meinen Kaffee verschlingen würde, wenn ich es nicht selbst ständig in Schach halten würde?«
Falls Pater Louis durch diesen Ausbruch überrascht war, so ließ er es sich nicht im geringsten anmerken. Mit einem kurzen Blick über die Schulter vergewisserte er sich, daß die anderen nichts mitbekommen hatten. Sie lachten und plauderten oder klopften den Rhythmus der Musik mit den Füßen. Gerda verteilte gerade eine neue Runde Drinks. Er wandte sich wieder an Sonderfeld. Sein Ausdruck wirkte grimmig, und seine klugen Augen bekamen einen harten Glanz.
»Mein Freund«, sagte er leise, »Sie sind ein unglücklicher Mensch.«
»Weit gefehlt, Pater. Ich bin keineswegs unglücklich. Im Gegenteil, ich bin ein rundum zufriedener Mensch. Und warum? Weil ich die Narretei der anderen mit derselben Verachtung betrachte wie das liederliche Benehmen meiner Frau. Es berührt mich nicht. Ich habe meinen eigenen Weg – und ich werde ihn allein und in Frieden gehen.«
»Allein, ja, aber nicht in Frieden. Und wohin führt dieser Weg, den Sie Ihr eigen nennen?«
Sonderfeld lächelte verstohlen und schüttelte den Kopf.
»O nein! Dazu bin ich ein zu schlauer Fuchs. Sie werden mich nicht an Ihren Beichtstuhl locken. Versuchen Sie’s doch bei meiner Frau. Sie war mal Katholikin. Vielleicht gelingt es Ihnen, sie in den Schoß der Kirche zurückzuführen. Wenn sie mal zu alt fürs Vergnügen ist, bekommt sie vielleicht Geschmack an der Frömmigkeit. Wer weiß.«
»Sie sind ein Narr, Kurt Sonderfeld«, bemerkte der Pater nachsichtig. »Ich kenne Ihren Weg, denn ich habe viele Menschen gekannt, die ihn gegangen sind. Ich hörte sie vor Verzweiflung aufschreien, als es zu spät war für eine Umkehr. Ich weiß, wohin er führt.«
»Wohin?«
»In den Tod«, war Pater Louis’ schlichte Antwort. »In den Tod… und in die Verdammnis.«
Er stand auf, strich die Asche vom Hemd und stopfte die Pfeife in die Tasche.
»Ich muß jetzt gehen. Der Weg zur Mission ist weit, und morgen hab’ ich eine Frühmesse.«
Sonderfeld verbeugte sich ironisch.
»Ich bedaure, daß Sie gehen müssen. Vergessen Sie nicht, daß Sie hier jederzeit willkommen sind.«
Pater Louis schüttelte den Kopf. Sein zerfurchtes Gesicht wirkte müde und traurig.
»Nein, Kurt, ich werde erst wiederkommen, wenn Sie mich rufen. Aber ich will Ihnen eine Warnung mit auf den Weg geben.«
»Eine Warnung?« Sonderfelds Augen erstarrten zu harten Kieselsteinen, und sein Mund wurde eine dünne, gerade Linie.
»Hören Sie mich an, Kurt«, begann der alte Mann in einem letzten, matten Versuch. »Sie sagten, Ihnen fehle der Glaube. Die Eingeborenen jedoch sind gläubig. Sie hängen zutiefst und voller Hingabe am alten Glauben. Mag er auch sündhaft, verderbt und grausam sein, so gehört er doch untrennbar zu ihrem Leben. Schon deshalb – wenn nicht noch aus anderen Gründen – ist der Glaube der Eingeborenen stärker als Ihr eigener Unglaube. Falls Sie aus Stolz und Unkenntnis diesen Glauben um des eigenen Vorteils willen zu mißbrauchen suchen, wird er Sie vernichten. Glauben Sie mir, er wird Sie total vernichten.«
»Unsinn, Pater!« erwiderte Sonderfeld verbindlich lächelnd und erhob sich. Auch Pater Louis stemmte sich aus seinem Sessel und blickte in das verhärtete, spöttische Gesicht des riesigen Deutschen. Zorn blitzte aus seinen alten Augen, und seine Stimme schwoll drohend an mit der biblischen Macht der Propheten.
»Lassen Sie die Finger von den Eingeborenen, Kurt! Halten Sie sich fern von Kumo und den Medizinmännern. Sie berühren da Dinge, von denen Sie nichts verstehen. Den Teufel zu rufen, ist leicht, ihn zu bannen, das erfordert Glaube, Hoffnung, Liebe und die Gnade Gottes. Gute Nacht, mein Freund.«
Brüsk nahm Sonderfeld am kurzen Abschiedszeremoniell teil und geleitete ihn sodann nach draußen. Geraume Zeit verharrte er alleine auf der Veranda, lauschte den Trommeln und beobachtete, wie der kleine Schatten, einer Fledermaus ähnlich, unter den Kasuarinenbäumen heimwärts flatterte. Er spürte kein Bedauern. Schließlich war auf diese Weise ein mögliches Hindernis für seine Pläne aus dem Weg geräumt. Dann war Max Lansing fällig. Aber sein Tod stand längst in seinen Handlinien geschrieben; Sonderfeld konnte noch abwarten.
Er blickte hinüber zum Laboratorium: Das Licht war noch nicht an. N’Daria war noch im Dorf. Unbeeindruckt zuckte er die Achseln. Die Liebesnächte dieser Gegend waren lang, und die dumpfen Trommelklänge hatten noch nicht ihren Höhepunkt erreicht.