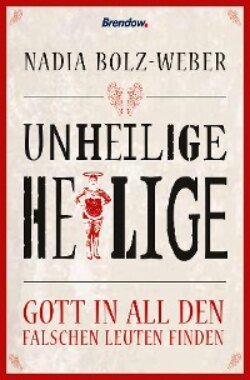Читать книгу Unheilige Heilige - Nadia Bolz-Weber - Страница 12
Mein Niedrigstes
für sein Höchstes
ОглавлениеNa dann, Freundin, hast du Lust, mit mir zum Schießstand zu gehen?“, fragte mich Clayton mit einem schelmischen Funkeln in seinen hellbraunen Augen. Beim Stretching vor dem Crossfit-Kurs, den Clayton leitet, hatte ich erwähnt, mir sei kürzlich klar geworden, dass er mein „konservativer Alibifreund“ sei, so wie manche Leute einen „schwarzen Alibifreund“ haben. Seine Reaktion darauf war, dass er mich ausgerechnet zu Schießübungen einlud.
Während ich meine Fingerspitzen nach meinen Zehen reckte, antwortete mein liberales, immer für schärfere Waffengesetze eintretendes Ich voller Begeisterung: „Im Ernst? Klar habe ich Lust.“ Schließlich sollte die Politik niemals dem Spaß im Weg stehen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt.
In derselben Woche wurde George Zimmerman von dem Vorwurf des Mordes an Trayvon Martin freigesprochen.1 Mein Erlebnis mit Clayton war nur eines von mehreren in dieser Woche, die es mir praktisch unmöglich machten, mich auf den Standpunkt der liberalen Empörung und moralischen Überlegenheit zu stellen, den ich später so gerne eingenommen hätte. Manchmal stürzen das Leben und seine Mehrdeutigkeiten unsere Ideale in eine Krise.
Ein paar Tage nach seinem Angebot sah ich Claytons untersetzte, muskulöse Gestalt auf meine Haustür zukommen. Er hatte eine schwere schwarze Tasche bei sich. Er wollte mir einen Schnellkurs im sicheren Umgang mit Waffen verabreichen, bevor wir zum Schießstand fuhren, denn ich hatte in meinem ganzen Leben noch keine Schusswaffe in der Hand gehabt. Clayton ist Texaner, Republikaner und ein großer Verfechter des zweiten Verfassungszusatzes. Aber da er auch einen Abschluss von der Texas A&M University und einen Teil seines Lebens in Saudi-Arabien verbracht hat, wo sein Vater in der Ölbranche arbeitete, bezeichnet er sich als einen „gebildeten und weitgereisten Hinterwäldler“.
„Vier Dinge musst du wissen“, begann Clayton meine allererste Lektion in Waffensicherheit. „Erstens, geh immer davon aus, dass jede Waffe, die du in die Hand nimmst, geladen ist. Zweitens, ziele nie mit einer Waffe auf etwas, das du nicht zerstören willst. Drittens, lass den Finger vom Abzug, bis du schussbereit bist. Und viertens, kenne dein Ziel und das, was sich dahinter befindet. Eine Pistole ist im Grunde nichts anderes als ein Briefbeschwerer“, fuhr er fort. „An und für sich ist sie nur gefährlich, wenn jemand sich nicht an diese Regeln hält.“
Ich weiß nicht genau, was die Statistik über Todesfälle durch pistolenförmige Briefbeschwerer sagt, dachte ich, aber das werde ich auf jeden Fall mal nachschlagen.
„Okay, fertig?“, fragte Clayton.
„Keine Ahnung“, erwiderte ich.
Er legte eine mattschwarze Pistole und eine Schachtel Munition auf unseren Küchentisch. Es fühlte sich ungefähr genauso verboten an, als hätte er gerade ein Kilo Kokain oder einen Stapel Pornozeitschriften auf die Fläche gelegt, an der wir als Familie zusammen beten und essen.
Ich bemühte mich, intelligente Fragen zu stellen. „Was für eine Pistole ist das?“
„Das ist eine Vierziger.“ Als ob ich auch nur die leiseste Ahnung hätte, was das bedeutete.
„Was ist eine Neun-Millimeter? Von denen habe ich schon öfter gehört.“
„Das hier.“ Er hob sein T-Shirt an und zeigte mir seine versteckte Pistole.
„Mann, du trägst dieses Ding doch wohl nicht dauernd bei dir, oder?“
Er lächelte. „Wenn ich nicht gerade in Turnhosen oder im Schlafanzug herumlaufe, doch.“
Später auf dem Parkplatz des Schießstandes, auf dem fast nur Pick-ups herumstanden, machte ich die scharfsinnige Bemerkung: „Nicht ein einziger Obama-Aufkleber.“
„Komisch, was?“, grinste er.
Wenn ich irgendwo an einem coolen Ort bin, sagen wir, in einer alten Kathedrale oder einer angesagten Eisdiele, poste ich das immer auf Facebook. Aber nicht hier. Teils, weil es Montagmorgen war und Clayton unsere Verabredung für diese Schießübung als „Arbeitstreffen“ eingetragen hatte, aber auch, weil ich keinen Ärger mit meinen Freunden oder Gemeindegliedern – fast alles Liberale – haben wollte, die mich bestimmt gefragt hätten, ob ich den Verstand verloren hätte oder von irgendwelchen Rednecks entführt worden sei.
Als wir den Schießstand betraten, dessen Fußboden mit Patronenhülsen übersät und mit einem schwarzen Gummibelag ausgelegt war, wurden mir mehrere wichtige Punkte bewusst. Erstens: Unsere Pistolen waren geladen, und wir beabsichtigten, die Papierzielscheibe vor uns zu zerstören. Zweitens: Ich sollte meinen Finger nur dann an den Abzug legen, wenn ich vorhatte, zu schießen. Drittens: Hinter meinem Ziel befand sich eine Wand aus Gummi und Beton. Und viertens: Ich schwitzte.
Ich hatte schon in meiner Nachbarschaft Schüsse gehört und wusste daher, dass Pistolen laut sind. Und aus Filmen wusste ich, dass es einen „Rückstoß“ gibt, wenn eine Schusswaffe abgefeuert wird. Aber heiliger Strohsack, ich hatte ja keine Ahnung, wie laut es tatsächlich war und wie es einen durchschüttelte, wenn man mit einer Pistole feuerte. Oder wie viel Spaß das macht.
Wir ballerten ungefähr eine Stunde lang, und als wir fertig waren, sagte mir Clayton, fürs erste Mal hätte ich meine Sache ziemlich gut gemacht. (Außer, als mir eine heiße Patronenhülse in den Ausschnitt fiel und ich so blindwütig herumzappelte, dass er meinen Arm packen und die geladene Pistole in meiner Hand wieder aufs Ziel richten musste, wobei ich mir natürlich wie ein Volltrottel vorkam. Ein ausgesprochen gefährlicher Volltrottel.)
Aber ich fand es herrlich. Ich fand es so herrlich wie eine Runde auf der Achterbahn oder mit dem Motorrad: nichts, was ich dauernd machen wollte, aber eine Aktivität, die ab und zu durchaus Spaß macht und mir das Gefühl gibt, lebendig und ein kleines bisschen lebensgefährlich zu sein.
„Können wir das nächste Mal Skeet schießen?“, fragte ich begierig, als wir uns an dem mit Tarnmuster bemalten Fronttresen unsere Ausweise abholten. Der ganze Laden sah aus wie ein Jagdunterstand. So, als ob die jungen Pickelgesichter, die dort arbeiten, eine Deckung brauchten, falls irgendetwas Gefährliches oder Schmackhaftes zur Tür hereinkam, damit sie es gefahrlos abknallen könnten.
Auf dem Weg zurück zu mir nach Hause schlug ich vor, anzuhalten und uns ein paar Papusas zu holen (gefüllte salvadorianische Maiskuchen), damit wir beide an diesem Montag eine neue Erfahrung machen würden.
Wir setzten uns auf zwei der fünf Hocker am Fenster bei Tacos Acapulco – mit Blick hinaus auf die Wechselstuben und die mexikanischen Panaderias am East Colfax Boulevard –, und ich nutzte die Gelegenheit, um eine Frage zu stellen, die mir unter den Nägeln brannte: „Sag mal, warum in aller Welt willst du die ganze Zeit eine Pistole mit dir herumtragen?“ Ich war noch nie bewusst einem Knarrenträger so nah gewesen und sah meine Chance, nach etwas zu fragen, worauf ich schon immer neugierig gewesen war. Ich konnte nur hoffen, dass er meine Frage nicht so empfand, wie es unsere schwarze Freundin Shayla empfindet, wenn Leute sie fragen, ob sie mal ihren Afro berühren dürfen.
Während er versuchte, mit seiner Gabel den geschmolzenen Käse zu bändigen, der sich partout nicht von der Papusas lösen lassen wollte, sagte er: „Um mich verteidigen zu können und aus Stolz auf mein Land. Wir haben dieses Recht, also sollten wir es auch ausüben. Und wenn jemand uns etwas tun wollte, während wir hier sitzen, könnte ich ihn unschädlich machen.“
Es war für mich eine völlig fremde Weltsicht: dass Leute bei jedem Schritt mit der Möglichkeit rechnen, dass jemand versuchen könnte, ihnen etwas anzutun, und sich deswegen eine Pistole umschnallen und damit durch Denver ziehen. Ich konnte das weder verstehen noch gutheißen. Aber Clayton ist nun mal mein konservativer Alibifreund. Ich kann ihn gut leiden, und schließlich hatte er sich die Mühe gemacht, mit mir auf den Schießstand zu gehen. Also beließ ich es dabei.
In derselben Woche, in der ich mit Clayton Schießen übte, feierten meine Mutter und meine Schwester ihren siebzigsten bzw. fünfzigsten Geburtstag. Es war ein Krimi-Dinner. So saß ich fünf Tage, nachdem ich auf dem Schießstand mit Clayton auf Papierzielscheiben geballert hatte, auf der Terrasse des Hauses meiner Eltern in einem Vorort von Denver und schlüpfte für ein ausgedachtes Drama in die Rolle einer Hippie-Winzerin. Normalerweise hält mich meine natürliche Misanthropie davon ab, an derlei peinlichem Unsinn teilzunehmen, aber bald fiel mir ein, wie oft ich mich schon freiwillig verkleidet und eine Rolle in anderen ausgedachten Dramen gespielt hatte, zu denen es noch nicht einmal ein Vier-Gänge-Menü oder nette Gesellschaft gab (wie etwa in dem Jahr, in dem ich versuchte, ein Deadhead zu sein). Also ließ ich mich zwei Frauen zuliebe, die mir sehr am Herzen liegen, auf das Krimi-Dinner ein. Für meine Rolle waren ein langer, weiter Rock, eine Trachtenbluse und Blumen im Haar vorgesehen – alles Sachen, die ich nicht besitze und nicht für Geld und gute Worte anziehen würde. Also mussten ein Nachthemd und jede Menge bunter Perlen genügen.
Den ganzen höchst vergnüglichen Abend über sah ich meine Mutter aus dem Mundwinkel mit meinem Bruder reden, so, wie sie es früher getan hatte, als wir noch klein waren, wenn sie meinem Vater etwas sagen wollte, was wir nicht mitbekommen sollten. Ich beobachtete meine Mutter und merkte gar nicht, wie sich am Rand der ausgedachten Geschichte, für die ich mir Blumen in meinen Stoppelhaarschnitt hätte stecken sollen, noch ein anderes, ungeschriebenes Drama abspielte.
Als ich mich einmal in die Küche schlich, um nach neuen Nachrichten auf meinem Handy zu schauen, folgte mir mein Vater, um mich darüber aufzuklären, was los war. Wie sich herausstellte, ging es bei dem Geflüster meiner Mutter aus dem Mundwinkel um eine ernste Sache. Meine Mutter hatte Drohungen von einer psychisch labilen (und angeblich bewaffneten) Frau bekommen, die ihr die Schuld an einem Verlust gab, den sie erlitten hatte. Meine Mutter hatte mit diesem Verlust überhaupt nichts zu tun, aber das hielt diese Frau nicht davon ab, ihr die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben. Und sie wusste, wo meine Mutter sonntags in den Gottesdienst ging.
„Dadurch ist es jetzt immer ziemlich stressig für uns, in der Gemeinde zu sein“, sagte mir mein Vater.
Mein älterer Bruder Gary, der Vollzugsbeamter in einem Bundesgefängnis ist und mit seiner Frau und seinen drei Kindern in dieselbe Gemeinde geht wie meine Eltern, kam in der Küche an meinem Vater und mir vorbei und sagte: „Furchtbar, oder? Ich gehe seit drei Wochen mit einer Waffe unter der Jacke in den Gottesdienst, für den Fall, dass sie auftaucht und irgendetwas versucht.“
Sofort musste ich an Clayton und seine Weltsicht denken, die mir bisher so fremd gewesen war. Jetzt war ich plötzlich instinktiv froh, dass mein Bruder gewappnet war für den Fall, dass eine Verrückte versuchte, unserer Mutter etwas anzutun. Gleichzeitig kam es mir wie der schiere Wahnsinn vor, dass ich froh darüber war, dass jemand eine Schusswaffe mit in den Gottesdienst nahm. Aber so ist das mit meinen Wertvorstellungen: Manchmal stoßen sie mit der Wirklichkeit zusammen, und wenn das passiert, kann es sein, dass ich sie über Bord werfen muss. Oder aber ich ignoriere die Wirklichkeit. Bei mir sind es meistens eher die Wertvorstellungen, die weichen müssen.
Meine Bauchreaktion auf die Bewaffnung meines Bruders erschreckte mich, aber das war noch gar nichts dagegen, wie sie mich am nächsten Morgen erschrecken würde.
Am Abend der Geburtstagsparty hatte ich nicht mitbekommen, wie durch die Nachrichten ging, dass George Zimmerman, der den unbewaffneten Teenager Trayvon Martin erschossen hatte, in allen Anklagepunkten freigesprochen worden war. Über ein Jahr lang hatte dieser Fall heftige Debatten über Rassismus und das in Florida geltende Notwehrgesetz ausgelöst, das jedem, der glaubt, sein Leben sei in Gefahr, die Anwendung von Gewalt erlaubt.
In meinem Facebook-Feed hagelte es Proteste, Empörung und Schimpftiraden. Am liebsten hätte ich eingestimmt und in jener Woche meine Stimme für Gewaltlosigkeit erhoben, aber als ich im Radio hörte, der Bruder von George Zimmerman habe gesagt, Trayvon Martin sei seiner Meinung nach überhaupt nicht unbewaffnet gewesen, Martins Waffe sei ja der Bürgersteig gewesen, mit dem er George die Nase gebrochen habe – nun, als ich das hörte, war meine erste Reaktion nicht Gewaltlosigkeit, sondern ein überwältigender Impuls, mir den Mann durchs Radio hindurch zu schnappen und ihn mit einem Handkantenschlag gegen den Kehlkopf flachzulegen.
Dazu kam, dass ich gerade in dieser Woche Dankbarkeit darüber empfunden hatte, dass ein Bundesbeamter im Justizvollzug jede Woche, wenn er den Gottesdienst in der Gemeinde meiner Mutter besuchte, eine Waffe unter seiner Kleidung verborgen trug. Eigentlich ein Wahnsinn. Normalerweise würde ich über so etwas eine empörte Statusmeldung auf Facebook posten, damit all die Liberalen da draußen, die so denken wie ich, auf „Gefällt mir“ klicken können. Nur dass in diesem Fall der betreffende Justizvollzugsbeamte a) mein Bruder war und b) diese Waffe bei sich trug, um seine (meine) Familie, seine (meine) Mutter vor einer Verrückten zu beschützen, die sie umbringen wollte. Als ich hörte, dass mein Bruder bewaffnet war, um meine eigene Mutter zu beschützen, war ich darüber nicht aufgebracht, wie es sich für eine gute, für schärfere Waffengesetze eintretende Pastorin gehört … ich war erleichtert. Und was soll ich jetzt auf Facebook posten? Was fange ich damit an?
Außerdem musste ich mich damit auseinandersetzen, dass mir meine eigene antirassistische Empörung im Hals stecken blieb, da ich etwas wusste, was niemand sonst wissen konnte, wenn ich es nicht laut aussprach: All meiner liberalen politischen Einstellung zum Trotz ist mir, wenn in meiner Nachbarschaft eine Gruppe junger schwarzer Männer an mir vorbeigeht, instinktiv mulmiger zumute, als es der Fall wäre, wenn diese Männer weiß wären. Mir ist das selbst zuwider, aber wenn ich behaupten würde, in mir stecke überhaupt kein Rest von Rassismus mehr, würde ich lügen. Dieser Rassismus ist mir vierundvierzig Jahre lang durch die Medien und durch die Kultur um mich her eingetrichtert worden, und ich weiß einfach nicht, wie ich ihm entrinnen soll. Auch wenn ich einen Anti-Rassismus-Aufkleber auf dem Auto habe.
Als ich am Morgen nach dem George-Zimmerman-Urteil überlegte, was ich meiner Gemeinde darüber sagen sollte, drängte es mich, meine Stimme für Gewaltlosigkeit, Antirassismus und schärfere Waffengesetze zu erheben, wie ich es für meine Pflicht hielt (oder wie ich es die Leute bei Twitter fordern sah: „Wenn dein Pastor diese Woche nicht über Waffengesetze und Rassismus predigt, such dir eine neue Gemeinde“) – aber ich konnte nur in der Küche stehen und heulen. Ich heulte über meine eigene Inkonsequenz. Über Andrea Gutiérrez, Mitglied meiner Gemeinde und Mutter von zwei Kindern, die mir sagte, Mütter von Kindern mit brauner und schwarzer Haut hätten jetzt das Gefühl, ihre Kinder könnten auf den Vorstadtstraßen ganz legal als Zielscheiben für Schießübungen benutzt werden. Über ein gespaltenes Land, in dem zwei Seiten sich gegenseitig mit erbittertem Hass bekämpften. Darüber, dass ich insgeheim die Dinge, die ich kritisiere, selbst noch nicht überwunden habe. Über die Morddrohungen gegen meine Familie und die Morddrohungen gegen die Familie Zimmerman. Über Tracy Martin und Sybrina Fulton, deren Kind erschossen wurde und denen man nun sagte, das sei mehr seine eigene Schuld als die Schuld des Schützen gewesen.
Wenige Augenblicke, nachdem ich von dem Freispruch gehört hatte, ging ich mit meinem Hund nach draußen und rief Duffy an, eine ausgesprochen besonnene Frau aus meiner Gemeinde. „Ich bin wirklich total durcheinander über die ganze Geschichte“, sagte ich und schilderte ihr dann all die Gründe, wieso ich mich, obwohl ich in diesen Fragen ganz klare Überzeugungen habe, nicht hinstellen und glaubwürdig meinen Standpunkt gegen Gewalt und Rassismus vertreten konnte – nicht, weil ich nicht mehr daran glaubte, dass man dagegen Stellung beziehen muss (das tue ich), sondern weil in meinem eigenen Leben und in meinem eigenen Herzen zu viel Zweideutigkeit steckt. In mir gibt es sowohl Gewalt als auch Gewaltlosigkeit, und doch glaube ich nur an eines davon. Duffy meinte, vielleicht ging es ja anderen genauso. Vielleicht erwarten die Leute von ihrer Pastorin ja nicht die moralische Entrüstung und die Schimpftiraden, die sie ohnehin schon auf Facebook sehen. Vielleicht könne ich ihnen ja gerade dadurch helfen, dass ich mich zu meiner niederschmetternden Inkonsequenz bekenne, damit sie sich auch zu ihrer bekennen können.
Bei dem Gedanken lief es mir kalt den Rücken hinunter, aber ich wusste, dass sie recht hatte.
In der Kirche wird man als Pastorin oder „geistliche Leiterin“ oft als Vorbild für ein „gottgefälliges Leben“ gesehen. Eine Pastorin oder ein Pastor soll jemand sein, der diese Sache mit dem Christentum aus dem Effeff beherrscht – jemand, zu dem andere aufblicken können wie zu einem Paradebeispiel der Rechtschaffenheit. Aber so verlockend es sich manchmal anfühlen kann, diejenige zu sein, die die beste Christin ist, die am engsten „Jesus nachfolgt“, diesen Schuh konnte ich mir einfach noch nie anziehen, und das ist es auch nicht, was meine Gemeindeglieder von mir brauchen. Ich renne nicht Jesus nach. Jesus ist mir auf den Fersen. Ja, ich bin eine Leiterin, aber ich leite die Leute doch nur hinaus auf die Straße, wo sie dann von dem rasenden Bus der Beichte und Absolution, der Sünden und der Heiligung, des Todes und der Auferstehung erfasst werden – von dem Evangelium Jesu Christi. Ich bin eine Leiterin, aber nur dadurch, dass ich sage: „Ach, scheiß drauf. Ich gehe als Erste.“
Am nächsten Tag stand ich im rötlichen Abendlicht in dem Gemeindesaal, in dem sich das House for All Sinners and Saints versammelt, und gestand all dies meiner Gemeinde. Ich sagte ihnen, dass ich aus einer Million Gründen gerne eine prophetische Stimme für Veränderung wäre, aber jedes Mal, wenn ich es versuche, steht mir meine eigene Verkorkstheit dabei im Weg. Ich sagte ihnen, dass ich nicht als Vorbild für irgendetwas tauge, außer dafür, auf Jesus angewiesen zu sein.
Als ich zum ersten Mal eingeladen wurde, auf dem Festival of Homiletics, einer landesweiten Predigerkonferenz, einen Vortrag übers Predigen zu halten, sollte ich darüber sprechen, wie im House for All Sinners and Saints gepredigt wird. Ich wusste nicht recht, was ich dazu sagen sollte. Also fragte ich meine Gemeinde. Ihre Antworten waren voller Leidenschaft, aber keine davon hatte damit zu tun, wie toll sie es fänden, dass ihre Predigerin so ein großartiges Vorbild für sie sei. Nicht einer sagte, er sei begeistert von all den praktischen Lebenstipps in den Predigten, wie man an seiner Ehe arbeiten und sie stärken könne. Dagegen sagten fast alle, sie fänden es schön, dass ihre Predigerin ganz offensichtlich genau die Worte verkündigt, die sie selbst braucht, und alle anderen einfach dabei mithören lässt.
Mein Freund Tullian drückt es so aus: „Die am besten qualifizierten Leute, um das Evangelium zu verkündigen, sind diejenigen, die wirklich wissen, wie unqualifiziert sie dafür sind, das Evangelium zu verkündigen.“
Jesus hat nie seinen Blick durch den Raum schweifen lassen, um das beste Vorbild für einen heiligen Lebenswandel zu finden und diese Person dann auszusenden, damit sie anderen von ihm erzählt. Er hat immer die Strauchler und die Sünder geschickt. Das tröstet mich.