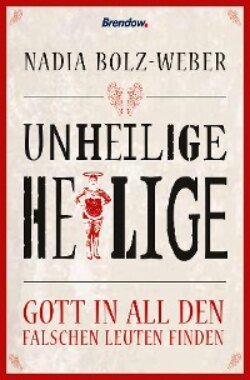Читать книгу Unheilige Heilige - Nadia Bolz-Weber - Страница 8
Heiligenplätzchen für Sünder
ОглавлениеIn der Frühzeit des House for All Sinners and Saints entstand bei uns die Tradition, zu Allerheiligen „Heiligenkekse“ zu backen.2 Wir begingen den Brauch zum ersten Mal am 1. November. Wir läuten eine Glocke für jeden geliebten Menschen, der seit dem letzten Allerheiligenfest gestorben ist, und wir, die Heiligen, die noch auf der Erde sind, ehren all jene, die auch Heilige genannt werden und schon von diesem Leben in das künftige übergegangen sind.
Schon damals, ganz am Anfang, zog es uns zu den uralten Bräuchen der Kirche hin, wie dem Verbrennen von Palmzweigen am Palmsonntag, um die Asche dann am folgenden Aschermittwoch zu verwenden, dem Vergraben der Halleluja-Fahnen am Fest der Verklärung oder dem Singen des Trisagion am Karfreitag.
In jenem ersten Jahr stöberte ich im Internet nach alten oder merkwürdigen Bräuchen rund um Allerheiligen. Ich bin mir sicher, dass ich dabei irgendwo las, wie die Leute in Finnland oder so Heiligenplätzchen backen – kleine Lebkuchen-Männer und -Frauen, die dann im Rahmen der Allerheiligen-Feier verteilt werden. Ich schwöre, so habe ich es in Erinnerung.
Also versammelten sich damals, als wir dabei waren, uns unsere Kirchengemeinde zurechtzubacken, ein paar Leute in meiner Küche, um Lebkuchenfiguren zu backen, in der Meinung, das wäre so üblich.
Irgendwann merkte ich, dass unseren kleinen braunen Heiligenplätzchen etwas fehlte – Heiligenscheine natürlich. Also bemalten wir die runden Köpfe unserer Lebkuchenfiguren mit einem Kranz aus leuchtend gelber Glasur (wodurch sie weniger heilig als vielmehr blond aussahen).
„Wie wär’s mit denen hier?“, fragte Victoria, als sie dazukam, und hielt zwei besonders große Plätzchenformen hoch. Für eine Sozialarbeiterin hatte sie schon immer eine ziemliche Neigung zum Unfug gehabt. Es muss wohl an den roten Haaren liegen. Ehe der Abend vorbei war, zeigte Victoria stolz zwei ganz besondere Heiligenplätzchen vor, die ihre Artgenossen um Haupteslänge überragten. Das eine, eine Frau, trug einen Rock, der von roten und gelben Flammen umzingelt war. Außerdem hatte sie riesige Augen und einen kreisrund geöffneten roten Mund.
„Die heilige Johanna?“, tippte ich zutreffend. Gleich neben Johanna lag ihr Mitheiliger, und der sah aus, als trüge er ein gegürtetes Fell mit einem Schulterträger wie ein Höhlenmensch. Außerdem fehlte ihm der Kopf. „Fred Feuerstein, der Märtyrer?“, riet ich, doch diesmal lag ich falsch.
„Johannes der Täufer“, sagte sie stolz. Natürlich. Victoria erbot sich, den Korb mit den fertigen Heiligenplätzchen am nächsten Tag mitzubringen, um sie nach dem Gottesdienst zu verteilen. Erwartungsgemäß stellte sich heraus, dass sie sich wunderbar dafür eigneten, ein wenig Heiterkeit in eine ansonsten schwermütige Liturgie hineinzubringen.
Inzwischen wissen wir, dass es die Tradition der Heiligenplätzchen nirgendwo gibt außer im House for All Sinners and Saints – zumindest konnte ich nirgends etwas davon finden, als ich später noch einmal im Internet nachschaute. Offenbar hatte ich den ganzen Blödsinn nur geträumt.
Victorias Korb mit Heiligenplätzchen stand ganz am Ende einer langen Reihe weißgedeckter Tische an der Wand, die eine anschauliche Darstellung der Allerheiligenlitanei waren, eines liturgischen Gesangs, bei dem die Namen von Heiligen (entweder eine Liste, die von der Gemeinde aufgestellt wird, oder eine vorgegebene Reihe bekannter Namen) ehrfürchtig gesungen werden, um Gott für die Glaubenshelden zu danken, die uns vorausgegangen sind. Auf jedem Tisch befanden sich Kerzen, Ringelblumen und verschiedene Gegenstände, die an die Toten erinnerten: der abgetragene Overall eines Großvaters, der Bauer gewesen war. Eine Ikone von Maria Magdalena. Eine Ikone von Cesar Chávez. Ein Foto von einer Gruppe von Freunden aus den Achtzigern. Die Krabbeldecke eines Kindes. Ein Schrein, den mein Gemeindeglied Amy Clifford für Vincent van Gogh angefertigt hatte – ein kleines, aufrecht stehendes bemaltes Kästchen, in das sie sein Selbstporträt hineingeklebt hatte. Außen waren zwei Ohren angeklebt. An einem davon fehlte ein Stück.
Abgesehen von denen, die im Krieg gefallen sind, neigen wir Amerikaner dazu, unsere Vorfahren zu vergessen, und wir verbringen so wenig Zeit wie möglich damit, öffentlich um sie zu trauern. Doch in der Kirche tun wir etwas ganz Seltsames: Wir verkündigen, dass die Toten immer noch ein Teil von uns sind, ein Teil unseres Lebens, ja, dass sie sogar eine belebende Präsenz in der Gemeinde sind. Der Apostel Paulus bezeichnet die Heiligen als „eine große Wolke von Zeugen“. Auch wenn sie von uns gegangen sind, halten wir sie immer noch in Ehren und hoffen vielleicht, dass ihre Tugenden – ihre Fähigkeit, im Angesicht eines bedrückenden Regimes, einer verlorenen Ernte oder der Geißel des Krebses, auf Gott zu vertrauen – uns selbst Tugendhaftigkeit und Kraft geben mögen.
Zwei Monate zuvor war ich mit einer Frau aus meiner Gemeinde, Amy Clifford, die Sherman Street in Denver entlanggegangen. Amy ist eine intelligente, leidenschaftliche Frau mit viel Sinn für Kunst, die immer an meiner Seite gewesen war und mitgeholfen hatte, unsere Gemeinde aufzubauen. Bei unserem Spaziergang damals war uns eine Art Denkmal im Hof einer großen, seltsam aussehenden Kirche gegenüber dem Regierungssitz des Staates Colorado aufgefallen.
Das Dach der „Pillar of Fire Church“ ist gekrönt von einem riesigen Logo aus den pinkfarbenen Buchstaben KPOF, die nachts leuchten und das Ganze so aussehen lassen wie das, was es ist: eine Pfingstkirche, die gleichzeitig ein Radiosender ist.
Wir kniffen die Augen zusammen, um die Inschrift auf dem Denkmal zu lesen: „Alma White, Gründerin der Pillar of Fire Church, 1901“. Ich drehte mich zu Amy um und sagte: „Alma? Das ist doch ein Frauenname, oder? Hat etwa eine Frau 1901 in Denver eine Gemeinde gegründet?“
Ich kannte nicht viele Frauen, die sich ganz allein darangemacht hatten, eine Gemeinde zu gründen, und schon gar nicht an der Schwelle zum zwanzigsten Jahrhundert. Insofern konnte ich dringend jemanden brauchen, den ich in die Kategorie „Heldin“ und „Vorbild“ einsortieren konnte (da ich mich auch gerade daranmachte, die weibliche Pastorin einer neuen Gemeinde in Denver zu sein). Also holte ich mein Telefon hervor und googelte Alma White. Meine Begeisterung darüber, eine Heldin entdeckt zu haben, stieg noch mehr, als ich ihren Wikipedia-Eintrag las: „Alma Bridwell White (geboren 1862 – gestorben 1946) war die Gründerin und ‚Bischöfin‘ der Pillar of Fire Church. (Nicht zu fassen! Es stimmt tatsächlich!) 1918 wurde sie die erste ‚weibliche Bischöfin‘ in den Vereinigten Staaten. Sie war bekannt für ihren Feminismus (Ja!) und ihre Verbindung zum (jetzt kommt es …) Ku-Klux-Klan in New Jersey, ihren Anti-Katholizismus, Antisemitismus, Rassismus und ihre Feindseligkeit gegenüber Immigranten.“
Am nächsten Tag rief ich meine Freundin Sara an, die zur Episkopalkirche gehört, und erzählte ihr, wie ich gedacht hatte, ich hätte eine Heldin gefunden, nur, um dann herauszufinden, dass sie nur eine bescheuerte Rassistin war. Saras Antwort? „Schick mir per Mail ihren Namen. Ich setze ihn auf die Heiligenlitanei, zusammen mit allen anderen kaputten Typen Gottes.“
Aber ich wollte Alma White nicht auf der Heiligenlitanei stehen haben. Die Vorstellung fühlte sich falsch an, dass ihr Name dort auf dem Tisch läge, beleuchtet von der Passakerze2 daneben, zusammen mit den Namen des heiligen Franziskus und Cesar Chávez´. Ich will, dass Rassisten in ihrer „Rassistenschublade“ bleiben. Wenn sie anfangen, sich in die „Heiligenschublade“ hinüberzuschleichen, macht mich das nervös. Aber so läuft das nun einmal. An Allerheiligen bekomme ich es mit kniffligen Widersprüchlichkeiten zu tun, mit Heiligen, die böse waren, und Sündern, die gut waren.
Ich persönlich finde es irgendwie wichtig, den Unterschied zwischen einem Rassisten und einem Heiligen zu kennen. Aber wenn Jesus immer wieder so Sachen sagt wie, die Letzten werden die Ersten sein, und die Ersten werden die Letzten sein, und die Armen sind glücklich, und die Reichen sind verflucht, und Prostituierte sind willkommene Gäste beim Abendessen, dann muss ich mich fragen, ob unser Bedürfnis danach, Schwarz und Weiß säuberlich voneinander zu trennen, vielleicht gar nicht dem Glauben entspricht, sondern sogar eine Sünde ist. Wenn wir wissen, in welche Kategorie Schierling gehört, dann hilft uns das sicher, zu entscheiden, ob wir gefahrlos davon trinken können oder nicht. Aber zu wissen, in welche Kategorie wir uns selbst und andere einsortieren sollten, hilft uns überhaupt nicht dabei, Gott so gut kennenzulernen, wie die Kirche ihn oft zu kennen behauptet.
Und überhaupt habe ich die Erfahrung gemacht, dass nicht unsere eigene Fähigkeit, heilig zu leben, uns zu den Heiligen Gottes macht, sondern Gottes Fähigkeit, durch Sünder zu wirken. Der Titel „Heiliger“ wird immer verliehen, niemals verdient. Oder um es mit dem Apostel Paulus zu sagen: „Denn Gott ist’s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen“ (Philipper 2,13). Mir ist klar geworden, dass alle Heiligen, denen ich je begegnet bin, aus Versehen dazu geworden waren. Es sind Leute, die unversehens in die Erlösung hineinstolpern, so als wären sie gerade auf der Suche nach etwas ganz anderem gewesen. Leute, die ein kleines Problemchen mit dem Alkohol haben und es schaffen, nüchtern zu werden, und dann anderen dabei helfen, es ebenso zu schaffen. Leute, die gleichermaßen freundlich und feindselig sind.
Neben Alma befand sich auf unserem Allerheiligen-Tisch eine Ikone von einem anderen zufälligen Heiligen: Harvey Milk. Er wurde als erste Person, die sich zu ihrem Schwulsein bekannte, in Kalifornien in ein öffentliches Amt gewählt und 1978 von einem anderen städtischen Beamten erschossen. Auf unserer Ikone hatte Harvey Milk fünf silberne Einschusslöcher in der Brust und stand mit einem goldenen Heiligenschein auf dem Kopf vor der Golden-Gate-Brücke. Ein Künstler aus unserer Gemeinde, Bill McConnell, hatte die Ikone gestaltet. Später rief er mich an, weil jemand ihn zur Rede gestellt hatte, weil er eine christliche Heiligendarstellung von jemandem geschaffen hatte, der gar kein Christ war.
Ich erklärte Bill, dass wir die Heiligen nicht wegen ihrer Frömmigkeit oder Vollkommenheit feiern, sondern weil wir an einen Gott glauben, der in dieser Welt rettende und heilige Taten ausgerechnet durch Menschen vollbringen lässt, die allesamt mit Fehlern behaftet sind.
Daran glaube ich wirklich. Und doch konnte ich, nachdem ich aufgelegt hatte, an nichts anderes denken als daran, wie schwer es mir fällt, zu glauben, dass das, was für Alma White oder Harvey Milk gilt, auch für mich gelten könnte – dass Gott mich vielleicht gebrauchen kann, obwohl ich doch in so vieler Hinsicht für die Arbeit, die ich tue, völlig ungeeignet bin.
Doch das ist meine Erfahrung. Ich mache immer wieder Fehler, sogar immer wieder dieselben. Ständig versuche ich (vergeblich), mir Gott und meine Mitmenschen auf Armeslänge vom Leib zu halten. Ich sage nein, wenn ich ja sagen sollte. Ich sage ja, wenn ich nein sagen sollte. Ich platze in heilige Momente hinein und merke gar nicht, wo ich bin, bis sie vorbei sind. Es fällt mir schwer, anderen Liebe zu zeigen, und dann sage ich aus Versehen das Richtige im richtigen Moment, ohne es zu merken. Ich vergesse, worauf es ankommt, und zeige wieder Freundlichkeit, wenn sie gebraucht wird, um dann erneut allzu oft auf dem Absatz kehrtzumachen und nur an mich selbst zu denken.
Ich bin und bleibe einfach ein Mensch, an dem Gott arbeitet. Und um ehrlich zu sein, ich bemühe mich nicht einmal darum. Ich bewundere Leute, die sich „geistlichen Übungen“ unterziehen, die durch Yoga oder Meditation oder Stille Zeit für ihr Wohlbefinden sorgen, aber außer dass ich jeden Morgen im Fitnessstudio richtig schwere Gewichte pumpe, fallen mir ehrlich gesagt keine Übungen ein, die ich mache, um geistlicher zu werden. Allerdings kann ich endlos davon erzählen, wie ich durch die Bibel, die kirchlichen Bräuche und das Volk Gottes – kurz, durch den Glauben – immer wieder auf den Pott gesetzt werde.
Kürzlich fragte mich ein junger Seminarstudent während einer Fragestunde: „Pastorin Nadia, was tun Sie persönlich, um Gott näher zu kommen?“
Bevor ich selbst merkte, was ich da sagte, erwiderte ich: „Was? Nichts. Kommt mir vor wie ein schauderhafter Gedanke, Gott näher kommen zu wollen.“ Oft wäre es mir am liebsten, er würde mich in Ruhe lassen. Gott näher kommen, das könnte ja bedeuten, dass er mir aufträgt, jemanden zu lieben, den ich überhaupt nicht leiden kann, oder noch mehr von meinem Geld abzugeben. Es könnte ja bedeuten, dass mir irgendein lieb gewordener Gedanke oder Traum weggerissen wird.
Mein geistliches Leben ist besonders in solchen Momenten aktiv, in denen ich merke, dass Gott vielleicht durch mich etwas Schönes vollbracht hat, obwohl ich ein Arschloch bin. In Momenten, in denen mir die Barmherzigkeit des Evangeliums so sehr vor Augen steht, dass ich meine Feinde nicht hassen kann, und in denen ich unfähig bin, die Sünde eines anderen Menschen zu verurteilen (was ich, ehrlich gesagt, liebend gern tue), weil mir mein eigener Mist zu sehr bewusst ist. In Momenten, in denen ich Zeugin des Leides eines anderen Menschen werden muss, trotz meines Verlangens, in Ruhe gelassen zu werden. In Momenten, in denen andere Menschen mir vergeben, obwohl ich es nicht verdiene, und in denen diese Anderen das tun, weil auch sie vom Evangelium gefangen sind. In Momenten, in denen in der Welt verheerende, traumatische Dinge geschehen, die ich nirgendwo einsortieren und auf die ich mir keinen Reim machen kann. Es ist gut, dass ich dann eine Gruppe von Leuten habe, die sich jede Woche mit mir trifft, damit wir in diesem Raum Worte sprechen, um unsere gemeinsame Trauer über ein Unheil wie eine Schießerei in einer Schule auszudrücken und dafür zu beten. In Momenten, in denen ich dadurch verändert werde, dass ich lerne, jemanden zu lieben, den ich mir nie aus einem Katalog aussuchen würde, den Gott mir aber über den Weg schickt, damit ich seine Liebe besser kennenlerne. Doch nichts von alledem ist das Ergebnis geistlicher Bräuche oder Übungen, so bewundernswert solche Dinge auch sein können. Sie werden aus einem Leben des Glaubens heraus geboren, einem Leben, das von Riten und von Gemeinschaft eingerahmt ist, von Wiederholung, von Arbeit, von Geben und Nehmen, von der Pflicht zur Barmherzigkeit.
All das spiegelt sich in unserer Praxis im House for All Sinners and Saints wider. Stephen, ein Mann aus meiner Gemeinde, drückt es so aus: „Unser ‚Dienst‘ besteht aus Wort und Sakrament – alles andere entspringt daraus. Wir sehen ein Bedürfnis; wir erfüllen es. Wir bauen Mist; wir sagen, es tut uns leid. Wir bitten um Gnade und Fürbitte, wenn wir sie brauchen (fast dauernd). Jesus begegnet uns durch uns gegenseitig. Wir essen, wir beten, wir singen, wir fallen hin, wir stehen wieder auf und dann wieder von vorn. Gar nicht so kompliziert.“
Es gibt viele Gründe, sich vom Christentum fernzuhalten. Keine Frage. Ich kann es total verstehen, wenn Leute sich so entscheiden. Das Christentum hat unsägliche Abscheulichkeiten durchgemacht: die Kreuzzüge, Sexskandale bei Geistlichen, Korruption im Vatikan, betrügerische Fernsehprediger und Clowns auf der Kanzel. Aber es wird auch uns überleben. Es wird unsere Fehler überleben, unseren Stolz und unser ausgrenzendes Verhalten gegenüber anderen. Ich glaube, dass die Kraft des Christentums nicht unterzukriegen ist – das, was die allerersten Jünger dazu brachte, ihre Netze niederzulegen und alles Vertraute hinter sich zu lassen, das, was Maria Magdalena dazu brachte, vom Grab zurückzukehren und den auferstandenen Christus zu verkündigen, das, wofür die frühen Christen sich zu Märtyrern machen ließen, und was mich bis heute bei Jesus hält (oder bei der „Arbeit für die Firma“, wie es mein Freund Paul, ein Priester der Episkopalkirche, nennt). Die Kraft der grenzenlosen Gnade, die Kraft des Evangeliums, wie wir es nennen, lässt sich nicht durch Korruption und grinsende Fernsehprediger zerstören. Denn schließlich ist Jesus immer noch da.
Und ich kann Jesus nicht abschütteln, obwohl ich es schon versucht habe. Das Evangelium, diese Geschichte von einem Gott, der durch Jesus zu uns gekommen ist, der uns grenzenlos liebt und uns rückhaltlos vergibt und sagt, dass wir die Kraft haben, das Gleiche zu tun, lässt sich nicht zerstören durch all die blöden Fehler, von denen du in den folgenden Kapiteln lesen wirst. Es sind meine Fehler, meine Sünden und mein Versagen, aber vielleicht sind es auch unsere. Und auch die Erlösung ist unsere. Denn wenn Alma White das Licht nicht zerstören kann, das in ihre Dunkelheit hineinleuchtet, dann können wir es vielleicht auch nicht.
Auf diesem Allerheiligen-Tisch, zwischen dem Korb mit den Heiligenplätzchen und der Karte mit dem Namen von Alma White, stellten wir unsere erste Passakerze auf, die wir kürzlich in der katholischen Buchhandlung erstanden hatten. Während der Osterwache und immer wieder während des kommenden Jahres würden wir sie verwenden, um die Gegenwart Christi in unserer Mitte zu symbolisieren.
In jenem Jahr war die Kerze neu und weiß. Doch seither hat Victoria jedes Jahr unsere Passakerze aus den Überresten all der Kerzen hergestellt, die in den Gottesdiensten der vorausgegangenen Monate verwendet worden waren, sodass die Kerze in unserer Mitte, genau wie unsere Gemeinde selbst, jede Menge schöner Unvollkommenheiten an sich hat. Das Bienenwachs ist glatt und golden, aber durchsetzt mit kleinen verbrannten Dochtresten und Verunreinigungen. Wie die heruntergebrannten Überreste unserer eigenen Geschichten, die wir mit uns herumschleppen, und wie die unvollkommenen Stücke unserer Menschlichkeit, die der göttlichen Liebe, die wir auch in uns tragen, ihre Maserung geben.
Wir werden eingeschmolzen und neu geformt, aber die verbrannten Stücke bleiben.