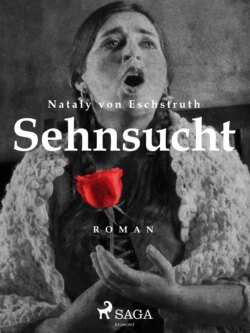Читать книгу Sehnsucht - Nataly von Eschstruth - Страница 5
Zweites Kapitel
ОглавлениеAls Klaus Raßmussens Tochter die köstlich duftende Suppe für den Kranken hereintrug, hatte man seinen Koffer und die lederne Handtasche, die er in der Postkutsche mit sich geführt hatte, ins Zimmer gebracht, und der Gutsherr probierte den Sicherheitsschlüssel, den ihm der Fremde aus dem Portemonnaie gereicht hatte, um die Tasche zu öffnen.
Der erste Blick Ebbas galt den schlanken, vornehmen Händen ihres Gastes.
Ein tiefes Aufatmen hob ihre Brust. Gottlob, er trug keinen Ring am Finger, der Roman brauchte nicht als Drama zu enden.
»So, hier ists offen! Soll ich Ihnen etwas reichen, mein Herr?«
Der Reisende richtete sich ein wenig im Bett empor. »Das Portefeuille, bitte! Oh, ich danke verbindlich! Ich möchte nicht versäumen, mich Ihnen vorzustellen, damit Sie wissen, wen Sie so freundlich unter Ihre Obhut genommen haben. Ich bin ein Graf von Giöreczy, komme aus Ungarn, wo ich Unterleutnant im Regiment der Honved gewesen bin. Hier meine Karte, gnädiges Fräulein, ich küsse die Hand. Sprechen Sie Französisch? Ich bin in Frankreich erzogen, da meine Mutter dort starb und mich zurückließ.«
Ebba hatte sich gerade über den Sprecher geneigt, um die Suppentasse zum Trunk bereitzuhalten; bei den Worten »ich bin ein Graf von Giöreczy« zuckte sie aber derart zusammen, daß das Porzellan der Tassen leicht klirrte.
Alles Blut stieg ihr zu Kopf, sie fühlte, wie sie erglühte, und dunkle Schatten flirrten ihr vor den Augen.
Kaum daß sie vermochte, den Kopf des Kranken zu stützen.
»Ah, ein Ungar und in Frankreich groß geworden?« Das klang etwas gedehnt von Klaus Raßmussens Lippen. »Da haben Sie wohl gar den Krieg anno siebzig mitgemacht?«
Der junge Offizier sah ihn überrascht, beinah etwas betroffen an, dann nickte er. »Ich war sehr jung, verheißener Kriegsruhm reizte mich. Man packte mich in Uniform, ehe ich selber recht wußte, was es heißen will, eine solche Feuerprobe zu bestehen.«
Der Friese schob den Ärmel an seiner Düffeljoppe empor. »Da, sehen Sie noch den Säbelhieb? Ein Andenken an Epinal!«
»Ich beglückwünsche Sie zu diesem Zeichen des Heldenmuts«, lächelte der Graf sehr verbindlich. »Sie haben mit diesem Arm den Lorbeer gepflückt, ich griff nur vergeblich danach!«
»Und Sie kommen nach Deutschland herüber?« fuhr der Gutsherr, sich leicht räuspernd, fort, ein wenig unsicher und unbeholfen der gewandten Art des jungen Kavaliers gegenüber.
Er hatte die Franzosen seit dem Feldzug gehaßt und nie ein Hehl daraus gemacht. Auch jetzt hätte er gern ein grimmiges Wort hervorgestoßen, daß er zwei Brüder und einen Vetter vor Metz auf dem Feld der Ehre geopfert hatte, aber er war doch wieder zu gebildet und zu gutmütig, einen Kranken, den der Zufall ihm ins Haus getragen hatte, zu beleidigen.
»Ja, ich kam nach Deutschland, weil mir Land und Leute hier sehr sympathisch sind«, versicherte der Reiteroffizier abermals mit verbindlichstem Ausdruck, und sein Blick traf dabei Ebba, als wollte er stumm hinzufügen: »Vor allen Dingen die deutschen Damen.«
»So, das freut mich«, nickte Klaus Raßmussen besänftigt und drehte die Visitenkarte zwischen den derben, schwieligen Händen. »Ich denke, der Doktor kommt gleich. Bis dahin lassen Sie den kalten Umschlag auf dem Bein liegen. Ich verstehe mich noch vom Lazarett darauf. Das verhindert die Geschwulst. Nach einer kleinen Weile komme ich wieder und mache ihn frisch. Können Sie allein die Tasse halten? Geht schlecht? Na, dann halt sie ihm an die Lippen, Ebba, und machs hübsch geschickt, der Herr leidet Schmerzen!«
Er stampfte zur Tür, wandte sich auf der Schwelle noch einmal um und sagte: »Mit dem Gepäck stimmt es doch? Oder fehlt etwa noch ein Stück? Hat sich alles kunterbunt im Graben herumgetrieben.«
»Ich danke Ihnen, mein Herr! Es stimmt, ich führte nur Handgepäck mit mir.«
Der blonde Riese nickte und verschwand hinter der Tür. In Ebbas Hand aber zitterte die Tasse, und sie atmete wie im Traum.
»Sie sind so gut«, lächelte der Graf von Giöreczy ihr zu, »ich möchte Ihnen auch sagen, daß Sie sehr schön sind, aber ich denke, das wissen die Damen ganz von allein.«
Beinah erschrocken blickten ihn die großen, veilchenblauen Augen an, und als sie dem sprühenden Blick des jungen Offiziers begegneten, senkten sich die Wimpern tief herab.
»Leiden Sie Schmerzen?« stieß sie kurz hervor, um doch etwas zu sagen.
Er lächelte und beobachtete als Kenner ihre holde Verlegenheit.
»Ja, meine Gnädige, das Bein schmerzt, aber ich bin hart und Derartiges gewöhnt.«
»Ob es wohl gebrochen ist?« fuhr sie fort und wußte selber nicht, was sie eigentlich sprach.
»Ich hoffe es!«
»Sie hoffen es?«
Da huschte wieder das seltsame Lächeln über sein schönes Gesicht.
»Gewiß! In diesem Fall kann ich nicht so schnell in die Stadt gebracht werden und darf mich noch länger an dem Anblick der reizendsten aller Samariterinnen erfreuen.«
Sie wollte die Schale heben, setzte sie aber jäh wieder nieder.
Er sah, wie ihre rundliche kleine Hand bebte.
»Würde es Ihnen eine große Last sein?« fuhr er leise fort.
Sie schüttelte beinahe heftig den Kopf. »Gewiß nicht! Es ist ja so einsam hier ... und ich ... ich ...« Sie wandte sich kurz ab, lief zum Ofen und warf noch ein Stück Holz in die flackernde Glut.
Sein Blick folgte ihr; voll ehrlichen Entzückens umfaßte er ihre kraftvoll schlanke, so biegsam junge Gestalt, wie sie ihm in gleicher Frische und von gleich edlem Wuchs weder in Frankreich noch in Ungarn begegnet war.
Auch das sehr blonde Haar war ihm neu und übte einen besonderen Reiz aus. Und das Antlitz in seiner rosigen Anmut schien ihm wie eine fremde Blüte, die selten, fast nie in der schwülen Atmosphäre der Großstadt erblüht.
»Wie heißen Sie?« fragt er plötzlich.
Sie wendet sich um und lächelt.
»Ebba Raßmussen!«
»Ebba!«
Mit welch weichem Klang er alles ausspricht. Seine Stimme klingt in den Ohren des Friesenkindes, das nur eine harte und rauhe Sprache gewöhnt ist, wie Musik.
Sie muß ihm den Namen buchstabieren.
»Wie schön und eigenartig er ist«, sagt er und wiederholt noch einmal mit ganz besonderem Ausdruck: »Ebba!«
Und nach einer kurzen Pause, während der er voll Interesse beobachtet, wie sie die vollen Arme hebt und die weißen Gardinen vor das Fenster zieht, ruft er: »Fräulein Ebba! Mich dürstet!«
Sie eilt herzu und reicht ihm die Suppe. Er aber trinkt nicht, sondern hält ihre Hand fest und drückt sie an die Lippen. Das ist zu ungewohnt und zuviel.
Das blonde Mädchen schrickt empor und flieht wie ein scheues Reh aus dem Zimmer. –
Auf dem Nähtischchen, vor Frau Friederike, liegt die Visitenkarte des jungen Ungarn.
»Lajos, Komte de Giöreczy.«
Mutter und Tochter berauschen sich geradezu an dem Wohlklang solch eines Namens.
Sie haben verschiedene Bücher gelesen, in denen elegante, vornehme und galante Ausländer die Hauptrolle spielten, und nun wird die Erinnerung an diese Romanhelden bei Mutter und Tochter wieder wach, nimmt Form und Gestalt an und verkörpert sich in dem Grafen, der, schon jetzt zum Ideal verklärt, die Phantasie erfüllt, als wirke eine Narkose.
Ebba verschränkt die bebenden Hände und drückt sie gegen die Brust, um zu überlegen, ob sie noch einmal das Zimmer des Gastes betreten und nach eventuellen Wünschen fragen soll, als das scharfe Rasseln eines kleinen Einspänners vor dem Haus erklingt. Der Doktor!
Klaus Raßmussen scheint ihn erwartet zu haben.
Man hört seine schweren Schritte auf den Steinfliesen des Flurs, dann wird die Tür aufgeklinkt, und die Stimme des Gutsbesitzers tönt vor dem Fenster.
»Gut, daß Sie schon da sind, Doktor! Drinnen liegt ein ungarischer Offizier, dem ist die Postkutsche über das Bein gegangen. Heda! Andres! Stell den Gaul unter!«
Der Arzt antwortete etwas Unverständliches; beide Männer traten ins Haus und begaben sich ins Krankenzimmer.
Ebba zitterte wie Espenlaub.
»Nun werden sie ihm sehr weh tun!«
»Frag an der Tür, ob sie Hilfe brauchen.«
»Handtücher, Wasser, Seife – alles liegt bereit! Für heißes Wasser sorgt Antje.«
Ebba schleicht angstvoll davon, sie sieht so blaß aus wie die weißgescheuerten Dielen, über die sie schreitet. Nach wenigen Augenblicken kehrt sie zurück.
»Sie brauchen mich nicht, aber wenn Vater ruft, soll ich noch mehr Rotwein bringen.«
»Wohl zur Stärkung für den Grafen«, nickte Frau Friederike, und dann sitzen Mutter und Tochter eng aneinandergeschmiegt im Dämmerlicht und starren auf die Schatten, die tiefer und tiefer ins Zimmer dringen.
Draußen braust der Frühlingssturm über die Heide. Er kommt wieder von der Nordsee herüber, frisch und scharf, und die jungen Knospen am Gesträuch erschauern unter seinem kalten Atem.
»Horch, schreit der Verletzte nicht auf?«
Nein, das Hoftor kreischt in den Angeln, und die Zweige des Flieders schlagen gegen die Fensterscheiben. Sonst ist alles still.
»Wie schrecklich ist solch ein Warten! Ob er wohl sehr leiden muß? Ob das Bein gebrochen ist?«
Endlich, endlich öffnet sich die Stubentür.
»Ebba!«
Das junge Mädchen schnellt empor, wie vom Alpdruck befreit, greift hastig nach dem Tablett mit Flasche und Gläsern und eilt ins Krankenzimmer.
Ihr erster angstvoller Blick gilt dem jungen Offizier.
Er liegt still und etwas bleich und erschöpft in den Kissen, aber sein Blick leuchtet ihr entgegen, und um seine Lippen huscht dasselbe Lächeln, das dem blonden Mädchen alles Blut zum Herzen jagt.
Der Doktor trocknet sich gerade die Hände ab, er hat den stummen Gruß der beiden jungen Leute bemerkt und spitzt die Lippen unter dem borstigen graumelierten Bart, wie einer, der sich mit schlauem Augenzwinkern eins pfeifen möchte.
»Na, Ebbachen! Können Ihrem Pflegebefohlenen gratulieren! Ganz hübscher glatter Bruch ohne alle Komplikation, nicht mal kleine Splitter oder nennenswerte Quetschung. Hat Glück gehabt, der junge Herr! Wärs über den Leib gegangen, säh es vielleicht faul aus! Na, und die Hand ist nur aufgerissen und verschwollen, die wollen wir schon bald wieder in Ordnung haben!«
»Aber mit dem Bein dauert es wohl lang, Herr Doktor?« fragt Ebba, nachdem sie dem Kranken heiß erglühend zugenickt hat, und es scheint dem alten Arzt, als klänge die Stimme mehr wie eine heimliche Bitte als wie eine Frage.
Er ist nicht umsonst ein urfideles, bemoostes Haupt auf der Würzburger Universität gewesen.
Er hob bedenklich die Schultern.
»Solche Sachen wollen Zeit haben, mein liebes Ebbachen.«
Klaus Raßmussen reckte sich etwas strammer in die Höhe; er hatte das Gefühl, als ob die Narbe, die ihm anno siebzig der französische Säbel geschlagen hatte, anfing zu brennen.
»Sie schicken wohl morgen die Ambulanz, Doktor, daß sie den Herrn in das städtische Krankenhaus holt?« fragte er.
Der Doktor hatte Ebba die Hand gereicht. Er fühlte, wie ihre Finger zuckten und seine Rechte erschrocken umklammerten. Wieder huschte sein Blick über ihr angstvoll bebendes Gesicht.
Er versteht und lächelt, ja er möchte sogar laut auflachen.
Er weiß, daß sich der verwitwete Herr Pfarrer bis über die Ohren in die schöne Ebba verguckt hat, daß er auch voll praktischen Sinns mit der sehr vermögenden einzigen Tochter des Gutsbesitzers rechnet. Der Pfarrer und der Doktor aber sind die erbittertsten Feinde, die man sich denken kann, nicht nur scharfe politische Gegner, die sich anläßlich der letzten Wahlen nach jeder Möglichkeit entgegenarbeiten, sondern auch von früher her grimmig verfeindet, als sich die beiden Gattinnen in übler Klatschgeschichte gegenseitig das Haus verboten.
Solch ein Haß schläft in einer kleinen Stadt nie ein, ja er währt noch über das Grab hinaus, und dem Doktor scheint der Gedanke, seinen Feind bis in das tiefste Herz und berechnende Gehirn zu treffen, geradezu entzückend.
Ihm den Rivalen vor die Nase setzen! In das Heidehaus des Klaus Raßmussen ein Kuckucksei legen, das jeden anderen Freier sicher verdrängen wird, das ist ein Spaß, den sich der Doktor schon lange gewünscht hat.
So hebt er auch jetzt mit wahrhaft despotischem Ausdruck in den verquollenen Augen die Hand, als wollte er die Worte des Hausherrn auf das energischste zurückschlagen.
»Ausgeschlossen, mein lieber Raßmussen! Jeder Transport ist vorher geradezu ausgeschlossen. Ich möchte wenigstens auf keinen Fall die Verantwortung übernehmen. Darüber sprechen wir noch. Zunächst bitte ich, den Kranken in voller Ruhe hier zu lassen, bis ich sehe, ob der Gipsverband so bleiben kann.«
Ebbas leuchtender Dankesblick trifft den Sprecher, der Graf aber dreht den schönen Kopf nach Klaus Raßmussen und fragt mit einem leichten Seufzer: »Ich störe Sie sehr, verehrter Herr Raßmussen? Sie und Ihre Damen sind sehr derangiert durch mich.«
Da ist ein Weigern vor dem Arzt doch peinlich, und das gute Herz des blonden Mannes wehrt sich gegen eine Unbarmherzigkeit.
Er schüttelt den Kopf.
»Nicht um unsertwillen, Herr Graf. Aber wir sind einfache Landmenschen, und ich fürchte, wir werden Sie nicht so pflegen können, wie es für Sie nötig ist.«
»Darüber lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen«, ruft der Doktor vergnügt und packt seinen Verbandkasten wieder zusammen, »heute nacht kann sich der Andres einen Strohsack hier auf die Erde legen und die Wünsche des Herrn erfüllen; ich werde ihn instruieren. Morgen schicke ich den alten Philipps zur Wartung, der ist geschickt, willig und billig. Na und unsre kleine Ebba wird schon die Suppe kochen und den Patienten tagsüber verpflegen, davon bin ich überzeugt. Nun mal meinen Braunen vor den Wagen, Raßmussen, ich hab’s eilig!«
Der Graf von Giöreczy streckt dem Hausherrn mit stummem Dank die Hand entgegen, und der Gutsbesitzer faßt sie mit bieder derbem Druck und nickt freundlich. »Ich freue mich, daß Sie bleiben, mein Herr. Was an uns liegt, soll geschehen, daß Sie gut versorgt sind.«
Der Doktor ist weggefahren, das Ehepaar Raßmussen hat dem Fremden eine Gute Nacht gewünscht, und Frau Friederike saß sogar ein paar Minuten am Bett des Grafen, um sich an seinen galanten Dankesworten zu berauschen; dann hat Ebba noch für das Nötigste zur Nacht gesorgt und Andres ein Lager bereitet.
Nun tritt sie an das Bett und fragt, ob der Graf noch Wünsche habe.
»Nein, meine Gnädige, ich danke von Herzen; doch sehne ich mich in diesem Augenblick nur nach etwas Schlaf und hoffe, daß ich ihn trotz der Schmerzen finden werde. Ist es der Fall, so träume ich von meinem blonden Engel, und muß ich wach liegen, so denke ich an ihn. Gute Nacht, Fräulein Ebba!«
Wieder hält er ihre Hand fest und zieht sie an die Lippen, und diesmal flieht sie nicht vor solcher Galanterie, sondern lächelt wie verklärt zu ihm nieder und sagt: »Gott behüte Sie! Gute Besserung!«
Das sind selige, unvergleichliche Tage. Draußen stürzen die Regenfluten über das keimende und knospende Land, es stürmt und tost in den Nächten und hüllt am Tag die Welt in graue Schleier ein.
Was kümmert das zwei junge Herzen!
Ebba sitzt am Lager ihres Schützlings, der immer lebhafter und frischer plaudert und erzählt, je großartiger die Heilung von Bein und Hand fortschreitet.
»Sie müssen vorzügliche Säfte und eine außergewöhnliche Heilhaut haben«, sagt der Doktor, »so schnell habe ich den Heilungsprozeß noch nie verlaufen gesehen.«
»Es ist die herrliche Pflege«, lächelt der Ungar, mit leuchtendem Blick in Ebbas Augen schauend.
»Wenn die Caritas selber an einem Krankenlager waltet, muß ja ein Wunder geschehen!«
Der Doktor schmunzelt und macht ein Gesicht, als wollte er sagen: »Hab ich doch meine Freude dran!«
Die Tage vergehen, es werden Wochen daraus, und der Honvedoffizier kann, auf einen Stock gestützt, durch das Zimmer schreiten, ja, der Doktor erlaubt es sogar mit ganz besonderem Ausdruck in Blick und Stimme, daß der Genesende an Ebbas Seite hinaus in das erste wonnige Frühlingsduften der Heide wandert.
Die Winterstürme sind dem Wonnemond gewichen, und die Stunde kommt, in der Graf Lajos de Giöreczy voll glühender Zärtlichkeit den Arm um seine Pflegerin schlingt und das glückzitternde Mädchen an die Brust drückt, um Mund und Wangen mit brennenden Lippen zu küssen.
Es liegt etwas Leidenschaftliches, Zwingendes in seiner Liebe, das sieghaft zu eigen nimmt und keinen Widerstand duldet. Und Ebba wehrt sich auch nicht.
Ihre ganze Seele ist jauchzende, schwärmerische, alles vergessende Liebe.
Sie hat in die dunklen Augen geschaut und ist in ihre Glückstiefe versunken.
»Ich liebe dich, du blondes, stilles Kind, ich will dich zu eigen nehmen, du sollst mein Weib sein!« flüsterte er, und sie sitzen am Wegrain unter den blühenden Heckenrosen, Arm in Arm, fest und innig aneinandergeschmiegt.
Da erzählt er ihr sein Lebensschicksal.
Er entstammt einer vornehmen, ehemals reichbegüterten Familie. Als sein Vater starb, war er ein Knabe, und der große Landbesitz wurde von der Mutter verwaltet. Daß dies sehr gewissenlos geschah, ahnte er nicht, und als die lebensfrohe Frau in Paris starb und die Güter stark verschuldet hinterließ, kümmerte ihn das Defizit wenig, denn er war noch immer reich und verblieb auch zuerst in dem berauschenden Seine-Babel, wo er genug Freunde gefunden hatte, um sein Leben am Hof der schönen Kaiserin Eugenie zu genießen.
Er hatte wohl Glück bei den Frauen, aber weniger beim Spiel; er war ein toller Geselle voll schäumender Lebenslust, der nichts wehren konnte.
Da kam der Krieg mit Deutschland.
Sein Besitztum in Ungarn war völlig heruntergewirtschaftet, viele Gebäude durch ein Gewitter niedergebrannt, was Wunder, wenn er sich der französischen Armee anschloß.
Als er nach dem Friedensschluß als nervöser, unzufriedener Mann nach Ungarn heimkehrte und versuchen wollte, zu retten, was noch zu retten war, da zeigte es sich, daß er ohne Kapital auf dem Trümmerhaufen der schon so gewissenlos verwüsteten Besitzungen bankrott geworden war. Er verkaufte die Ländereien für ein Spottgeld, trat bei den Reitern ein und verjubelte in kurzer Zeit den Erlös.
Die Verhältnisse in dem Vaterland, das ihm beinah fremd geworden war, machten ihm aber den Dienst als Offizier in einem flotten Kavallerieregiment nicht mehr möglich.
Abenteuerlustig und heißblütig, wie er war, quittierte er als Mittelloser, um aus dem einzigen Talent, seinen großartigen, schier meisterlichen Reitkenntnissen, Kapital zu schlagen.
Er wurde Schulreiter; erst bei einem kleinen englischen Zirkus, dann bei dem renommierten Loisette, der ihm, dem bald sehr gefeierten und umjubelten Liebling des Publikums, brillante Gage bezahlte und ihn für eine Tournee nach Deutschland verpflichtete. Ein kleines Liebesabenteuer mit einer Nichte des Direktors, die er sich weigerte zu heiraten, lösten seinen Kontrakt.
Er gastierte aber bei anderen Unternehmen mit viel Erfolg und Glück und stand soeben im Begriff, von Bremen nach der kleinen Stadt O. zu fahren, um bei einem dort vorübergehend weilenden Zirkus ein Engagement anzunehmen, als die Überschwemmung und ein Dammrutsch bei M. die Eisenbahn für etliche Tage außer Betrieb setzten.
Da es eilig war, beschloß Lajos, eine kurze Strecke mit der Post zu fahren, um die gefährdete Strecke zu umgehen und den Zug bei X. aufs neue zu besteigen. Wie seine Pläne durchkreuzt wurden, hatte Ebba erlebt.
»Und nun«, schloß der Graf, »werde ich zu deinem Vater gehen und ihm und deiner Mutter meine Verhältnisse klarlegen. Ich habe zwar keine feste Anstellung, aber immerhin als Künstler sehr hohe Einnahmen, und da gute Schulreiter sehr gesucht sind, so bin ich auch nie ohne Engagement. Ich werde um deine Hand anhalten, meine Ebba, und hoffe zuversichtlich, daß du mir als mein zärtlich geliebtes Weib in die bunte, fröhliche, so unbeschreiblich schöne Welt folgen darfst.«
Das junge Mädchen legte die Arme voll banger Sorge um ihn. »Erhoff nicht zuviel! Mein Vater liebt die Zirkusreiter nicht, er ist in der Stadt vom Pfarrer Wallerthür durch freche Hänseleien, daß er dich so lange beherbergt, aufs äußerste gereizt. Ich fürchte, du wirbst vergeblich, Geliebter!«
»Ebba! Das wäre unser Tod!« fuhr er mit zorngeschwellter Ader leidenschaftlich auf.
Sie drückt sich fester in seinen Arm und blickt ihn wunderlich, mit flimmerndem Blick an. »Er trennt uns nicht, Lajos! Ich folge dir, wohin du mich führen willst!«
Ein halb erstickter Jubelschrei von den Lippen des Grafen. »Ebba, schwörst du es?«
Ja, sie schwört es ihm. Sie verrät ihm auch, daß die Mutter von ihrem Entschluß weiß und ihn billigt, daß sie helfen wird, den Vater zu versöhnen, wenn er sieht, wie stark und groß die Liebe seines Kindes ist.
Welch ein seliges Flüstern, Beraten, Herzen und Küssen! Alles wird zur Flucht vorbereitet, und Ebba breitet mit fieberndem Blick die Arme nach der sinkenden Sonne aus und murmelt: »Ich folge dir, goldenes Licht! Die Zeit ist gekommen, in der die Liebe an mein Gefängnis klopft und die Ketten sprengt.«
Graf von Giöreczy hielt bei Klaus Raßmussen um die Hand seiner Tochter an und wurde mit ingrimmigem Lächeln höflich, aber sehr energisch abgewiesen.
Die Lichter verlöschten im Heidehaus. Frau Friederike lag mit zitternden Gliedern im Bett und rang die Hände im Gebet. Da huschte es leise in ihr Zimmer. Es waren Ebba und Lajos.
Noch einmal Herz an Herz. Friederike begreift es, daß ihr Kind nicht anders handeln kann. Sie muß weinen und möchte doch jauchzen, daß ihr Liebling ein solch traumhaftes Glück gefunden hat.
Um zwei Uhr nachts geht die Post am Haus vorüber, um drei Uhr führt der Schnellzug die Liebenden nach Hamburg, von da nach England zur Trauung.
Lebt wohl! Lebt wohl!
Die Schritte verklingen, leise wird die Haustür geschlossen. Wie ein Seufzer der Sehnsucht weht der kühle Seewind über den blühenden Flieder.