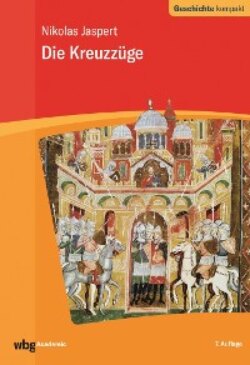Читать книгу Die Kreuzzüge - Nikolas Jaspert - Страница 10
1. Christentum, Islam und Heidentum am Ende des 11. Jahrhunderts a) Die christliche Welt um 1095
ОглавлениеGeographische Weltbilder
Gegen Ende des 11. Jahrhunderts gehörten die meisten Menschen Europas – Christen, Muslime und Juden – konfessionellen Großgruppen an, doch ihre Lebenswelt war im Wesentlichen kleinräumig. Im Christentum etwa prägte die Zugehörigkeit zu einer Familie oder zu einem Pfarrsprengel den Menschen weitaus stärker als übergeordnete Größen. Konzepte wie „Europa“ oder „das Abendland“ spielten keine bedeutende Rolle. Auch der geographische Horizont der allermeisten Zeitgenossen war beschränkt. Nur in gebildeten, klerikalen Gruppen wurden ältere Raumvorstellungen aufgegriffen und in Form von Weltkarten (mappae mundi) verzeichnet. Diese waren gemeinhin Träger eines theologisch, mythisch und historisch geprägten Weltbildes. In der Regel wurden in Anlehnung an antike Autoren und christliche Autoritäten so genannte T-O-Karten geschaffen: Auf ihnen trennte in Form eines T das Mittelmeer auf der einen Seite und Don, Nil oder das Rote Meer auf der anderen die Kontinente Europa, Asien und Afrika voneinander. Ein Ozeanring umschloss alle drei Erdteile in Form eines O. Über politische und kulturelle Realitäten sagen diese Darstellungen wenig aus. Denn im Gegensatz zu dem durch die mappae mundi vermittelten Weltbild stellten zum Ende des 11. Jahrhunderts weder die christlich noch die islamisch geprägten Gebiete eine Einheit dar.
Herrschaftliche Zersplitterung
Im Christentum bestanden zwei sprachlich, kulturell und rituell voneinander getrennte Räume, der griechische Osten und der lateinischen Westen mit ihren jeweiligen kirchlichen Zentren Konstantinopel und Rom. Im Westen war das alte Karolingerreich bloß noch eine ferne, wenngleich mehrfach beschworene Erinnerung. Dieses von den Pyrenäen bis an die Elbe reichende, von den Franken beherrschte Reich, das von Karl dem Großen und seinem Sohn Ludwig dem Frommen zur höchsten Blüte geführt worden war, hatte sich im Verlauf des 10. Jahrhunderts im Wesentlichen in zwei Herrschaften gespalten: das Westfrankenreich, aus dem das spätere Frankreich hervorgehen sollte, und das Ostfrankenreich, aus dem sich bis zum 11. Jahrhundert das Römisch-Deutsche Reich entwickelte. Die Mehrzahl der späteren Kreuzfahrer stammte aus Gebieten, die ehemals zum Karolingerreich gehörten. Doch galt dies keineswegs für alle Kontingente (z.B. für englische oder ungarische Kreuzfahrer), und außerdem wurde dieser historische Bezug von den Betroffenen selbst kaum hergestellt. In der Sicht der Muslime oder der griechischen Christen dagegen stellten die westlichen Kreuzfahrer sehr wohl eine Gemeinschaft dar, die eine eigene Bezeichnung verdiente. Die lateinischen Christen wurden daher in den islamischen und griechischen Quellen als „Franken“ (arab. Ifranğ bzw. griech. phrangoi – φρἀνγοι) bezeichnet.
Zu den Elementen, die in der Tat von allen westlichen Herrschaften gleichermaßen geteilt wurden, gehörte die Kultsprache, das Lateinische. Sie war im Zuge der so genannten karolingischen Renaissance an der Wende zum 9. Jahrhundert gefestigt worden, wurde von der Kirche gepflegt und diente als Bildungs- und Rechtssprache neben den jeweiligen Volkssprachen. Weiterhin hatte das lateinische Europa vergleichbare politische und soziale Strukturen gemein, insbesondere das so genannte Lehenswesen. Hierunter versteht man eine Rechtsbeziehung, bei der ein Begünstigter (Vasall) ein Gut (Lehen) zur Nutzung erhielt, wofür er im Gegenzug zu Dienstleistungen an den Verleiher verpflichtet war. Da bei der Vergabe der Begünstigte auch einen Treueid schwor, entstanden im Lehnswesen abgestufte Formen der Abhängigkeit. Dieses System hatte für den Kriegerstand der Ritter weitreichende Folgen und wirkte sich auf die Kreuzzüge aus. Deutlich differenzierter war Europa hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Nach einer großen demographischen und ökonomischen Depression im Frühmittelalter hatte u.a. ein allgemeiner Anstieg der Bevölkerungszahlen die Entwicklung von Städtelandschaften entlang des Rheins, in Flandern, vor allem aber in Italien begünstigt. Kaufleute der großen Hafenstädte Italiens wie Amalfi, Pisa, Genua oder Venedig suchten den Weg übers Meer zu den bedeutendsten Wirtschaftszentren des 11. Jahrhunderts, also nach Konstantinopel und in den muslimischen Osten, und der Handel brachte ihnen und ihren Heimatorten erheblichen Reichtum.
Im Ostfrankenreich hatten die Herrscher seit der Mitte des 10. Jahrhunderts die karolingische Tradition fortführen können, den Kaiser zu stellen. Dies und die Möglichkeit, die mächtigen Erzbistümer und Bistümer zu besetzen, hatte unter den Dynastien der Ottonen und der Salier zu einer Stärkung des Königtums geführt. Dennoch standen die salischen Könige auch der Macht der regionalen Gewalten, insbesondere der Herzöge von Sachsen, Niederlothringen, Bayern oder Schwaben gegenüber, die große Unabhängigkeit genossen. Noch selbstständiger agierten die Fürsten im Westfrankenreich. Dieses von Katalonien im Westen bis nach Flandern im Osten reichende Gebiet unterstand zum Ende des 11. Jahrhunderts zwar nominell der Herrschaft der Kapetingerkönige, die den Titel eines rex francorum trugen, doch herrschten diese faktisch bloß über einen verhältnismäßig kleinen Raum zwischen Orleans und dem Tal der Oise. Der Rest des Reiches unterstand Herzögen und Grafen, von denen einige, wie die Herzöge von Aquitanien, der Gascogne und der Normandie oder die Grafen von Flandern, Barcelona, Toulouse, Anjou und der Champagne, über beträchtliche Macht und Ressourcen verfügten. Neben den älteren europäischen Königreichen, zu denen auch León auf der Iberischen Halbinsel oder das seit 1066 von den Normannen beherrschte England zählten, erlangten im Verlauf des 10. und 11. Jahrhunderts die Herrscher einiger jüngerer Reiche die Königskrone, etwa diejenigen Kastiliens, Aragóns, Dänemarks, Ungarns, Polens und Böhmens. Besonders spektakulär war der Aufstieg der sizilischen Normannen. Diesen war es zur Mitte des 11. Jahrhunderts unter ihrem Anführer Robert Guiscard († 1085) gelungen, die Insel von den Muslimen und Teile Süditaliens von den Byzantinern zu erobern. Robert, der seit 1053 den Titel eines Herzogs führte, baute ein straff verwaltetes Reich auf, das aggressiv gegen die anderen Mächte des östlichen Mittelmeerraums, also gegen Byzanz und die islamischen Mächte, vorging.
Byzanz
Byzanz erlebte von der Mitte des 9. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts eine Blüteperiode. Hierzu trug nicht unwesentlich der Niedergang des muslimischen Reichs der Abbasiden sowie die Missionierung und schließlich Unterwerfung der Bulgaren (endgültig in den 1020er-Jahren) bei. Unter den Herrschern der „makedonischen Dynastie“ (867–1056) bzw. ihren befähigten Generälen wurde erfolgreich die Rückeroberung verlorener Gebiete betrieben, und zu Beginn des 11. Jahrhunderts erlebte das so genannte mittelbyzantinische Reich unter Kaiser Basileios II. (976–1025) den Höhepunkt seiner Machtausdehnung und Prachtentfaltung. Es war eine Epoche großer literarischer und künstlerischer Werke, als der byzantinische Hof bei weitem die Zentren der lateinischen Christenheit überstrahlte. Die griechische Kirche wurde nicht mehr durch theologische Auseinandersetzung entzweit, und die Bekehrung der Russen und Bulgaren brachten ihr ein zusätzlich gesteigertes Selbstbewusstsein.
E
Der Streit von 1054
Nicht nur die griechisch-orthodoxe Kirche erfuhr zur Mitte des 11. Jahrhunderts eine Konsolidierung: Im Zuge der so genannten gregorianischen Reform (vgl. Kap. I., 3. a) entwickelte das Papsttum in Rom ein neues, ausgeprägtes Selbstverständnis, das schwerlich mit den byzantinischen Interessen in Einklang zu bringen war. Dies wurde auch beim Konflikt zwischen dem Patriarchen von Konstantinopel und einem Vertreter des Papstes im Jahre 1054 deutlich, bei dem sich beide Kirchenmänner gegenseitig exkommunizierten. Beim Streit ging es um theologische, liturgische und kirchenpolitische Fragen: zum einen um das filioque – also das rechte Verständnis der Dreifaltigkeitslehre –, zum anderen um die Benutzung gesäuerten oder ungesäuerten Brots bei der Eucharistiefeier sowie schließlich auch um die Vorherrschaftsansprüche des römischen Papstes und die Machtverhältnisse in Süditalien. Die Tragweite der Geschehnisse trat erst allmählich zutage, daher ist der Begriff „Schisma“ irreführend. Eine allmähliche Entfremdung in liturgisch-kultischer Hinsicht, vor allem aber die Plünderung Konstantinopels im Jahre 1204 sollten in dieser Frage weitaus stärkere Wirkung als das Zerwürfnis von 1054 haben. Doch seit diesem Jahr sollten beide Kirchen nie wieder dauerhaft vereinigt werden.
Bedrohung des Byzantinischen Reichs
Zur Mitte des 11. Jahrhunderts traten auch Missstände im Inneren des Byzantinischen Reiches zutage: Die alte Wehrverfassung war für die großen Offensivunternehmungen der makedonischen Dynastie nicht mehr geeignet, die Kaiser griffen daher immer häufiger auf Söldner zurück. Dies ist auch als ein – letztlich erfolgloser – Versuch zu werten, ein Gegengewicht zur wachsenden Macht des regionalen Adels zu schaffen. Dass dieser zu Recht als Gefahr eingeschätzt wurde, kam nach dem Tod des Kaisers Basileios II. zum Vorschein, als das Reich von einer Vielzahl von Putschversuchen erschüttert wurde. Zudem machte sich seit der Mitte des Jahrhunderts eine neue Bedrohung an der Ostgrenze des Reichs bemerkbar: die muslimischen Seldschuken. Diese in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts aufgestiegene türkische Dynastie wurde anfangs von den Byzantinern wenig beachtet, doch im Jahre 1071 konnte ihr Heer die kaiserliche Armee bei Mantzikert nahe des Wansees in Ostanatolien vernichtend schlagen und sogar Kaiser Romanos IV. (1068–1071) gefangen nehmen. Das byzantinische Staatswesen fiel in eine schwere Krise. Usurpationen und Herrscherwechsel kennzeichnen die Jahre von 1071 bis zur Machtübernahme durch den General Alexios Komnenos (1081–1118) im Jahre 1081. Zwar konnte sich dieser in der Ägais und auf dem Balkan erfolgreich behaupten und durch geschickte Diplomatie die Gefahr einer normannischen Invasion vorerst bannen; doch war es ihm nicht möglich, die Macht der Normannen oder der Seldschuken wirklich zu brechen. Nur einige Küstenstriche Kleinasiens konnten wiedergewonnen werden, Süditalien und Inneranatolien blieben hingegen verloren.