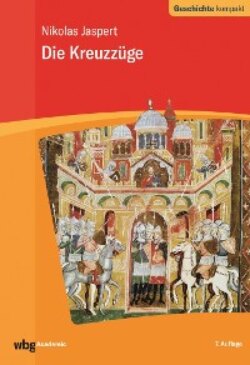Читать книгу Die Kreuzzüge - Nikolas Jaspert - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Das Buß- und Ablasswesen
ОглавлениеDie neuen religiösen Bewegungen des 11. Jahrhunderts, in Teilen auch die so genannte gregorianische Reformbewegung, waren ganz wesentlich von der Frage nach persönlicher Schuld und Sühne geprägt. Fehlerhaftes Handeln forderte nicht nur Bestrafung, sondern auch öffentliche Bußhandlungen. In den so genannten Bußbüchern des Frühmittelalters wurden Vergehen und die dafür abzuleistenden öffentlichen Bußen genau festgehalten. Im 11. Jahrhundert wurde die Buße aber zunehmend zu etwas Individuellem, Persönlichem. Die reinigende Handlung erfolgte immer häufiger nicht aus einem konkreten Anlass, sondern wegen der allgemeinen Sündhaftigkeit des Menschen. Die Angst vor den eigenen Unzulänglichkeiten und den Folgen persönlicher Verfehlungen ließen viele Laien an ihrem Seelenheil zweifeln. Nicht dem diesseitigen Leben, sondern dem viel längeren Dasein nach dem Tode drohte höchste Gefahr.
Kreuzzug als Akt der Buße
Es gab aber Möglichkeiten, dieser Bedrohung zu begegnen, denn eine grundlegende Annahme der Kirche war und ist, dass das Verhältnis zwischen diesseitigem und jenseitigem Leben eines von Ursache und Wirkung darstellt, dass also Handlungen zu Lebzeiten das Leben nach dem Tod beeinflussen können. Die Gläubigen machten daher kirchlichen Einrichtungen Zuwendungen, damit dort für ihr Seelenheil gebetet werde. Sie versuchten aber auch, sich durch eigene Handlungen zu läutern, zu reinigen. Hierzu diente die Buße. Die spätere kirchliche Lehre, wonach die Buße lediglich ein öffentlicher Akt nach der eigentlichen Versöhnung mit der Kirche darstellt, war zum Ende des 11. Jahrhunderts noch nicht entwickelt. Man meinte vielmehr, sie könne auch tatsächlich helfen, für begangene Sünden Vergebung vor Gott zu erlangen. Der Kreuzzug aber, ein gefährliches Unternehmen mit ungewissem Ausgang, stellte eine besonders strenge Form der Buße dar. Urkunden und Briefe der Kreuzfahrer belegen, wie stark der Wunsch war, durch die Teilnahme daran für begangene Sünden Buße zu tun. Aus diesem Gedanken abgeleitet war die Vorstellung vom geistlichen Privileg, dem Ablass.
Dabei dürfte Papst Urbans Anliegen ursprünglich ein anderes gewesen sein. Im Kreuzzugskanon von Clermont ist nur von einem Ablass der irdischen Bußstrafen für alle diejenigen, die sich aus reiner Gottesliebe (sola devotione) dem Zug anschlössen, die Rede. Doch infolge der Kreuzzugspredigt durch Dritte und der mündlichen Wiedergabe des Aufrufs hieß es bald, der Papst habe nicht den Erlass der hiesigen Bußstrafen, sondern denjenigen der jenseitigen Sündenstrafen, ja sogar die Tilgung aller Sünden überhaupt versprochen. Die Kreuzfahrer erwarteten also, dass sie unmittelbar ins Paradies einzögen, sollten sie während des Zuges sterben. Papst Urban II. scheint dieses Fait accompli hingegenommen zu haben, denn er selbst griff einige Monate nach dem Konzil von Clermont in einem Werbungsschreiben an die Flamen den Begriff der remissio peccatorum auf.
E
Remissio peccatorum
Schon vor dem Ersten Kreuzzug hatten kirchliche Einrichtungen für kleinere Wallfahrten und Spenden – etwa zugunsten von Kirchenbauten – Teilablässe der Bußstrafen versprochen. Hier muss man sehr genau zwischen den so genannten irdischen Bußstrafen und den jenseitigen, von Gott verhängten Sündenstrafen, die einem nach dem Tod erwarteten, unterscheiden. Mit irdischen Bußleistungen konnte man zweierlei erreichen: die Wiederaufnahme in die kirchliche Gemeinschaft und die Minderung der Sündenstrafen. Doch war nicht sichergestellt, ob auch alle diese Strafen durch die Bußleistung abgegolten waren. Die Angst vor den jenseitigen, den Rest der Sündenschuld tilgenden Strafen blieb. Nur die Tilgung aller Sünden, die remissio peccatorum, gab hier Gewissheit, und genau diese äußerste Form des Ablasses (Indulgenz), diesen so genannten Plenarablass, sahen die Kreuzfahrer durch den Papst 1095 bei Clermont in Aussicht gestellt.
Urban II. war nicht der erste Papst, der ihn benutzte. Schon im Jahre 1064 hatte Alexander II. (1061–1073) dieses Angebot ausgesprochen, doch es galt lediglich einigen Rittern, die bereits in Spanien (bei Barbastro) gegen Muslime kämpften, sodass sein Ablass fast wirkungslos blieb. Nicht wesentlich anders erging es einer Initiative Papst Urbans II. aus dem Jahre 1089 und wieder 1096–1099, mit der er Christen zur Wiederherstellung der Kirche in der katalanischen Stadt Tarragona bewegen wollte. Hierfür wurde 1096–1099 ausdrücklich die Tilgung der Sündenstrafen in Aussicht gestellt. Die Verbindung zwischen dem Kampf gegen die Muslime und dem Plenarablass wurde also in vollem Maße erstmals auf der Iberischen Halbinsel hergestellt. Doch erbrachten diese Aufrufe einen vergleichsweise geringen Zulauf im Vergleich zur Rede von Clermont. Woran lag dies?
Die Zugkraft Jerusalems
Vor allem konnte die Iberische Halbinsel gewiss nicht auf die biblische Tradition des Heiligen Landes bauen. Die Verteidigung oder Rückgewinnung der Heiligen Stätten war etwas, wofür Menschen ihre Besitzungen und ihr Leben zu opfern bereit waren, die Verteidigung Tarragonas war es nur bedingt. Ein ums andere Mal belegen die Urkunden und Kreuzzugsbriefe die Anziehungskraft, die das Heilige Grab und Jerusalem selbst ausstrahlten. Der Zug von 1096–1099 galt dem Gelobten Land, der terra promissionis der Bibel. Hier treffen sich der Buß- und Ablassgedanke mit dem Phänomen der Massenwallfahrt und der spezifischen Jerusalemfrömmigkeit. In diesen größeren Rahmen fügte sich die Kreuzfahrt ein – einem Rahmen, in dem eben nicht nur ritterliche Waffenträger, sondern Arme und Reiche, Kleriker und Bauern, Männer und Frauen gleichermaßen einen Platz fanden.
Es gab also auch vor dem Konzil des Jahres 1095 durchaus schon eine Reihe päpstlicher Aufrufe zum Krieg und sogar Beispiele dafür, dass die Teilnahme hieran als verdienstvolle Gewaltanwendung begriffen wurde, für die geistliche Gnaden zu erlangen waren. Doch erhielten solche, aus den beschriebenen Entwicklungen auf der Apenninen- und der Iberischen Halbinsel erklärbaren Initiativen durch den Investiturstreit eine neue Dimension: Dieser ließ das Papsttum in bisher unbekanntem Maße auf weltliche Belange Einfluss ausüben, und die Kirchenorganisation wurde gestärkt. Auch andere bislang vorgestellte Vorbedingungen der Kreuzzüge wurden in diesem Zusammenhang aufgegriffen: Die Vorstellung von Krieg im Dienst der Kirche wurde als eine besondere Form der Buße propagiert, die devotionalen Aspekte der Pilgerfahrt mit dem Gedanken des gerechten Kriegs verbunden. All dies bereitete zweifellos dem Kreuzzug den Weg.
Erst die Gesamtheit der in den letzten beiden Kapiteln dargestellten Motivationen bildete die Voraussetzung für die ungeheure Dynamik, die Urbans Rede 1095 freisetzte. Fassen wir kurz die wichtigsten acht Komplexe zusammen: erstens die älteren Auffassungen vom gerechten Krieg und der neuere Gedanke des heiligen Kriegs als Werkzeug Gottes – der Kreuzzug wurde dadurch zu einer Form verdienstvoller Gewaltanwendung; zweitens die Vorstellung vom rechten inneren Beweggrund und dem Kampf als Dienst am Nächsten; drittens die Einbindung eines vom vasallitischen Treuegedanken geprägten, zunehmend verchristlichten Ritterstands durch die Kirche und die Ablenkung seiner militärischen Energien in eine auch für ihn attraktive und ehrenhafte Alternative; viertens die ältere Tradition der Pilgerfahrt, in der im 11. Jahrhundert die Jerusalemwallfahrt eine gesteigerte Bedeutung erlangte; fünftens die neue, aktivere Rolle des Papsttums im Zuge der gregorianischen Reform, die es zum anerkannten Anführer eines im Heilsgeschehen begründeten und dadurch geheiligten Heereszuges machte; sechstens die religiöse Unruhe des ausgehenden 11. Jahrhunderts mit ihren vielfältigen Formen geistlichen Lebens und ihrem ausgeprägten Christozentrismus; sowie schließlich siebtens und achtens die gerade in einer Zeit religiöser Umbrüche wachsende Sorge des Einzelnen um die eigene Sündhaftigkeit und die Aussicht, durch einen besonderen Akt der Buße vor Gott Vergebung für diese Sünden zu finden, sogar alle zeitlichen Sündenstrafen durch die Teilnahme an einem militärischen Unternehmen zu tilgen. Es war das Zusammenwirken dieser Elemente, das die Sprengkraft der Kreuzzüge ausmachte.
Spätere Motivationen
In den Jahrzehnten und Jahrhunderten nach dem Ersten Kreuzzug, besonders im Spätmittelalter, wurden die vorwiegend aus Theologie und Frömmigkeit abgeleiteten Motive von anderen ergänzt und teilweise überlagert. Das gesteigerte Prestige eines erfolgreich heimgekehrten Kreuzfahrers dürfte häufiger als zuvor eine wichtige Rolle gespielt haben, ebenso Reise- und Abenteuerlust oder der Wunsch, ritterlich-höfischen Idealen der spätmittelalterlichen Adelskultur nachzueifern. Nicht zuletzt konnte durch die Teilnahme an einem Kreuzzug auch eine Familientradition begründet werden, die von nachfolgenden Generationen gepflegt wurde.
Dass alle hier zusammengetragenen Vorstellungen und Intentionen mit weniger hehren oder auch verwerflichen Handlungen und Motivationen Hand in Hand gingen, darf und soll nicht verschwiegen werden. Kreuzfahrer wähnten sich als Teilnehmer an einem geheiligten Krieg zum Wohle des Herren und der heiligen Orte, ihr eigenes Verhalten war aber oft alles andere als heilig. Wie alle Kriege waren auch die Kreuzzüge brutale, schreckliche Ereignisse, die den Menschen auf beiden Seiten viel Leid brachten. Idealismus und die unbestreitbare persönliche Frömmigkeit Vieler schlossen keineswegs Arroganz, Unbarmherzigkeit und Grausamkeit aus. Die Heere, die zum Wohle Christi kämpften, bestanden denn auch aus Kriegern und Unbewaffneten, Armen und Reichen, Sündern und Heiligen, die von unterschiedlichsten Motivationen getrieben wurden. Die Vielzahl individueller, teilweise sich überlagernder oder ergänzender Beweggründe, die am ehesten aus den erhaltenen Urkunden der Kreuzfahrer abzulesen sind, verhindert es, in den Kreuzzügen ein gleichförmiges, bloß aus einem Antrieb heraus entstandenes Phänomen zu sehen. Vielmehr spiegeln sie in ihrer Vielschichtigkeit und ihrem Wandel den ungleichmäßigen inneren Zustand der lateinischen Christenheit selbst wider. Doch gerade die vielen für den heutigen Betrachter fremden religiösen, spirituellen und theologischen Motive sind hervorzuheben, weil sie jenseits der Grundkonstanten aller Kriege wie Hass, Habsucht oder Grausamkeit das spezifisch Mittelalterliche der Kreuzzüge ausmachen.